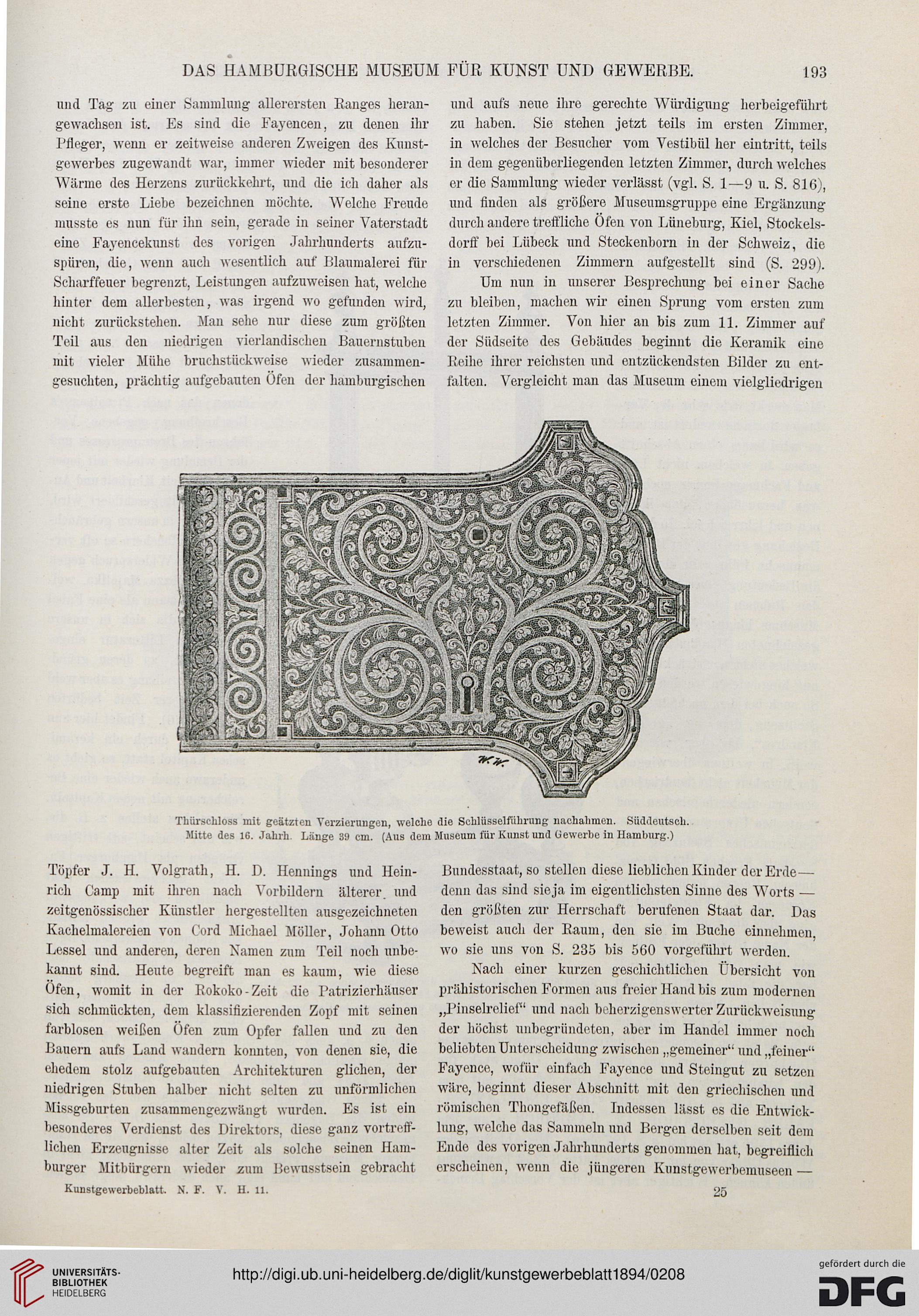DAS HAMBURGISCHE MUSEUM FÜR KUNST UND GEWERBE.
193
und Tag zu einer Sammlung allerersten Eanges heran-
gewachsen ist. Es sind die Fayencen, zu denen ihr
Pfleger, wenn er zeitweise anderen Zweigen des Kunst-
gewerbes zugewandt war, immer wieder mit besonderer
Wärme des Herzens zurückkehrt, und die icli daher als
seine erste Liebe bezeichnen möchte. Welche Freude
musste es nun für ihn sein, gerade in seiner Vaterstadt
eine Fayeucekunst des vorigen Jahrhunderts aufzu-
spüren, die, wenn auch wesentlich auf Blaumalerei für
Scharffeuer begrenzt, Leistungen aufzuweisen hat, welche
hinter dem allerbesten, was irgend wo gefunden wird,
nicht zurückstellen. Mau sehe nur diese zum grüßten
Teil aus den niedrigen vierlandischen Bauernstuben
mit vieler Mühe bruchstückweise wieder zusammen-
gesuchten, prächtig aufgebauten Öfen der hamburgischen
und aufs neue ihre gerechte Würdigung herbeigeführt
zu haben. Sie stehen jetzt teils im ersten Zimmer,
in welches der Besucher vom Vestibül her eintritt, teils
in dem gegenüberliegenden letzten Zimmer, durch welches
er die Sammlung wieder verlässt (vgl. S. 1—9 u. S. 816),
und finden als größere Museumsgruppe eine Ergänzung
durch andere treffliche Öfen von Lüneburg, Kiel, Stockels-
dorff bei Lübeck und Steckenborn in der Schweiz, die
in verschiedenen Zimmern aufgestellt sind (S. 299).
Um nun in unserer Besprechung bei einer Sache
zu bleiben, machen wir einen Sprung vom ersten zum
letzten Zimmer. Von hier an bis zum 11. Zimmer auf
der Südseite des Gebäudes beginnt die Keramik eine
Reihe ihrer reichsten und entzückendsten Bilder zu ent-
falten. Vergleicht man das Museum einem vielgliedrigen
Thürschloss mit geätzten Verzierungen, welche die Schlüsselführung nachahmen. Süddeutsch.
Mitte des IG. Jahrh. Länge 39 cm. (Aus dem Museum für Kunst und Gewerbe in Hamhurg.)
Tüpfer J. H. Volgrath, H. 1). Hennings und Hein-
rich Camp mit ihren nach Vorbildern älterer, und
zeitgenössischer Künstler hergestellten ausgezeichneten
Kachelmalereien von Cord Michael Möller, Johann Otto
Lessei und anderen, deren Namen zum Teil noch unbe-
kannt sind. Heute begreift man es kaum, wie diese
Ofen, womit in der Rokoko-Zeit die Patrizierhäuser
sich schmückten, dem klassifizierenden Zopf mit seinen
farblosen weißen Öfen zum Opfer fallen und zu den
Bauern aufs Land wandern konnten, von denen sie, die
ehedem stolz aufgebauten Architekturen glichen, der
niedrigen Stuben halber nicht selten zu unförmlichen
Missgeburten zusammengezwängt wurden. Es ist ein
besonderes Verdienst des Direktors, diese ganz vortreff-
lichen Erzeugnisse alter Zeit als solche seinen Ham-
burger Mitbürgern wieder zum Bewusstsein gebracht
Kunstgewerbeblatt. X. F. V. H. 11.
Bundesstaat, so stellen diese lieblichen Kinder der Erde—
denn das sind sie ja im eigentlichsten Sinne des Worts —
den grüßten zur Herrschaft berufenen Staat dar. Das
beweist auch der Raum, den sie im Buche einnehmen
wo sie uns von S. 235 bis 560 vorgeführt werden.
Nach einer kurzen geschichtlichen Übersicht von
prähistorischen Formen aus freier Hand bis zum modernen
„l'inselrelief" und nach beherzigenswerter Zurückweisung
der buchst unbegründeten, aber im Handel immer noch
beliebten Unterscheidung zwischen „gemeiner" und „feiner"
Fayence, wofür einfach Fayence und Steingut zu setzen
wäre, beginnt dieser Abschnitt mit den griechischen und
römischen Thongefäßen. Indessen lässt es die Entwick-
lung, welche das Sammeln und Bergen derselben seit dem
Ende des vorigen Jahrhunderts genommen hat, begreiflich
erscheinen, wenn die jüngeren Kunstgewerbemuseen —
25
193
und Tag zu einer Sammlung allerersten Eanges heran-
gewachsen ist. Es sind die Fayencen, zu denen ihr
Pfleger, wenn er zeitweise anderen Zweigen des Kunst-
gewerbes zugewandt war, immer wieder mit besonderer
Wärme des Herzens zurückkehrt, und die icli daher als
seine erste Liebe bezeichnen möchte. Welche Freude
musste es nun für ihn sein, gerade in seiner Vaterstadt
eine Fayeucekunst des vorigen Jahrhunderts aufzu-
spüren, die, wenn auch wesentlich auf Blaumalerei für
Scharffeuer begrenzt, Leistungen aufzuweisen hat, welche
hinter dem allerbesten, was irgend wo gefunden wird,
nicht zurückstellen. Mau sehe nur diese zum grüßten
Teil aus den niedrigen vierlandischen Bauernstuben
mit vieler Mühe bruchstückweise wieder zusammen-
gesuchten, prächtig aufgebauten Öfen der hamburgischen
und aufs neue ihre gerechte Würdigung herbeigeführt
zu haben. Sie stehen jetzt teils im ersten Zimmer,
in welches der Besucher vom Vestibül her eintritt, teils
in dem gegenüberliegenden letzten Zimmer, durch welches
er die Sammlung wieder verlässt (vgl. S. 1—9 u. S. 816),
und finden als größere Museumsgruppe eine Ergänzung
durch andere treffliche Öfen von Lüneburg, Kiel, Stockels-
dorff bei Lübeck und Steckenborn in der Schweiz, die
in verschiedenen Zimmern aufgestellt sind (S. 299).
Um nun in unserer Besprechung bei einer Sache
zu bleiben, machen wir einen Sprung vom ersten zum
letzten Zimmer. Von hier an bis zum 11. Zimmer auf
der Südseite des Gebäudes beginnt die Keramik eine
Reihe ihrer reichsten und entzückendsten Bilder zu ent-
falten. Vergleicht man das Museum einem vielgliedrigen
Thürschloss mit geätzten Verzierungen, welche die Schlüsselführung nachahmen. Süddeutsch.
Mitte des IG. Jahrh. Länge 39 cm. (Aus dem Museum für Kunst und Gewerbe in Hamhurg.)
Tüpfer J. H. Volgrath, H. 1). Hennings und Hein-
rich Camp mit ihren nach Vorbildern älterer, und
zeitgenössischer Künstler hergestellten ausgezeichneten
Kachelmalereien von Cord Michael Möller, Johann Otto
Lessei und anderen, deren Namen zum Teil noch unbe-
kannt sind. Heute begreift man es kaum, wie diese
Ofen, womit in der Rokoko-Zeit die Patrizierhäuser
sich schmückten, dem klassifizierenden Zopf mit seinen
farblosen weißen Öfen zum Opfer fallen und zu den
Bauern aufs Land wandern konnten, von denen sie, die
ehedem stolz aufgebauten Architekturen glichen, der
niedrigen Stuben halber nicht selten zu unförmlichen
Missgeburten zusammengezwängt wurden. Es ist ein
besonderes Verdienst des Direktors, diese ganz vortreff-
lichen Erzeugnisse alter Zeit als solche seinen Ham-
burger Mitbürgern wieder zum Bewusstsein gebracht
Kunstgewerbeblatt. X. F. V. H. 11.
Bundesstaat, so stellen diese lieblichen Kinder der Erde—
denn das sind sie ja im eigentlichsten Sinne des Worts —
den grüßten zur Herrschaft berufenen Staat dar. Das
beweist auch der Raum, den sie im Buche einnehmen
wo sie uns von S. 235 bis 560 vorgeführt werden.
Nach einer kurzen geschichtlichen Übersicht von
prähistorischen Formen aus freier Hand bis zum modernen
„l'inselrelief" und nach beherzigenswerter Zurückweisung
der buchst unbegründeten, aber im Handel immer noch
beliebten Unterscheidung zwischen „gemeiner" und „feiner"
Fayence, wofür einfach Fayence und Steingut zu setzen
wäre, beginnt dieser Abschnitt mit den griechischen und
römischen Thongefäßen. Indessen lässt es die Entwick-
lung, welche das Sammeln und Bergen derselben seit dem
Ende des vorigen Jahrhunderts genommen hat, begreiflich
erscheinen, wenn die jüngeren Kunstgewerbemuseen —
25