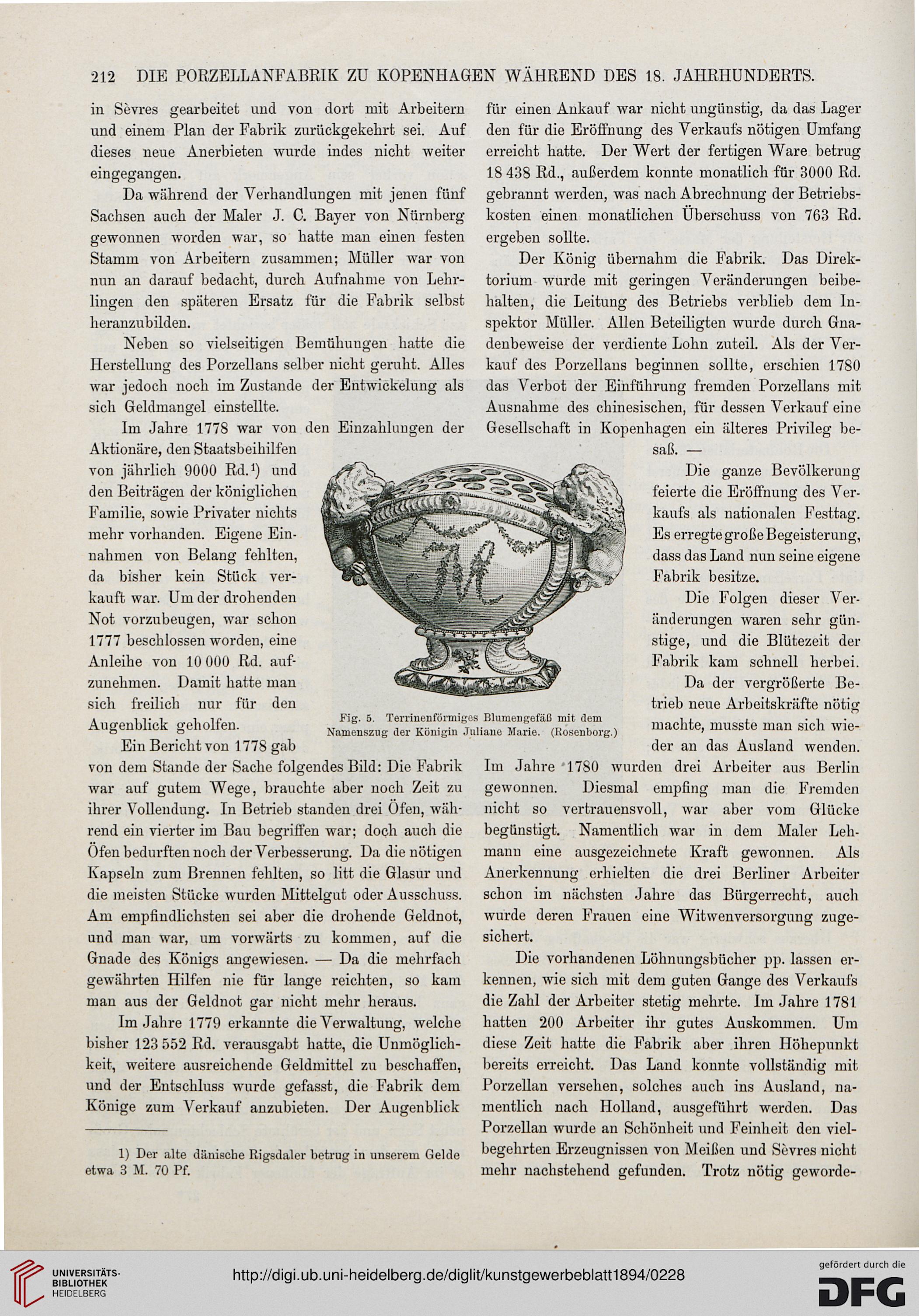212 DIE PORZELLANFABRIK ZU KOPENHAGEN WÄHREND DES 18. JAHRHUNDERTS.
in Sevres gearbeitet und von dort mit Arbeitern
und einem Plan der Fabrik zurückgekehrt sei. Auf
dieses neue Anerbieten wurde indes nicht weiter
eingegangen.
Da während der Verhandlungen mit jenen fünf
Sachsen auch der Maler J. C. Bayer von Nürnberg
gewonnen worden war, so hatte man einen festen
Stamm von Arbeitern zusammen; Müller war von
nun an darauf bedacht, durch Aufnahme von Lehr-
für einen Ankauf war nicht ungünstig, da das Lager
den für die Eröffnung des Verkaufs nötigen Umfang
erreicht hatte. Der Wert der fertigen Ware betrug
18 438 Rd., außerdem konnte monatlich für 3000 Rd.
gebrannt werden, was nach Abrechnung der Betriebs-
kosten einen monatlichen Überschuss von 763 Rd.
ergeben sollte.
Der König übernahm die Fabrik. Das Direk-
torium wurde mit geringen Veränderungen beibe-
lingen den späteren Ersatz für die Fabrik selbst halten, die Leitung des Betriebs verblieb dem In-
heranzubilden.
Neben so vielseitigen Bemühungen hatte die
Herstellung des Porzellans selber nicht geruht. Alles
war jedoch noch im Zustande der Entwickelung als
sich Geldmangel einstellte.
Im Jahre 1778 war von den Einzahlungen der
Aktionäre, den Staatsbeihilfen
von jährlich 9000 Rd.') und
den Beiträgen der königlichen
Familie, sowie Privater nichts
mehr vorhanden. Eigene Ein-
nahmen von Belang fehlten,
da bisher kein Stück ver-
kauft war. Um der drohenden
Not vorzubeugen, war schon
1777 beschlossen worden, eine
Anleihe von 10 000 Rd. auf-
zunehmen. Damit hatte man
sich freilich nur für den
Augenblick geholfen.
Ein Bericht von 1778 gab
von dem Stande der Sache folgendes Bild: Die Fabrik
war auf gutem Wege, brauchte aber noch Zeit zu
ihrer Vollendung. In Betrieb standen drei Ofen, wäh-
rend ein vierter im Bau begriffen war; doch auch die
Öfen bedurften noch der Verbesserung. Da die nötigen
Kapseln zum Brennen fehlten, so litt die Glasur und
die meisten Stücke wurden Mittelgut oder Ausschuss.
Am empfindlichsten sei aber die drohende Geldnot,
und man war, um vorwärts zu kommen, auf die
Gnade des Königs angewiesen. — Da die mehrfach
gewährten Hilfen nie für lange reichten, so kam
man aus der Geldnot gar nicht mehr heraus.
Im Jahre 1779 erkannte die Verwaltung, welche
bisher 123 552 Rd. verausgabt hatte, die Unmöglich-
keit, weitere ausreichende Geldmittel zu beschaffen,
und der Entschluss wurde gefasst, die Fabrik dem
Könige zum Verkauf anzubieten. Der Augenblick
Fig. 5. Terrinenförmiges Blumengefäß mit dem
Namenszug der Königin Juliaue Marie. (Itosenborg.)
1) Der alte dänische Rigsdaler betrug in unserem Gelde
etwa 3 M. 70 Pf.
spektor Müller. Allen Beteiligten wurde durch Gna-
denbeweise der verdiente Lohn zuteil. Als der Ver-
kauf des Porzellans beginnen sollte, erschien 1780
das Verbot der Einführung fremden Porzellans mit
Ausnahme des chinesischen, für dessen Verkauf eine
Gesellschaft in Kopenhagen ein älteres Privileg be-
saß. —
Die ganze Bevölkerung
feierte die Eröffnung des Ver-
kaufs als nationalen Festtag.
Es erregte große Begeisterung,
dass das Land nun seine eigene
Fabrik besitze.
Die Folgen dieser Ver-
änderungen waren sehr gün-
stige, und die Blütezeit der
Fabrik kam schnell herbei.
Da der vergrößerte Be-
trieb neue Arbeitskräfte nötig
machte, musste man sich wie-
der an das Ausland wenden.
Im Jahre '1780 wurden drei Arbeiter aus Berlin
gewonnen. Diesmal empfing man die Fremden
nicht so vertrauensvoll, war aber vom Glücke
begünstigt. Namentlich war in dem Maler Leh-
mann eine ausgezeichnete Kraft gewonnen. Als
Anerkennung erhielten die drei Berliner Arbeiter
schon im nächsten Jahre das Bürgerrecht, auch
wurde deren Frauen eine Witwenversorgung zuge-
sichert.
Die vorhandenen Löhnungsbücher pp. lassen er-
kennen, wie sich mit dem guten Gange des Verkaufs
die Zahl der Arbeiter stetig mehrte. Im Jahre 1781
hatten 200 Arbeiter ihr gutes Auskommen. Um
diese Zeit hatte die Fabrik aber ihren Höhepunkt
bereits erreicht. Das Land konnte vollständig mit
Porzellan versehen, solches auch ins Ausland, na-
mentlich nach Holland, ausgeführt werden. Das
Porzellan wurde an Schönheit und Feinheit den viel-
begehrten Erzeugnissen von Meißen und Sevres nicht
mehr nachstehend gefunden. Trotz nötig geworde-
in Sevres gearbeitet und von dort mit Arbeitern
und einem Plan der Fabrik zurückgekehrt sei. Auf
dieses neue Anerbieten wurde indes nicht weiter
eingegangen.
Da während der Verhandlungen mit jenen fünf
Sachsen auch der Maler J. C. Bayer von Nürnberg
gewonnen worden war, so hatte man einen festen
Stamm von Arbeitern zusammen; Müller war von
nun an darauf bedacht, durch Aufnahme von Lehr-
für einen Ankauf war nicht ungünstig, da das Lager
den für die Eröffnung des Verkaufs nötigen Umfang
erreicht hatte. Der Wert der fertigen Ware betrug
18 438 Rd., außerdem konnte monatlich für 3000 Rd.
gebrannt werden, was nach Abrechnung der Betriebs-
kosten einen monatlichen Überschuss von 763 Rd.
ergeben sollte.
Der König übernahm die Fabrik. Das Direk-
torium wurde mit geringen Veränderungen beibe-
lingen den späteren Ersatz für die Fabrik selbst halten, die Leitung des Betriebs verblieb dem In-
heranzubilden.
Neben so vielseitigen Bemühungen hatte die
Herstellung des Porzellans selber nicht geruht. Alles
war jedoch noch im Zustande der Entwickelung als
sich Geldmangel einstellte.
Im Jahre 1778 war von den Einzahlungen der
Aktionäre, den Staatsbeihilfen
von jährlich 9000 Rd.') und
den Beiträgen der königlichen
Familie, sowie Privater nichts
mehr vorhanden. Eigene Ein-
nahmen von Belang fehlten,
da bisher kein Stück ver-
kauft war. Um der drohenden
Not vorzubeugen, war schon
1777 beschlossen worden, eine
Anleihe von 10 000 Rd. auf-
zunehmen. Damit hatte man
sich freilich nur für den
Augenblick geholfen.
Ein Bericht von 1778 gab
von dem Stande der Sache folgendes Bild: Die Fabrik
war auf gutem Wege, brauchte aber noch Zeit zu
ihrer Vollendung. In Betrieb standen drei Ofen, wäh-
rend ein vierter im Bau begriffen war; doch auch die
Öfen bedurften noch der Verbesserung. Da die nötigen
Kapseln zum Brennen fehlten, so litt die Glasur und
die meisten Stücke wurden Mittelgut oder Ausschuss.
Am empfindlichsten sei aber die drohende Geldnot,
und man war, um vorwärts zu kommen, auf die
Gnade des Königs angewiesen. — Da die mehrfach
gewährten Hilfen nie für lange reichten, so kam
man aus der Geldnot gar nicht mehr heraus.
Im Jahre 1779 erkannte die Verwaltung, welche
bisher 123 552 Rd. verausgabt hatte, die Unmöglich-
keit, weitere ausreichende Geldmittel zu beschaffen,
und der Entschluss wurde gefasst, die Fabrik dem
Könige zum Verkauf anzubieten. Der Augenblick
Fig. 5. Terrinenförmiges Blumengefäß mit dem
Namenszug der Königin Juliaue Marie. (Itosenborg.)
1) Der alte dänische Rigsdaler betrug in unserem Gelde
etwa 3 M. 70 Pf.
spektor Müller. Allen Beteiligten wurde durch Gna-
denbeweise der verdiente Lohn zuteil. Als der Ver-
kauf des Porzellans beginnen sollte, erschien 1780
das Verbot der Einführung fremden Porzellans mit
Ausnahme des chinesischen, für dessen Verkauf eine
Gesellschaft in Kopenhagen ein älteres Privileg be-
saß. —
Die ganze Bevölkerung
feierte die Eröffnung des Ver-
kaufs als nationalen Festtag.
Es erregte große Begeisterung,
dass das Land nun seine eigene
Fabrik besitze.
Die Folgen dieser Ver-
änderungen waren sehr gün-
stige, und die Blütezeit der
Fabrik kam schnell herbei.
Da der vergrößerte Be-
trieb neue Arbeitskräfte nötig
machte, musste man sich wie-
der an das Ausland wenden.
Im Jahre '1780 wurden drei Arbeiter aus Berlin
gewonnen. Diesmal empfing man die Fremden
nicht so vertrauensvoll, war aber vom Glücke
begünstigt. Namentlich war in dem Maler Leh-
mann eine ausgezeichnete Kraft gewonnen. Als
Anerkennung erhielten die drei Berliner Arbeiter
schon im nächsten Jahre das Bürgerrecht, auch
wurde deren Frauen eine Witwenversorgung zuge-
sichert.
Die vorhandenen Löhnungsbücher pp. lassen er-
kennen, wie sich mit dem guten Gange des Verkaufs
die Zahl der Arbeiter stetig mehrte. Im Jahre 1781
hatten 200 Arbeiter ihr gutes Auskommen. Um
diese Zeit hatte die Fabrik aber ihren Höhepunkt
bereits erreicht. Das Land konnte vollständig mit
Porzellan versehen, solches auch ins Ausland, na-
mentlich nach Holland, ausgeführt werden. Das
Porzellan wurde an Schönheit und Feinheit den viel-
begehrten Erzeugnissen von Meißen und Sevres nicht
mehr nachstehend gefunden. Trotz nötig geworde-