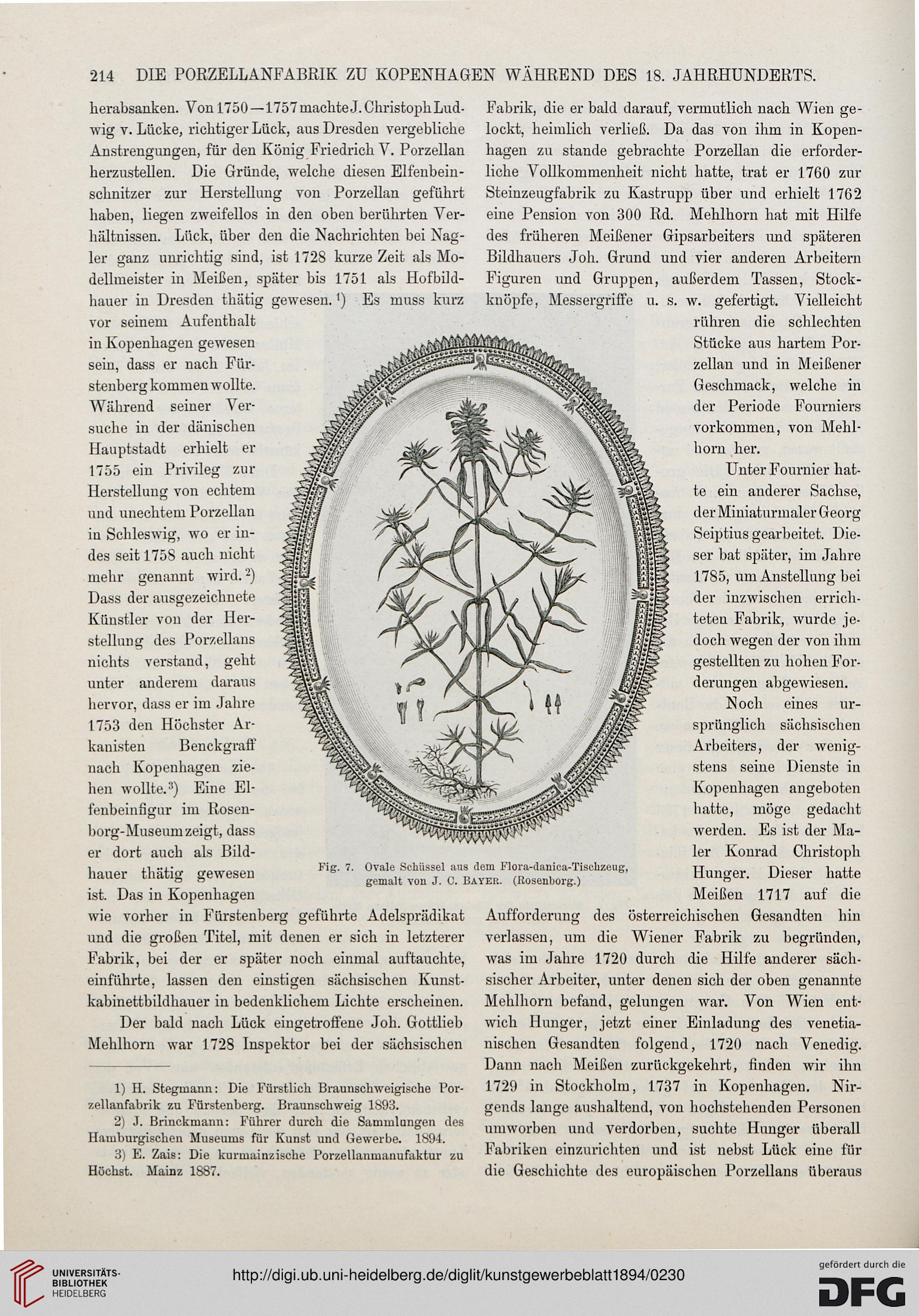214 DIE PORZELLANFABRIK ZU KOPENHAGEN WÄHREND DES 18. JAHRHUNDERTS.
herabsanken. Von 1750 — 1757machte J.Christoph Lud-
wig v. Lücke, richtiger Lück, aus Dresden vergebliche
Anstrengungen, für den König Friedrich V. Porzellan
herzustellen. Die Gründe, welche diesen Elfenbein-
schnitzer zur Herstellung von Porzellan geführt
haben, liegen zweifellos in den oben berührten Ver-
hältnissen. Lück, über den die Nachrichten bei Nag-
ler ganz unrichtig sind, ist 1728 kurze Zeit als Mo-
dellmeister in Meißen, später bis 1751 als Hofbild-
hauer in Dresden thätig gewesen.') Es muss kurz
vor seinem Aufenthalt
in Kopenhagen gewesen
sein, dass er nach Für-
stenberg kommen wollte.
Während seiner Ver-
suche in der dänischen
Hauptstadt erhielt er
1755 ein Privileg zur
Herstellung von echtem
und unechtem Porzellan
in Schleswig, wo er in-
des seit 1758 auch nicht
mehr genannt wird.2)
Dass der ausgezeichnete
Künstler von der Her-
stellung des Porzellans
nichts verstand, geht
unter anderem daraus
hervor, dass er im Jahre
1753 den Höchster Ar-
kanisten Benckgraff
nach Kopenhagen zie-
hen wollte.3) Eine El-
fenbeinfigur im Rosen-
borg-Museum zeigt, dass
er dort auch als Bild-
hauer thätig gewesen
ist. Das in Kopenhagen
wie vorher in Fürstenberg geführte Adelsprädikat
und die großen Titel, mit denen er sich in letzterer
Fabrik, bei der er später noch einmal auftauchte,
einführte, lassen den einstigen sächsischen Kunst-
kabinettbildhauer in bedenklichem Lichte erscheinen.
Der bald nach Lück eingetroffene Joh. Gottlieb
Mehlhorn war 1728 Inspektor bei der sächsischen
Fig. 7.
1) H. Stegmann: Die Fürstlich Braunschweigische Por-
zellanfabrik zu Fürstenberg. Braunschweig 1893.
2) J. Brinckmann: Führer durch die Sammlungen des
Hamburgischen Museums für Kunst und Gewerbe. 1894.
3) E. Zais: Die kurmainzische Porzellanmanufaktur zu
Höchst. Mainz 1887.
Fabrik, die er bald darauf, vermutlich nach Wien ge-
lockt, heimlich verließ. Da das von ihm in Kopen-
hagen zu stände gebrachte Porzellan die erforder-
liche Vollkommenheit nicht hatte, trat er 1760 zur
Steinzeugfabrik zu Kastrupp über und erhielt 1762
eine Pension von 300 Rd. Mehlhorn hat mit Hilfe
des früheren Meißener Gipsarbeiters und späteren
Bildhauers Joh. Grund und vier anderen Arbeitern
Figuren und Gruppen, außerdem Tassen, Stock-
knöpfe, Messergriffe u. s. w. gefertigt. Vielleicht
rühren die schlechten
Stücke aus hartem Por-
zellan und in Meißener
Geschmack, welche in
der Periode Fourniers
vorkommen, von Mehl-
horn her.
Unter Fournier hat-
te ein anderer Sachse,
der Miniatur in aler G eor g
Seiptius gearbeitet. Die-
ser bat später, im Jahre
1785, um Anstellung bei
der inzwischen errich-
teten Fabrik, wurde je-
doch wegen der von ihm
gestellten zu hohen For-
derungen abgewiesen.
Noch eines ur-
sprünglich sächsischen
Arbeiters, der wenig-
stens seine Dienste in
Kopenhagen angeboten
hatte, möge gedacht
werden. Es ist der Ma-
ler Konrad Christoph
Hunger. Dieser hatte
Meißen 1717 auf die
Aufforderung des österreichischen Gesandten hin
verlassen, um die Wiener Fabrik zu begründen,
was im Jahre 1720 durch die Hilfe anderer säch-
sischer Arbeiter, unter denen sich der oben genannte
Mehlhorn befand, gelungen war. Von Wien ent-
wich Hunger, jetzt einer Einladung des venetia-
nischen Gesandten folgend, 1720 nach Venedig.
Dann nach Meißen zurückgekehrt, finden wir ihn
1729 in Stockholm, 1737 in Kopenhagen. Nir-
gends lange aushaltend, von hochstehenden Personen
umworben und verdorben, suchte Hunger überall
Fabriken einzurichten und ist nebst Lück eine für
die Geschichte des europäischen Porzellans überaus
Ovale Schüssel aus dem Flora-danica-Tischzeug,
gemalt von J. C. Bayer. (Rosenborg.)
herabsanken. Von 1750 — 1757machte J.Christoph Lud-
wig v. Lücke, richtiger Lück, aus Dresden vergebliche
Anstrengungen, für den König Friedrich V. Porzellan
herzustellen. Die Gründe, welche diesen Elfenbein-
schnitzer zur Herstellung von Porzellan geführt
haben, liegen zweifellos in den oben berührten Ver-
hältnissen. Lück, über den die Nachrichten bei Nag-
ler ganz unrichtig sind, ist 1728 kurze Zeit als Mo-
dellmeister in Meißen, später bis 1751 als Hofbild-
hauer in Dresden thätig gewesen.') Es muss kurz
vor seinem Aufenthalt
in Kopenhagen gewesen
sein, dass er nach Für-
stenberg kommen wollte.
Während seiner Ver-
suche in der dänischen
Hauptstadt erhielt er
1755 ein Privileg zur
Herstellung von echtem
und unechtem Porzellan
in Schleswig, wo er in-
des seit 1758 auch nicht
mehr genannt wird.2)
Dass der ausgezeichnete
Künstler von der Her-
stellung des Porzellans
nichts verstand, geht
unter anderem daraus
hervor, dass er im Jahre
1753 den Höchster Ar-
kanisten Benckgraff
nach Kopenhagen zie-
hen wollte.3) Eine El-
fenbeinfigur im Rosen-
borg-Museum zeigt, dass
er dort auch als Bild-
hauer thätig gewesen
ist. Das in Kopenhagen
wie vorher in Fürstenberg geführte Adelsprädikat
und die großen Titel, mit denen er sich in letzterer
Fabrik, bei der er später noch einmal auftauchte,
einführte, lassen den einstigen sächsischen Kunst-
kabinettbildhauer in bedenklichem Lichte erscheinen.
Der bald nach Lück eingetroffene Joh. Gottlieb
Mehlhorn war 1728 Inspektor bei der sächsischen
Fig. 7.
1) H. Stegmann: Die Fürstlich Braunschweigische Por-
zellanfabrik zu Fürstenberg. Braunschweig 1893.
2) J. Brinckmann: Führer durch die Sammlungen des
Hamburgischen Museums für Kunst und Gewerbe. 1894.
3) E. Zais: Die kurmainzische Porzellanmanufaktur zu
Höchst. Mainz 1887.
Fabrik, die er bald darauf, vermutlich nach Wien ge-
lockt, heimlich verließ. Da das von ihm in Kopen-
hagen zu stände gebrachte Porzellan die erforder-
liche Vollkommenheit nicht hatte, trat er 1760 zur
Steinzeugfabrik zu Kastrupp über und erhielt 1762
eine Pension von 300 Rd. Mehlhorn hat mit Hilfe
des früheren Meißener Gipsarbeiters und späteren
Bildhauers Joh. Grund und vier anderen Arbeitern
Figuren und Gruppen, außerdem Tassen, Stock-
knöpfe, Messergriffe u. s. w. gefertigt. Vielleicht
rühren die schlechten
Stücke aus hartem Por-
zellan und in Meißener
Geschmack, welche in
der Periode Fourniers
vorkommen, von Mehl-
horn her.
Unter Fournier hat-
te ein anderer Sachse,
der Miniatur in aler G eor g
Seiptius gearbeitet. Die-
ser bat später, im Jahre
1785, um Anstellung bei
der inzwischen errich-
teten Fabrik, wurde je-
doch wegen der von ihm
gestellten zu hohen For-
derungen abgewiesen.
Noch eines ur-
sprünglich sächsischen
Arbeiters, der wenig-
stens seine Dienste in
Kopenhagen angeboten
hatte, möge gedacht
werden. Es ist der Ma-
ler Konrad Christoph
Hunger. Dieser hatte
Meißen 1717 auf die
Aufforderung des österreichischen Gesandten hin
verlassen, um die Wiener Fabrik zu begründen,
was im Jahre 1720 durch die Hilfe anderer säch-
sischer Arbeiter, unter denen sich der oben genannte
Mehlhorn befand, gelungen war. Von Wien ent-
wich Hunger, jetzt einer Einladung des venetia-
nischen Gesandten folgend, 1720 nach Venedig.
Dann nach Meißen zurückgekehrt, finden wir ihn
1729 in Stockholm, 1737 in Kopenhagen. Nir-
gends lange aushaltend, von hochstehenden Personen
umworben und verdorben, suchte Hunger überall
Fabriken einzurichten und ist nebst Lück eine für
die Geschichte des europäischen Porzellans überaus
Ovale Schüssel aus dem Flora-danica-Tischzeug,
gemalt von J. C. Bayer. (Rosenborg.)