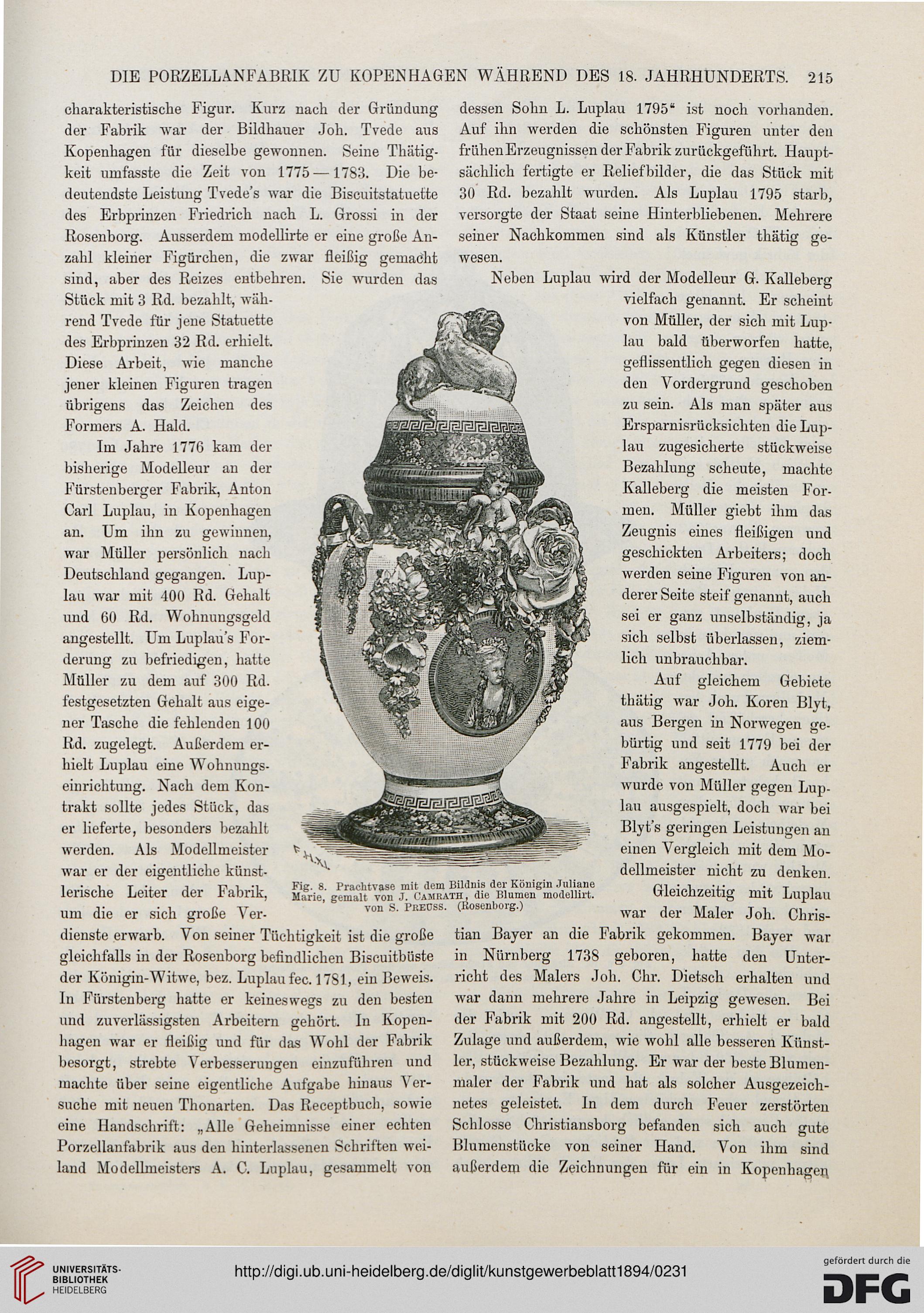DIE PORZELLANFABRIK ZU KOPENHAGEN WÄHREND DES 18. JAHRHUNDERTS. 215
charakteristische Figur. Kurz nach der Gründung
der Fabrik war der Bildhauer Joh. Tvede aus
Kopenhagen für dieselbe gewonnen. Seine Thätig-
keit uinfasste die Zeit von 1775—1783. Die be-
deutendste Leistung Tvede's war die Biscuitstatuette
des Erbprinzen Friedrich nach L. Grossi in der
Rosenborg. Ausserdem modellirte er eine große An-
zahl kleiner Figürchen, die zwar fleißig gemacht
sind, aber des Reizes entbehren. Sie wurden das
Stück mit 3 Rd. bezahlt, wäh-
rend Tvede für jene Statuette
des Erbprinzen 32 Rd. erhielt.
Diese Arbeit, wie manche
jener kleinen Figuren tragen
übrigens das Zeichen des
Formers A. Hald.
Im Jahre 177G kam der
bisherige Modelleur an der
Fürstenberger Fabrik, Anton
Carl Luplau, in Kopenhagen
an. Um ihn zu gewinnen,
war Müller persönlich nach
Deutschland gegangen. Lup-
lau war mit 400 Rd. Gehalt
und 60 Rd. Wohnungsgeld
angestellt. Um Luplau's For-
derung zu befriedigen, hatte
Müller zu dem auf 300 Rd.
festgesetzten Gehalt aus eige-
ner Tasche die fehlenden 100
Rd. zugelegt. Außerdem er-
hielt Luplau eine Wohnungs-
einrichtung. Nach dem Kon-
trakt sollte jedes Stück, das
er lieferte, besonders bezahlt
werden. Als Modellmeister
war er der eigentliche künst-
lerische Leiter der Fabrik,
um die er sich große Ver- ^^^^^^^^^^^^^^
dienste erwarb. Von seiner Tüchtigkeit ist die große
gleichfalls in der Rosenborg befindlichen Biscuitbüste
der Königin-Witwe, bez. Luplau fec. 1781, ein Beweis.
In Fürstenberg hatte er keineswegs zu den besten
und zuverlässigsten Arbeitern gehört. In Kopen-
hagen war er fleißig und für das Wohl der Fabrik
besorgt, strebte Verbesserungen einzuführen und
machte über seine eigentliche Aufgabe hinaus A er-
suche mit neuen Thonarten. Das Receptbuch, sowie
eine Handschrift: „Alle Geheimnisse einer echten
Porzellanfabrik aus den hinterlassenen Schriften wei-
land Modellmeisters A. C. Luplau, gesammelt von
Fig. 8. Prachtvase mit dem Bildnis der Königin Juliane
Marie, gemalt von J. Camrath, die Blumen modellirt.
von S. Preüss. (Rosenborg.)
dessen Sohn L. Luplau 1795" ist noch vorhanden.
Auf ihn werden die schönsten Figuren unter den
frühen Erzeugnissen der Fabrik zurückgeführt. Haupt-
sächlich fertigte er Reliefbilder, die das Stück mit
30 Rd. bezahlt wurden. Als Luplau 1795 starb,
versorgte der Staat seine Hinterbliebenen. Mehrere
seiner Nachkommen sind als Künstler thätig ge-
wesen.
Neben Luplau wird der Modelleur G. Kalleberg
vielfach genannt. Er scheint
von Müller, der sich mit Lup-
lau bald überworfen hatte,
geflissentlich gegen diesen in
den Vordergrund geschoben
zu sein. Als man später aus
Ersparnisrücksichten die Lup-
lau zugesicherte stückweise
Bezahlung scheute, machte
Kalleberg die meisten For-
men. Müller giebt ihm das
Zeugnis eines fleißigen und
geschickten Arbeiters; doch
werden seine Figuren von an-
derer Seite steif genannt, auch
sei er ganz unselbständig, ja
sich selbst überlassen, ziem-
lich unbrauchbar.
Auf gleichem Gebiete
thätig war Joh. Koren Blyt,
aus Bergen in Norwegen ge-
bürtig und seit 1779 bei der
Fabrik angestellt. Auch er
wurde von Müller gegen Lup-
lau ausgespielt, doch war bei
Blyt's geringen Leistungen an
einen Vergleich mit dem Mo-
dellmeister nicht zu denken.
Gleichzeitig mit Luplau
^^^^^^^^^^^^^ war der Maler Joh. Chris-
tian Bayer an die Fabrik gekommen. Bayer war
in Nürnberg 1738 geboren, hatte den Unter-
richt des Malers Joh. Chr. Dietsch erhalten und
war dann mehrere Jahre in Leipzig gewesen. Bei
der Fabrik mit 200 Rd. angestellt, erhielt er bald
Zulage und außerdem, wie wohl alle besseren Künst-
ler, stückweise Bezahlung. Er war der beste Blumen-
maler der Fabrik und hat als solcher Ausgezeich-
netes geleistet. In dem durch Feuer zerstörten
Schlosse Christiansborg befanden sich auch gute
Blumenstücke von seiner Hand. Von ihm sind
außerdem die Zeichnungen für ein in Kopenhagen
charakteristische Figur. Kurz nach der Gründung
der Fabrik war der Bildhauer Joh. Tvede aus
Kopenhagen für dieselbe gewonnen. Seine Thätig-
keit uinfasste die Zeit von 1775—1783. Die be-
deutendste Leistung Tvede's war die Biscuitstatuette
des Erbprinzen Friedrich nach L. Grossi in der
Rosenborg. Ausserdem modellirte er eine große An-
zahl kleiner Figürchen, die zwar fleißig gemacht
sind, aber des Reizes entbehren. Sie wurden das
Stück mit 3 Rd. bezahlt, wäh-
rend Tvede für jene Statuette
des Erbprinzen 32 Rd. erhielt.
Diese Arbeit, wie manche
jener kleinen Figuren tragen
übrigens das Zeichen des
Formers A. Hald.
Im Jahre 177G kam der
bisherige Modelleur an der
Fürstenberger Fabrik, Anton
Carl Luplau, in Kopenhagen
an. Um ihn zu gewinnen,
war Müller persönlich nach
Deutschland gegangen. Lup-
lau war mit 400 Rd. Gehalt
und 60 Rd. Wohnungsgeld
angestellt. Um Luplau's For-
derung zu befriedigen, hatte
Müller zu dem auf 300 Rd.
festgesetzten Gehalt aus eige-
ner Tasche die fehlenden 100
Rd. zugelegt. Außerdem er-
hielt Luplau eine Wohnungs-
einrichtung. Nach dem Kon-
trakt sollte jedes Stück, das
er lieferte, besonders bezahlt
werden. Als Modellmeister
war er der eigentliche künst-
lerische Leiter der Fabrik,
um die er sich große Ver- ^^^^^^^^^^^^^^
dienste erwarb. Von seiner Tüchtigkeit ist die große
gleichfalls in der Rosenborg befindlichen Biscuitbüste
der Königin-Witwe, bez. Luplau fec. 1781, ein Beweis.
In Fürstenberg hatte er keineswegs zu den besten
und zuverlässigsten Arbeitern gehört. In Kopen-
hagen war er fleißig und für das Wohl der Fabrik
besorgt, strebte Verbesserungen einzuführen und
machte über seine eigentliche Aufgabe hinaus A er-
suche mit neuen Thonarten. Das Receptbuch, sowie
eine Handschrift: „Alle Geheimnisse einer echten
Porzellanfabrik aus den hinterlassenen Schriften wei-
land Modellmeisters A. C. Luplau, gesammelt von
Fig. 8. Prachtvase mit dem Bildnis der Königin Juliane
Marie, gemalt von J. Camrath, die Blumen modellirt.
von S. Preüss. (Rosenborg.)
dessen Sohn L. Luplau 1795" ist noch vorhanden.
Auf ihn werden die schönsten Figuren unter den
frühen Erzeugnissen der Fabrik zurückgeführt. Haupt-
sächlich fertigte er Reliefbilder, die das Stück mit
30 Rd. bezahlt wurden. Als Luplau 1795 starb,
versorgte der Staat seine Hinterbliebenen. Mehrere
seiner Nachkommen sind als Künstler thätig ge-
wesen.
Neben Luplau wird der Modelleur G. Kalleberg
vielfach genannt. Er scheint
von Müller, der sich mit Lup-
lau bald überworfen hatte,
geflissentlich gegen diesen in
den Vordergrund geschoben
zu sein. Als man später aus
Ersparnisrücksichten die Lup-
lau zugesicherte stückweise
Bezahlung scheute, machte
Kalleberg die meisten For-
men. Müller giebt ihm das
Zeugnis eines fleißigen und
geschickten Arbeiters; doch
werden seine Figuren von an-
derer Seite steif genannt, auch
sei er ganz unselbständig, ja
sich selbst überlassen, ziem-
lich unbrauchbar.
Auf gleichem Gebiete
thätig war Joh. Koren Blyt,
aus Bergen in Norwegen ge-
bürtig und seit 1779 bei der
Fabrik angestellt. Auch er
wurde von Müller gegen Lup-
lau ausgespielt, doch war bei
Blyt's geringen Leistungen an
einen Vergleich mit dem Mo-
dellmeister nicht zu denken.
Gleichzeitig mit Luplau
^^^^^^^^^^^^^ war der Maler Joh. Chris-
tian Bayer an die Fabrik gekommen. Bayer war
in Nürnberg 1738 geboren, hatte den Unter-
richt des Malers Joh. Chr. Dietsch erhalten und
war dann mehrere Jahre in Leipzig gewesen. Bei
der Fabrik mit 200 Rd. angestellt, erhielt er bald
Zulage und außerdem, wie wohl alle besseren Künst-
ler, stückweise Bezahlung. Er war der beste Blumen-
maler der Fabrik und hat als solcher Ausgezeich-
netes geleistet. In dem durch Feuer zerstörten
Schlosse Christiansborg befanden sich auch gute
Blumenstücke von seiner Hand. Von ihm sind
außerdem die Zeichnungen für ein in Kopenhagen