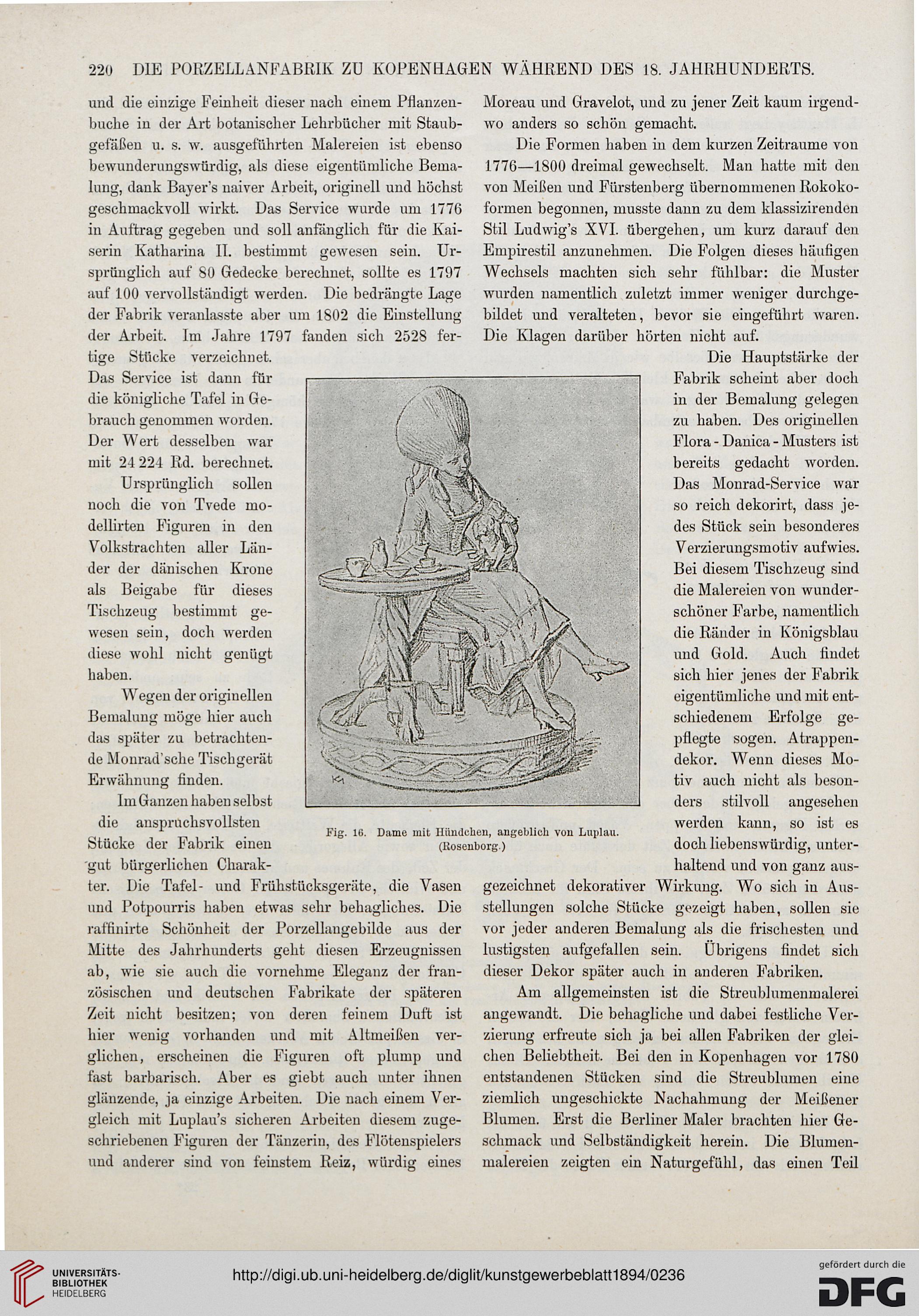220 DIE PORZELLANFABRIK ZU KOPENHAGEN WÄHREND DES 18. JAHRHUNDERTS.
und die einzige Feinheit dieser nach einem Pflanzen-
buche in der Art botanischer Lehrbücher mit Staub-
gefäßen u. s. w. ausgeführten Malereien ist ebenso
bewunderungswürdig, als diese eigentümliche Bema-
lung, dank Bayer's naiver Arbeit, originell und höchst
geschmackvoll wirkt. Das Service wurde um 1776
in Auftrag gegeben und soll anfänglich für die Kai-
serin Katharina IL bestimmt gewesen sein. Ur-
sprünglich auf 80 Gedecke berechnet, sollte es 1797
auf 100 vervollständigt werden. Die bedrängte Lage
der Fabrik veranlasste aber um 1802 die Einstellung
der Arbeit. Im Jahre 1797 fanden sich 2528 fer-
tige Stücke verzeichnet.
Das Service ist dann für
die königliche Tafel in Ge-
brauch genommen worden.
Der Wert desselben war
mit 24 224 Rd. berechnet.
Ursprünglich sollen
noch die von Tvede mo-
dellirten Figuren in den
Volkstrachten aller Län-
der der dänischen Krone
als Beigabe für dieses
Tischzeug bestimmt ge-
wesen sein, doch werden
diese wohl nicht genügt
haben.
Wegen der originellen
Bemalung möge hier auch
das später zu betrachten-
de Moiirad'sche Tischgerät
Erwähnung finden.
Im Ganzen haben selbst
die anspruchsvollsten
Stücke der Fabrik einen
gut bürgerlichen Charak-
ter. Die Tafel- und Frühstücksgeräte, die Vasen
und Potpourris haben etwas sehr behagliches. Die
raffinirte Schönheit der Porzellangebilde aus der
Mitte des Jahrhunderts geht diesen Erzeugnissen
ab, wie sie auch die vornehme Eleganz der fran-
zösischen und deutschen Fabrikate der späteren
Zeit nicht besitzen; von deren feinem Duft ist
hier wenig vorhanden und mit Altmeißen ver-
glichen, erscheinen die Figuren oft plump und
fast barbarisch. Aber es giebt auch unter ihnen
glänzende, ja einzige Arbeiten. Die nach einem Ver-
gleich mit Luplau's sicheren Arbeiten diesem zuge-
schriebenen Figuren der Tänzerin, des Flötenspielers
und anderer sind von feinstem Reiz, würdig eines
Fig. 16.
Moreau und Gravelot, und zu jener Zeit kaum irgend-
wo anders so schön gemacht.
Die Formen haben in dem kurzen Zeiträume von
1776—1800 dreimal gewechselt. Man hatte mit den
von Meißen und Fürstenberg übernommenen Rokoko-
formen begonnen, musste dann zu dem klassizirenden
Stil Ludwig's XVI. übergehen, um kurz darauf den
Empirestil anzunehmen. Die Folgen dieses häufigen
Wechsels machten sich sehr fühlbar: die Muster
wurden namentlich zuletzt immer weniger durchge-
bildet und veralteten, bevor sie eingeführt waren.
Die Klagen darüber hörten nicht auf.
Die Hauptstärke der
Fabrik scheint aber doch
in der Bemalung gelegen
zu haben. Des originellen
Flora - Danica - Musters ist
bereits gedacht worden.
Das Monrad-Service war
so reich dekorirt, dass je-
des Stück sein besonderes
Verzierungsmotiv aufwies.
Bei diesem Tischzeug sind
die Malereien von wunder-
schöner Farbe, namentlich
die Ränder in Königsblau
und Gold. Auch findet
sich hier jenes der Fabrik
eigentümliche und mit ent-
schiedenem Erfolge ge-
pflegte sogen. Atrappen-
dekor. Wenn dieses Mo-
tiv auch nicht als beson-
ders stilvoll angesehen
werden kann, so ist es
doch liebenswürdig, unter-
haltend und von ganz aus-
gezeichnet dekorativer Wirkung. Wo sich in Aus-
stellungen solche Stücke gezeigt haben, sollen sie
vor jeder anderen Bemalung als die frischesten und
lustigsten aufgefallen sein. Übrigens findet sich
dieser Dekor später auch in anderen Fabriken.
Am allgemeinsten ist die Streublumenmalerei
angewandt. Die behagliche und dabei festliche Ver-
zierung erfreute sich ja bei allen Fabriken der glei-
chen Beliebtheit. Bei den in Kopenhagen vor 1780
entstandenen Stücken sind die Streublumen eine
ziemlich ungeschickte Nachahmung der Meißener
Blumen. Erst die Berliner Maler brachten hier Ge-
schmack und Selbständigkeit herein. Die Blumen-
malereien zeigten ein Naturgefühl, das einen Teil
Dame mit Hündchen, angeblich von Luiilau.
(Rosenborg.)
und die einzige Feinheit dieser nach einem Pflanzen-
buche in der Art botanischer Lehrbücher mit Staub-
gefäßen u. s. w. ausgeführten Malereien ist ebenso
bewunderungswürdig, als diese eigentümliche Bema-
lung, dank Bayer's naiver Arbeit, originell und höchst
geschmackvoll wirkt. Das Service wurde um 1776
in Auftrag gegeben und soll anfänglich für die Kai-
serin Katharina IL bestimmt gewesen sein. Ur-
sprünglich auf 80 Gedecke berechnet, sollte es 1797
auf 100 vervollständigt werden. Die bedrängte Lage
der Fabrik veranlasste aber um 1802 die Einstellung
der Arbeit. Im Jahre 1797 fanden sich 2528 fer-
tige Stücke verzeichnet.
Das Service ist dann für
die königliche Tafel in Ge-
brauch genommen worden.
Der Wert desselben war
mit 24 224 Rd. berechnet.
Ursprünglich sollen
noch die von Tvede mo-
dellirten Figuren in den
Volkstrachten aller Län-
der der dänischen Krone
als Beigabe für dieses
Tischzeug bestimmt ge-
wesen sein, doch werden
diese wohl nicht genügt
haben.
Wegen der originellen
Bemalung möge hier auch
das später zu betrachten-
de Moiirad'sche Tischgerät
Erwähnung finden.
Im Ganzen haben selbst
die anspruchsvollsten
Stücke der Fabrik einen
gut bürgerlichen Charak-
ter. Die Tafel- und Frühstücksgeräte, die Vasen
und Potpourris haben etwas sehr behagliches. Die
raffinirte Schönheit der Porzellangebilde aus der
Mitte des Jahrhunderts geht diesen Erzeugnissen
ab, wie sie auch die vornehme Eleganz der fran-
zösischen und deutschen Fabrikate der späteren
Zeit nicht besitzen; von deren feinem Duft ist
hier wenig vorhanden und mit Altmeißen ver-
glichen, erscheinen die Figuren oft plump und
fast barbarisch. Aber es giebt auch unter ihnen
glänzende, ja einzige Arbeiten. Die nach einem Ver-
gleich mit Luplau's sicheren Arbeiten diesem zuge-
schriebenen Figuren der Tänzerin, des Flötenspielers
und anderer sind von feinstem Reiz, würdig eines
Fig. 16.
Moreau und Gravelot, und zu jener Zeit kaum irgend-
wo anders so schön gemacht.
Die Formen haben in dem kurzen Zeiträume von
1776—1800 dreimal gewechselt. Man hatte mit den
von Meißen und Fürstenberg übernommenen Rokoko-
formen begonnen, musste dann zu dem klassizirenden
Stil Ludwig's XVI. übergehen, um kurz darauf den
Empirestil anzunehmen. Die Folgen dieses häufigen
Wechsels machten sich sehr fühlbar: die Muster
wurden namentlich zuletzt immer weniger durchge-
bildet und veralteten, bevor sie eingeführt waren.
Die Klagen darüber hörten nicht auf.
Die Hauptstärke der
Fabrik scheint aber doch
in der Bemalung gelegen
zu haben. Des originellen
Flora - Danica - Musters ist
bereits gedacht worden.
Das Monrad-Service war
so reich dekorirt, dass je-
des Stück sein besonderes
Verzierungsmotiv aufwies.
Bei diesem Tischzeug sind
die Malereien von wunder-
schöner Farbe, namentlich
die Ränder in Königsblau
und Gold. Auch findet
sich hier jenes der Fabrik
eigentümliche und mit ent-
schiedenem Erfolge ge-
pflegte sogen. Atrappen-
dekor. Wenn dieses Mo-
tiv auch nicht als beson-
ders stilvoll angesehen
werden kann, so ist es
doch liebenswürdig, unter-
haltend und von ganz aus-
gezeichnet dekorativer Wirkung. Wo sich in Aus-
stellungen solche Stücke gezeigt haben, sollen sie
vor jeder anderen Bemalung als die frischesten und
lustigsten aufgefallen sein. Übrigens findet sich
dieser Dekor später auch in anderen Fabriken.
Am allgemeinsten ist die Streublumenmalerei
angewandt. Die behagliche und dabei festliche Ver-
zierung erfreute sich ja bei allen Fabriken der glei-
chen Beliebtheit. Bei den in Kopenhagen vor 1780
entstandenen Stücken sind die Streublumen eine
ziemlich ungeschickte Nachahmung der Meißener
Blumen. Erst die Berliner Maler brachten hier Ge-
schmack und Selbständigkeit herein. Die Blumen-
malereien zeigten ein Naturgefühl, das einen Teil
Dame mit Hündchen, angeblich von Luiilau.
(Rosenborg.)