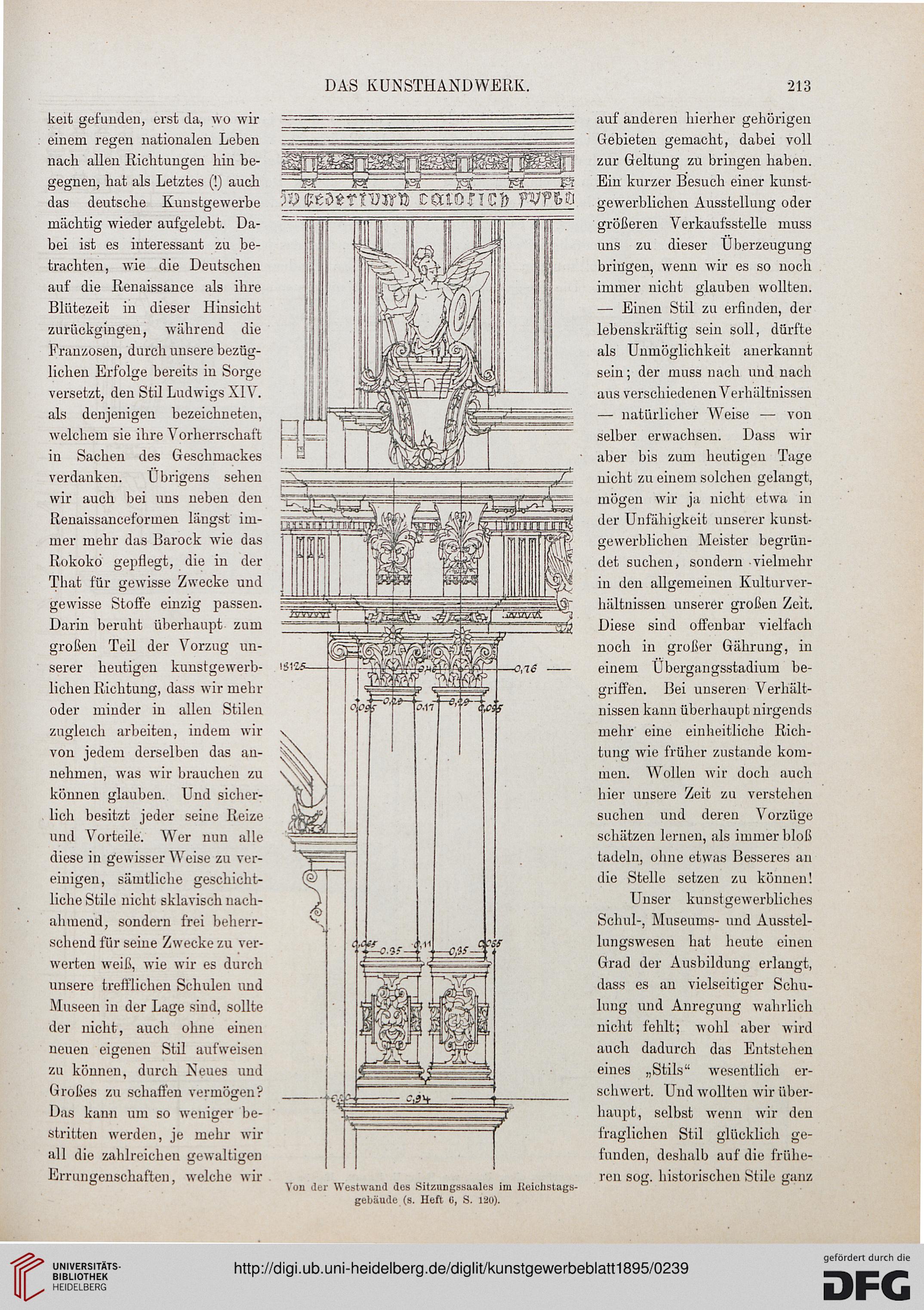DAS KUNSTHAND WERK.
213
keit gefunden, erst da, wo wir
einem regen nationalen Leben
nach allen Richtungen hin be-
gegnen, hat als Letztes (!) auch
das deutsche Kunstgewerbe
mächtig wieder aufgelebt. Da-
bei ist es interessant zu be-
trachten, wie die Deutschen
auf die Renaissance als ihre
Blütezeit in dieser Hinsicht
zurückgingen, während die
Franzosen, durch unsere bezüg-
lichen Erfolge bereits in Sorge
versetzt, den Stil Ludwigs XIV.
als denjenigen bezeichneten,
welchem sie ihre Vorherrschaft
in Sachen des Geschmackes
verdanken. Übrigens sehen
wir auch bei uns neben den
Renaissanceformeu längst im-
mer mehr das Barock wie das
Rokoko gepflegt, die in der
Tliat für gewisse Zwecke und
gewisse Stoffe einzig passen.
Darin beruht überhaupt zum
großen Teil der Vorzug un-
serer heutigen kunstgewerb-
lichen Richtung, dass wir mehr
oder minder in allen Stilen
zugleich arbeiten, indem wir
von jedem derselben das an-
nehmen, was wir brauchen zu
können glauben. Und sicher-
lich besitzt jeder seine Reize
und Vorteile. Wer nun alle
diese in gewisser Weise zu ver-
einigen, sämtliche geschicht-
liche Stile nicht sklavisch nach-
ahmend, sondern frei beherr-
schend für seine Zwecke zu ver-
werten weiß, wie wir es durch
unsere trefflichen Schulen und
Museen in der Lage sind, sollte
der nicht, auch ohne einen
neuen eigenen Stil aufweisen
zu können, durch Neues und
Kroßes zu schaffen vermögen?
Das kann um so weniger be-
stritten werden, je mehr wir
all die zahlreichen gewaltigen
Errungenschaften, welche wir
w~~~"y^" ""'~W &
>y (gg^rnwg) ccttoncp fyp&a
Von der Westwand des Sitzungssaales im Keichstags-
gebäude (s. Heft G, S. ISO).
auf anderen hierher gehörigen
Gebieten gemacht, dabei voll
zur Geltung zu bringen haben.
Ein kurzer Besuch einer kunst-
gewerblichen Ausstellung oder
größeren Verkaufsstelle muss
uns zu dieser Überzeugung
bringen, wenn wir es so noch
immer nicht glauben wollten.
— Einen Stil zu erfinden, der
lebenskräftig sein soll, dürfte
als Unmöglichkeit anerkannt
sein; der muss nach und nach
aus verschiedenen Verhältnissen
— natürlicher Weise — von
selber erwachsen. Dass wir
aber bis zum heutigen Tage
nicht zu einem solchen gelangt,
mögen wir ja nicht etwa in
der Unfähigkeit unserer kunst-
gewerblichen Meister begrün-
det suchen, sondern vielmehr
in den allgemeinen Kulturver-
hältnissen unserer großen Zeit.
Diese sind offenbar vielfach
noch in großer Gährung, in
einem Übergangsstadium be-
griffen. Bei unseren Verhält-
nissen kann überhaupt nirgends
mehr eine einheitliche Rich-
tung wie früher zustande kom-
men. Wollen wir doch auch
hier unsere Zeit zu verstellen
suchen und deren Vorzüge
schätzen lernen, als immer bloß
tadeln, ohne etwas Besseres an
die Stelle setzen zu können!
Unser kunstgewerbliches
Schul-, Museums- und Ausstel-
lungswesen hat heute einen
Grad der Ausbildung erlangt,
dass es an vielseitiger Schu-
lung und Anregung wahrlich
nicht fehlt; wohl aber wird
auch dadurch das Entstehen
eines „Stils" wesentlich er-
schwert. Und wollten wir über-
haupt, selbst wenn wir den
fraglichen Stil glücklich ge-
funden, deshalb auf die frühe-
ren sog. historischen Stile ganz
213
keit gefunden, erst da, wo wir
einem regen nationalen Leben
nach allen Richtungen hin be-
gegnen, hat als Letztes (!) auch
das deutsche Kunstgewerbe
mächtig wieder aufgelebt. Da-
bei ist es interessant zu be-
trachten, wie die Deutschen
auf die Renaissance als ihre
Blütezeit in dieser Hinsicht
zurückgingen, während die
Franzosen, durch unsere bezüg-
lichen Erfolge bereits in Sorge
versetzt, den Stil Ludwigs XIV.
als denjenigen bezeichneten,
welchem sie ihre Vorherrschaft
in Sachen des Geschmackes
verdanken. Übrigens sehen
wir auch bei uns neben den
Renaissanceformeu längst im-
mer mehr das Barock wie das
Rokoko gepflegt, die in der
Tliat für gewisse Zwecke und
gewisse Stoffe einzig passen.
Darin beruht überhaupt zum
großen Teil der Vorzug un-
serer heutigen kunstgewerb-
lichen Richtung, dass wir mehr
oder minder in allen Stilen
zugleich arbeiten, indem wir
von jedem derselben das an-
nehmen, was wir brauchen zu
können glauben. Und sicher-
lich besitzt jeder seine Reize
und Vorteile. Wer nun alle
diese in gewisser Weise zu ver-
einigen, sämtliche geschicht-
liche Stile nicht sklavisch nach-
ahmend, sondern frei beherr-
schend für seine Zwecke zu ver-
werten weiß, wie wir es durch
unsere trefflichen Schulen und
Museen in der Lage sind, sollte
der nicht, auch ohne einen
neuen eigenen Stil aufweisen
zu können, durch Neues und
Kroßes zu schaffen vermögen?
Das kann um so weniger be-
stritten werden, je mehr wir
all die zahlreichen gewaltigen
Errungenschaften, welche wir
w~~~"y^" ""'~W &
>y (gg^rnwg) ccttoncp fyp&a
Von der Westwand des Sitzungssaales im Keichstags-
gebäude (s. Heft G, S. ISO).
auf anderen hierher gehörigen
Gebieten gemacht, dabei voll
zur Geltung zu bringen haben.
Ein kurzer Besuch einer kunst-
gewerblichen Ausstellung oder
größeren Verkaufsstelle muss
uns zu dieser Überzeugung
bringen, wenn wir es so noch
immer nicht glauben wollten.
— Einen Stil zu erfinden, der
lebenskräftig sein soll, dürfte
als Unmöglichkeit anerkannt
sein; der muss nach und nach
aus verschiedenen Verhältnissen
— natürlicher Weise — von
selber erwachsen. Dass wir
aber bis zum heutigen Tage
nicht zu einem solchen gelangt,
mögen wir ja nicht etwa in
der Unfähigkeit unserer kunst-
gewerblichen Meister begrün-
det suchen, sondern vielmehr
in den allgemeinen Kulturver-
hältnissen unserer großen Zeit.
Diese sind offenbar vielfach
noch in großer Gährung, in
einem Übergangsstadium be-
griffen. Bei unseren Verhält-
nissen kann überhaupt nirgends
mehr eine einheitliche Rich-
tung wie früher zustande kom-
men. Wollen wir doch auch
hier unsere Zeit zu verstellen
suchen und deren Vorzüge
schätzen lernen, als immer bloß
tadeln, ohne etwas Besseres an
die Stelle setzen zu können!
Unser kunstgewerbliches
Schul-, Museums- und Ausstel-
lungswesen hat heute einen
Grad der Ausbildung erlangt,
dass es an vielseitiger Schu-
lung und Anregung wahrlich
nicht fehlt; wohl aber wird
auch dadurch das Entstehen
eines „Stils" wesentlich er-
schwert. Und wollten wir über-
haupt, selbst wenn wir den
fraglichen Stil glücklich ge-
funden, deshalb auf die frühe-
ren sog. historischen Stile ganz