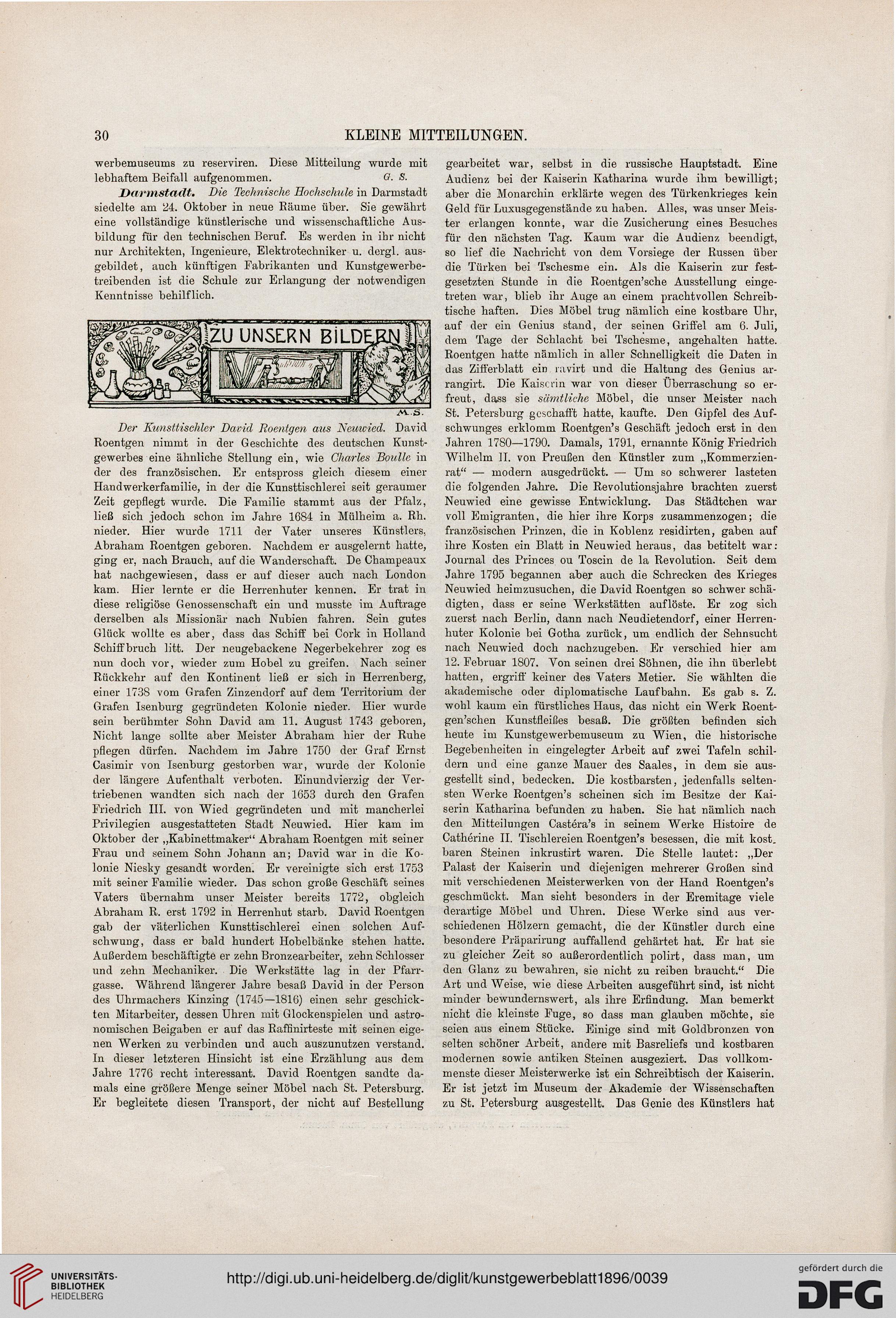30
KLEINE MITTEILUNGEN.
werbemuseums zu reserviren. Diese Mitteilung wurde mit
lebhaftem Beifall aufgenommen. G. S.
Darmstadt. Die Technische Hochschule in Darmstadt
siedelte am 24. Oktober in neue Räume über. Sie gewährt
eine vollständige künstlerische und wissenschaftliehe Aus-
bildung für den technischen Beruf. Es werden in ihr nicht
nur Architekten, Ingenieure, Elektrotechniker u. dergl. aus-
gebildet, auch künftigen Fabrikanten und Kunstgewerbe-
treibenden ist die Schule zur Erlangung der notwendigen
Kenntnisse behilflich.
Der Kunsttischler David Roentgen aus Neuwied. David
Roentgen nimmt in der Geschichte des deutschen Kunst-
gewerbes eine ähnliche Stellung ein, wie Charles Boullc in
der des französischen. Er entspross gleich diesem einer
Handwerkerfamilie, in der die Kunsttischlerei seit geraumer
Zeit gepflegt wurde. Die Familie stammt aus der Pfalz,
ließ sich jedoch schon im Jahre 1684 in Mülheim a. Rh.
nieder. Hier wurde 1711 der Vater unseres Künstlers,
Abraham Roentgen geboren. Nachdem er ausgelernt hatte,
ging er, nach Brauch, auf die Wanderschaft. De Champeaux
hat nachgewiesen, dass er auf dieser auch nach London
kam. Hier lernte er die Herrenhuter kennen. Er trat in
diese religiöse Genossenschaft ein und musste im Auftrage
derselben als Missionär nach Nubien fahren. Sein gutes
Glück wollte es aber, dass das Schiff bei Cork in Holland
Schiffbruch litt. Der neugebackene Negerbekehrer zog es
nun doch vor, wieder zum Hobel zu greifen. Nach seiner
Rückkehr auf den Kontinent ließ er sich in Herrenberg,
einer 1738 vom Grafen Zinzendorf auf dem Territorium der
Grafen Isenburg gegründeten Kolonie nieder. Hier wurde
sein berühmter Sohn David am 11. August 1743 geboren,
Nicht lange sollte aber Meister Abraham hier der Ruhe
pflegen dürfen. Nachdem im Jahre 1750 der Graf Ernst
Casimir von Isenburg gestorben war, wurde der Kolonie
der längere Aufenthalt verboten. Einundvierzig der Ver-
triebenen wandten sich nach der 1653 durch den Grafen
Friedrich III. von Wied gegründeten und mit mancherlei
Privilegien ausgestatteten Stadt Neuwied. Hier kam im
Oktober der „Kabinettmaker" Abraham Roentgen mit seiner
Frau und seinem Sohn Johann an; David war in die Ko-
lonie Niesky gesandt worden. Er vereinigte sich erst 1753
mit seiner Familie wieder. Das schon große Geschäft seines
Vaters übernahm unser Meister bereits 1772, obgleich
Abraham R. erst 1792 in Herrenhut starb. David Roentgen
gab der väterlichen Kunsttischlerei einen solchen Auf-
schwung, dass er bald hundert Hobelbänke stehen hatte.
Außerdom beschäftigte er zehn Bronzearbeiter, zehn Schlosser
und zehn Mechaniker. Die Werkstätte lag in der Pfarr-
gasse. Während längerer Jahre besaß David in der Person
des Uhrmachers Kinzing (1745—1816) einen sehr geschick-
ten Mitarbeiter, dessen Uhren mit Glockenspielen und astro-
nomischen Beigaben er auf das Raffinirteste mit seinen eige-
nen Werken zu verbinden und auch auszunutzen verstand.
In dieser letzteren Hinsicht ist eine Erzählung aus dem
Jahre 1776 recht interessant. David Roentgen sandte da-
mals eine größere Menge seiner Möbel nach St. Petersburg.
Er begleitete diesen Transport, der nicht auf Bestellung
gearbeitet war, selbst in die russische Hauptstadt. Eine
Audienz bei der Kaiserin Katharina wurde ihm bewilligt;
aber die Monarchin erklärte wegen des Türkenkrieges kein
Geld für Luxusgegenstände zu haben. Alles, was unser Meis-
ter erlangen konnte, war die Zusicherung eines Besuches
für den nächsten Tag. Kaum war die Audienz beendigt,
so lief die Nachricht von dem Vorsiege der Russen über
die Türken bei Tschesme ein. Als die Kaiserin zur fest-
gesetzten Stunde in die Roentgen'sche Ausstellung einge-
treten war, blieb ihr Auge an einem prachtvollen Schreib-
tische haften. Dies Möbel trug nämlich eine kostbare Uhr,
auf der ein Genius stand, der seinen Griffel am 6. Juli,
dem Tage der Schlacht bei Tschesme, angehalten hatte.
Roentgen hatte nämlich in aller Schnelligkeit die Daten in
das Zifferblatt ein ravirt und die Haltung des Genius ar-
rangirt. Die Kaiserin war von dieser Überraschung so er-
freut, dass sie sämtliche Möbel, die unser Meister nach
St. Petersburg geschafft hatte, kaufte. Den Gipfel des Auf-
schwunges erklomm Roentgen's Geschäft jedoch erst in den
Jahren 1780—1790. Damals, 1791, ernannte König Friedrich
Wilhelm II. von Preußen den Künstler zum „Kommerzien-
rat" — modern ausgedrückt. — Um so schwerer lasteten
die folgenden Jahre. Die Revolutionsjahre brachten zuerst
Neuwied eine gewisse Entwicklung. Das Städtchen war
voll Emigranten, die hier ihre Korps zusammenzogen; die.
französischen Prinzen, die in Koblenz residirten, gaben auf
ihre Kosten ein Blatt in Neuwied heraus, das betitelt war:
Journal des Princes ou Toscin de la Revolution. Seit dem
Jahre 1795 begannen aber auch die Schrecken des Krieges
Neuwied heimzusuchen, die David Roentgen so schwer schä-
digten, dass er seine Werkstätten auflöste. Er zog sich
zuerst nach Berlin, dann nach Neudietendorf, einer Herren-
huter Kolonie bei Gotha zurück, um endlich der Sehnsucht
nach Neuwied doch nachzugeben. Er verschied hier am
12. Februar 1807. Von seinen drei Söhnen, die ihn überlebt
hatten, ergriff keiner des Vaters Metier. Sie wählten die
akademische oder diplomatische Laufbahn. Es gab s. Z.
wohl kaum ein fürstliches Haus, das nicht ein Werk Roent-
gen'schen Kunstfleißes besaß. Die größten befinden sich
heute im Kunstgewerbemuseum zu Wien, die historische
Begebenheiten in eingelegter Arbeit auf zwei Tafeln schil-
dern und eine ganze Mauer des Saales, in dem sie aus-
gestellt sind, bedecken. Die kostbarsten, jedenfalls selten-
sten Werke Roentgen's scheinen sich im Besitze der Kai-
serin Katharina befunden zu haben. Sie hat nämlich nach
den Mitteilungen Castera's in seinem Werke Histoire de
Catherine II. Tischlereien Roentgen's besessen, die mit kost,
baren Steinen inkrustirt waren. Die Stelle lautet: „Der
Palast der Kaiserin und diejenigen mehrerer Großen sind
mit verschiedenen Meisterwerken von der Hand Roentgen's
geschmückt. Man sieht besonders in der Eremitage viele
derartige Möbel und Uhren. Diese Werke sind aus ver-
schiedenen Hölzern gemacht, die der Künstler durch eine
besondere Präparirung auffallend gehärtet hat. Er hat sie
zu gleicher Zeit so außerordentlich polirt, dass man, um
den Glanz zu bewahren, sie nicht zu reiben braucht." Die
Art und Weise, wie diese Arbeiten ausgeführt sind, ist nicht
minder bewundernswert, als ihre Erfindung. Man bemerkt
nicht die kleinste Fuge, so dass man glauben möchte, sie
seien aus einem Stücke. Einige sind mit Goldbronzen von
selten schöner Arbeit, andere mit Basreliefs und kostbaren
modernen sowie antiken Steinen ausgeziert. Das vollkom-
menste dieser Meisterwerke ist ein Schreibtisch der Kaiserin.
Er ist jetzt im Museum der Akademie der Wissenschaften
zu St. Petersburg ausgestellt. Das Genie des Künstlers hat
KLEINE MITTEILUNGEN.
werbemuseums zu reserviren. Diese Mitteilung wurde mit
lebhaftem Beifall aufgenommen. G. S.
Darmstadt. Die Technische Hochschule in Darmstadt
siedelte am 24. Oktober in neue Räume über. Sie gewährt
eine vollständige künstlerische und wissenschaftliehe Aus-
bildung für den technischen Beruf. Es werden in ihr nicht
nur Architekten, Ingenieure, Elektrotechniker u. dergl. aus-
gebildet, auch künftigen Fabrikanten und Kunstgewerbe-
treibenden ist die Schule zur Erlangung der notwendigen
Kenntnisse behilflich.
Der Kunsttischler David Roentgen aus Neuwied. David
Roentgen nimmt in der Geschichte des deutschen Kunst-
gewerbes eine ähnliche Stellung ein, wie Charles Boullc in
der des französischen. Er entspross gleich diesem einer
Handwerkerfamilie, in der die Kunsttischlerei seit geraumer
Zeit gepflegt wurde. Die Familie stammt aus der Pfalz,
ließ sich jedoch schon im Jahre 1684 in Mülheim a. Rh.
nieder. Hier wurde 1711 der Vater unseres Künstlers,
Abraham Roentgen geboren. Nachdem er ausgelernt hatte,
ging er, nach Brauch, auf die Wanderschaft. De Champeaux
hat nachgewiesen, dass er auf dieser auch nach London
kam. Hier lernte er die Herrenhuter kennen. Er trat in
diese religiöse Genossenschaft ein und musste im Auftrage
derselben als Missionär nach Nubien fahren. Sein gutes
Glück wollte es aber, dass das Schiff bei Cork in Holland
Schiffbruch litt. Der neugebackene Negerbekehrer zog es
nun doch vor, wieder zum Hobel zu greifen. Nach seiner
Rückkehr auf den Kontinent ließ er sich in Herrenberg,
einer 1738 vom Grafen Zinzendorf auf dem Territorium der
Grafen Isenburg gegründeten Kolonie nieder. Hier wurde
sein berühmter Sohn David am 11. August 1743 geboren,
Nicht lange sollte aber Meister Abraham hier der Ruhe
pflegen dürfen. Nachdem im Jahre 1750 der Graf Ernst
Casimir von Isenburg gestorben war, wurde der Kolonie
der längere Aufenthalt verboten. Einundvierzig der Ver-
triebenen wandten sich nach der 1653 durch den Grafen
Friedrich III. von Wied gegründeten und mit mancherlei
Privilegien ausgestatteten Stadt Neuwied. Hier kam im
Oktober der „Kabinettmaker" Abraham Roentgen mit seiner
Frau und seinem Sohn Johann an; David war in die Ko-
lonie Niesky gesandt worden. Er vereinigte sich erst 1753
mit seiner Familie wieder. Das schon große Geschäft seines
Vaters übernahm unser Meister bereits 1772, obgleich
Abraham R. erst 1792 in Herrenhut starb. David Roentgen
gab der väterlichen Kunsttischlerei einen solchen Auf-
schwung, dass er bald hundert Hobelbänke stehen hatte.
Außerdom beschäftigte er zehn Bronzearbeiter, zehn Schlosser
und zehn Mechaniker. Die Werkstätte lag in der Pfarr-
gasse. Während längerer Jahre besaß David in der Person
des Uhrmachers Kinzing (1745—1816) einen sehr geschick-
ten Mitarbeiter, dessen Uhren mit Glockenspielen und astro-
nomischen Beigaben er auf das Raffinirteste mit seinen eige-
nen Werken zu verbinden und auch auszunutzen verstand.
In dieser letzteren Hinsicht ist eine Erzählung aus dem
Jahre 1776 recht interessant. David Roentgen sandte da-
mals eine größere Menge seiner Möbel nach St. Petersburg.
Er begleitete diesen Transport, der nicht auf Bestellung
gearbeitet war, selbst in die russische Hauptstadt. Eine
Audienz bei der Kaiserin Katharina wurde ihm bewilligt;
aber die Monarchin erklärte wegen des Türkenkrieges kein
Geld für Luxusgegenstände zu haben. Alles, was unser Meis-
ter erlangen konnte, war die Zusicherung eines Besuches
für den nächsten Tag. Kaum war die Audienz beendigt,
so lief die Nachricht von dem Vorsiege der Russen über
die Türken bei Tschesme ein. Als die Kaiserin zur fest-
gesetzten Stunde in die Roentgen'sche Ausstellung einge-
treten war, blieb ihr Auge an einem prachtvollen Schreib-
tische haften. Dies Möbel trug nämlich eine kostbare Uhr,
auf der ein Genius stand, der seinen Griffel am 6. Juli,
dem Tage der Schlacht bei Tschesme, angehalten hatte.
Roentgen hatte nämlich in aller Schnelligkeit die Daten in
das Zifferblatt ein ravirt und die Haltung des Genius ar-
rangirt. Die Kaiserin war von dieser Überraschung so er-
freut, dass sie sämtliche Möbel, die unser Meister nach
St. Petersburg geschafft hatte, kaufte. Den Gipfel des Auf-
schwunges erklomm Roentgen's Geschäft jedoch erst in den
Jahren 1780—1790. Damals, 1791, ernannte König Friedrich
Wilhelm II. von Preußen den Künstler zum „Kommerzien-
rat" — modern ausgedrückt. — Um so schwerer lasteten
die folgenden Jahre. Die Revolutionsjahre brachten zuerst
Neuwied eine gewisse Entwicklung. Das Städtchen war
voll Emigranten, die hier ihre Korps zusammenzogen; die.
französischen Prinzen, die in Koblenz residirten, gaben auf
ihre Kosten ein Blatt in Neuwied heraus, das betitelt war:
Journal des Princes ou Toscin de la Revolution. Seit dem
Jahre 1795 begannen aber auch die Schrecken des Krieges
Neuwied heimzusuchen, die David Roentgen so schwer schä-
digten, dass er seine Werkstätten auflöste. Er zog sich
zuerst nach Berlin, dann nach Neudietendorf, einer Herren-
huter Kolonie bei Gotha zurück, um endlich der Sehnsucht
nach Neuwied doch nachzugeben. Er verschied hier am
12. Februar 1807. Von seinen drei Söhnen, die ihn überlebt
hatten, ergriff keiner des Vaters Metier. Sie wählten die
akademische oder diplomatische Laufbahn. Es gab s. Z.
wohl kaum ein fürstliches Haus, das nicht ein Werk Roent-
gen'schen Kunstfleißes besaß. Die größten befinden sich
heute im Kunstgewerbemuseum zu Wien, die historische
Begebenheiten in eingelegter Arbeit auf zwei Tafeln schil-
dern und eine ganze Mauer des Saales, in dem sie aus-
gestellt sind, bedecken. Die kostbarsten, jedenfalls selten-
sten Werke Roentgen's scheinen sich im Besitze der Kai-
serin Katharina befunden zu haben. Sie hat nämlich nach
den Mitteilungen Castera's in seinem Werke Histoire de
Catherine II. Tischlereien Roentgen's besessen, die mit kost,
baren Steinen inkrustirt waren. Die Stelle lautet: „Der
Palast der Kaiserin und diejenigen mehrerer Großen sind
mit verschiedenen Meisterwerken von der Hand Roentgen's
geschmückt. Man sieht besonders in der Eremitage viele
derartige Möbel und Uhren. Diese Werke sind aus ver-
schiedenen Hölzern gemacht, die der Künstler durch eine
besondere Präparirung auffallend gehärtet hat. Er hat sie
zu gleicher Zeit so außerordentlich polirt, dass man, um
den Glanz zu bewahren, sie nicht zu reiben braucht." Die
Art und Weise, wie diese Arbeiten ausgeführt sind, ist nicht
minder bewundernswert, als ihre Erfindung. Man bemerkt
nicht die kleinste Fuge, so dass man glauben möchte, sie
seien aus einem Stücke. Einige sind mit Goldbronzen von
selten schöner Arbeit, andere mit Basreliefs und kostbaren
modernen sowie antiken Steinen ausgeziert. Das vollkom-
menste dieser Meisterwerke ist ein Schreibtisch der Kaiserin.
Er ist jetzt im Museum der Akademie der Wissenschaften
zu St. Petersburg ausgestellt. Das Genie des Künstlers hat