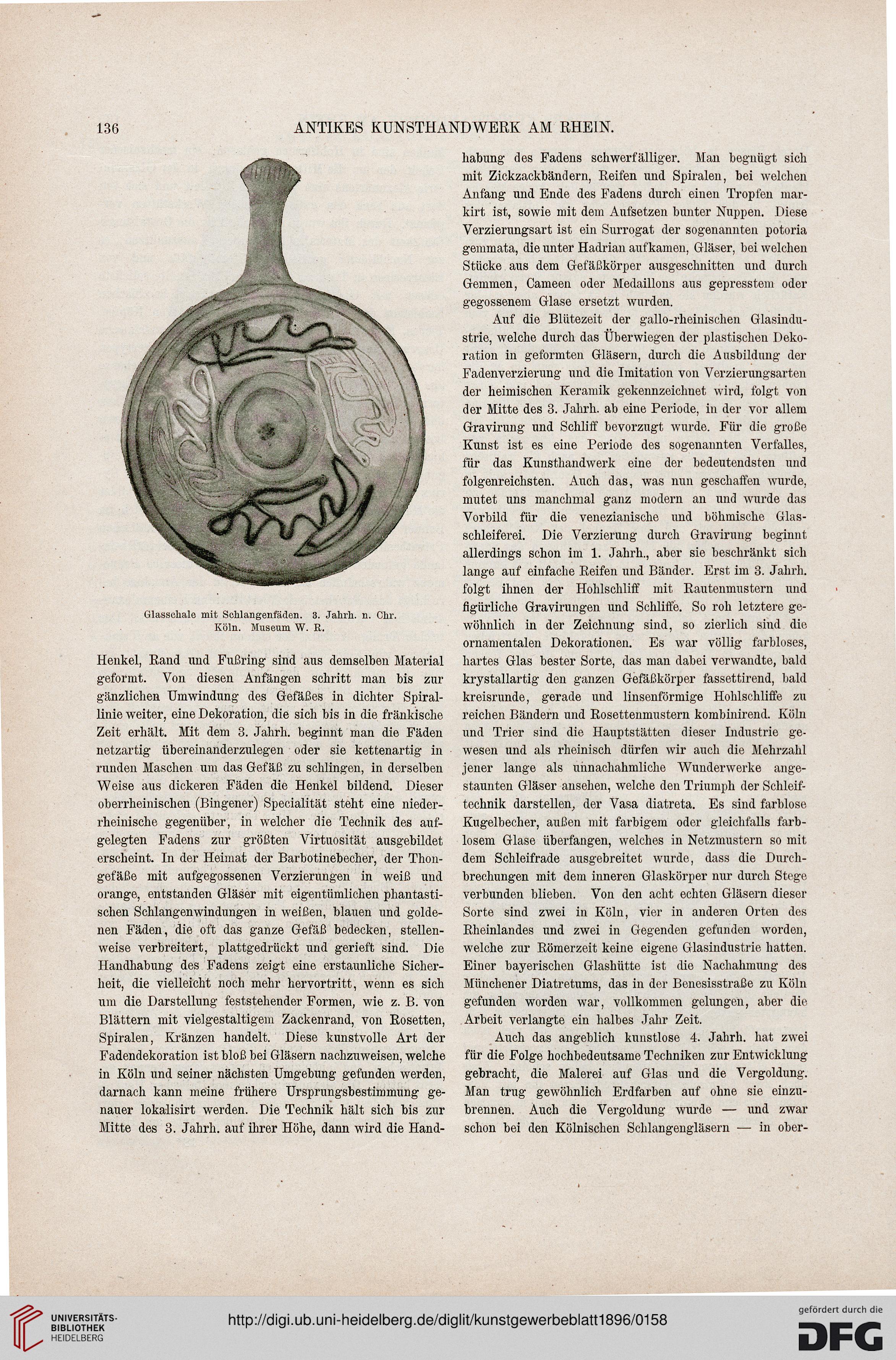136
ANTIKES KÜNSTHANDWERK AM RHEIN.
s&fc«*©*"-^
Glasseliale mit Schlangenfäden. 3. Jahrh. n. Chr.
Köln. Museum W. R.
Henkel, Eand uud Fußring sind aus demselben Material
geformt. Von diesen Anfängen schritt man bis zur
gänzlichen Umwindung des Gefäßes in dichter Spiral-
linie weiter, eine Dekoration, die sich bis in die fränkische
Zeit erhält. Mit dem 3. Jahrh. beginnt man die Fäden
netzartig übereinanderzulegen oder sie kettenartig in
runden Maschen um das Gefäß zu schlingen, in derselben
Weise aus dickeren Fäden die Henkel bildend. Dieser
oberrheinischen (Bingener) Specialität steht eine nieder-
rheinische gegenüber, in welcher die Technik des auf-
gelegten Fadens zur größten Virtuosität ausgebildet
erscheint. In der Heimat der Barbotinebecher, der Thon-
gefäße mit aufgegossenen Verzierungen in weiß und
orange, entstanden Gläser mit eigentümlichen phantasti-
schen Schlangenwindungen in weißen, blauen und golde-
nen Fäden, die oft das ganze Gefäß bedecken, stellen-
weise verbreitert, plattgedrückt und gerieft sind. Die
Handhabung des Fadens zeigt eine erstaunliche Sicher-
heit, die vielleicht noch mehr hervortritt, wenn es sich
um die Darstellung feststehender Formen, wie z. B. von
Blättern mit vielgestaltigem Zackenrand, von Eosetten,
Spiralen, Kränzen handelt. Diese kunstvolle Art der
Fadendekoration ist bloß bei Gläsern nachzuweisen, welche
in Köln und seiner nächsten Umgebung gefunden werden,
darnach kann meine frühere Ursprungsbestimmung ge-
nauer lokalisirt werden. Die Technik hält sich bis zur
Mitte des 3. Jahrh. auf ihrer Höhe, dann wird die Hand-
habung des Fadens schwerfälliger. Man begnügt sich
mit Zickzackbändern, Reifen und Spiralen, bei welchen
Anfang und Ende des Fadens durch einen Tropfen mar-
kirt ist, sowie mit dem Aufsetzen bunter Nuppen. Diese
Verzierungsart ist ein Surrogat der sogenannten potoria
gemmata, die unter Hadrian aufkamen, Gläser, bei welchen
Stücke aus dem Gefäßkörper ausgeschnitten und durch
Gemmen, Cameen oder Medaillons aus gepresstem oder
gegossenem Glase ersetzt wurden.
Auf die Blütezeit der gallo-rheinischen Glasindu-
strie, welche durch das Überwiegen der plastischen Deko-
ration in geformten Gläsern, durch die Ausbildung der
Fadenverzierung und die Imitation von Verzierungsarten
der heimischen Keramik gekennzeichnet wird, folgt von
der Mitte des 3. Jahrh. ab eine Periode, in der vor allem
Gravirung und Schliff bevorzugt wurde. Für die große
Kunst ist es eine Periode des sogenannten Verfalles,
für das Kunsthandwerk eine der bedeutendsten und
folgenreichsten. Auch das, was nun geschaffen wurde,
mutet uns manchmal ganz modern an und wurde das
Vorbild für die venezianische und böhmische tilas-
schleiferei. Die Verzierung durch Gravirung beginnt
allerdings schon im 1. Jahrh., aber sie beschränkt sich
lange auf einfache Keifen und Bänder. Erst im 3. Jahrh.
folgt ihnen der Hohlschliff mit Kautenmustern und
figürliche Gravirungen und Schliffe. So roh letztere ge-
wöhnlich in der Zeichnung sind, so zierlich sind die
ornamentalen Dekorationen. Es war völlig farbloses,
hartes Glas bester Sorte, das man dabei verwandte, bald
krystallartig den ganzen Gefäßkörper fassettirend, bald
kreisrunde, gerade und linsenförmige Hohlschliffe zu
reichen Bändern und Rosettenmustern kombinirend. Köln
und Trier sind die Hauptstätten dieser Industrie ge-
wesen und als rheinisch dürfen wir auch die Mehrzahl
jener lange als unnachahmliche Wunderwerke ange-
staunten Gläser ansehen, welche den Triumph der Schleif-
technik darstellen, der Vasa diatreta. Es sind farblose
Kugelbecher, außen mit farbigem oder gleichfalls farb-
losem Glase überfangen, welches in Netzmustern so mit
dem Schleifrade ausgebreitet wurde, dass die Durch-
brechungen mit dem inneren Glaskörper nur durch Stege
verbunden blieben. Von den acht echten Gläsern dieser
Sorte sind zwei in Köln, vier in anderen Orten des
Kheinlandes und zwei in Gegenden gefunden worden,
welche zur Eömerzeit keine eigene Glasindustrie hatten.
Einer bayerischen Glashütte ist die Nachahmung des
Münchener Diatretums, das in der Benesisstraße zu Köln
gefunden worden war, vollkommen gelungen, aber die
Arbeit verlangte ein halbes Jahr Zeit.
Auch das angeblich kunstlose 4. Jahrh. hat zwei
für die Folge hochbedeutsame Techniken zur Entwicklung
gebracht, die Malerei auf Glas und die Vergoldung.
Man trug gewöhnlich Erdfarben auf ohne sie einzu-
brennen. Auch die Vergoldung wurde — und zwar
schon bei den Kölnischen Schlangengläsern — in ober-
ANTIKES KÜNSTHANDWERK AM RHEIN.
s&fc«*©*"-^
Glasseliale mit Schlangenfäden. 3. Jahrh. n. Chr.
Köln. Museum W. R.
Henkel, Eand uud Fußring sind aus demselben Material
geformt. Von diesen Anfängen schritt man bis zur
gänzlichen Umwindung des Gefäßes in dichter Spiral-
linie weiter, eine Dekoration, die sich bis in die fränkische
Zeit erhält. Mit dem 3. Jahrh. beginnt man die Fäden
netzartig übereinanderzulegen oder sie kettenartig in
runden Maschen um das Gefäß zu schlingen, in derselben
Weise aus dickeren Fäden die Henkel bildend. Dieser
oberrheinischen (Bingener) Specialität steht eine nieder-
rheinische gegenüber, in welcher die Technik des auf-
gelegten Fadens zur größten Virtuosität ausgebildet
erscheint. In der Heimat der Barbotinebecher, der Thon-
gefäße mit aufgegossenen Verzierungen in weiß und
orange, entstanden Gläser mit eigentümlichen phantasti-
schen Schlangenwindungen in weißen, blauen und golde-
nen Fäden, die oft das ganze Gefäß bedecken, stellen-
weise verbreitert, plattgedrückt und gerieft sind. Die
Handhabung des Fadens zeigt eine erstaunliche Sicher-
heit, die vielleicht noch mehr hervortritt, wenn es sich
um die Darstellung feststehender Formen, wie z. B. von
Blättern mit vielgestaltigem Zackenrand, von Eosetten,
Spiralen, Kränzen handelt. Diese kunstvolle Art der
Fadendekoration ist bloß bei Gläsern nachzuweisen, welche
in Köln und seiner nächsten Umgebung gefunden werden,
darnach kann meine frühere Ursprungsbestimmung ge-
nauer lokalisirt werden. Die Technik hält sich bis zur
Mitte des 3. Jahrh. auf ihrer Höhe, dann wird die Hand-
habung des Fadens schwerfälliger. Man begnügt sich
mit Zickzackbändern, Reifen und Spiralen, bei welchen
Anfang und Ende des Fadens durch einen Tropfen mar-
kirt ist, sowie mit dem Aufsetzen bunter Nuppen. Diese
Verzierungsart ist ein Surrogat der sogenannten potoria
gemmata, die unter Hadrian aufkamen, Gläser, bei welchen
Stücke aus dem Gefäßkörper ausgeschnitten und durch
Gemmen, Cameen oder Medaillons aus gepresstem oder
gegossenem Glase ersetzt wurden.
Auf die Blütezeit der gallo-rheinischen Glasindu-
strie, welche durch das Überwiegen der plastischen Deko-
ration in geformten Gläsern, durch die Ausbildung der
Fadenverzierung und die Imitation von Verzierungsarten
der heimischen Keramik gekennzeichnet wird, folgt von
der Mitte des 3. Jahrh. ab eine Periode, in der vor allem
Gravirung und Schliff bevorzugt wurde. Für die große
Kunst ist es eine Periode des sogenannten Verfalles,
für das Kunsthandwerk eine der bedeutendsten und
folgenreichsten. Auch das, was nun geschaffen wurde,
mutet uns manchmal ganz modern an und wurde das
Vorbild für die venezianische und böhmische tilas-
schleiferei. Die Verzierung durch Gravirung beginnt
allerdings schon im 1. Jahrh., aber sie beschränkt sich
lange auf einfache Keifen und Bänder. Erst im 3. Jahrh.
folgt ihnen der Hohlschliff mit Kautenmustern und
figürliche Gravirungen und Schliffe. So roh letztere ge-
wöhnlich in der Zeichnung sind, so zierlich sind die
ornamentalen Dekorationen. Es war völlig farbloses,
hartes Glas bester Sorte, das man dabei verwandte, bald
krystallartig den ganzen Gefäßkörper fassettirend, bald
kreisrunde, gerade und linsenförmige Hohlschliffe zu
reichen Bändern und Rosettenmustern kombinirend. Köln
und Trier sind die Hauptstätten dieser Industrie ge-
wesen und als rheinisch dürfen wir auch die Mehrzahl
jener lange als unnachahmliche Wunderwerke ange-
staunten Gläser ansehen, welche den Triumph der Schleif-
technik darstellen, der Vasa diatreta. Es sind farblose
Kugelbecher, außen mit farbigem oder gleichfalls farb-
losem Glase überfangen, welches in Netzmustern so mit
dem Schleifrade ausgebreitet wurde, dass die Durch-
brechungen mit dem inneren Glaskörper nur durch Stege
verbunden blieben. Von den acht echten Gläsern dieser
Sorte sind zwei in Köln, vier in anderen Orten des
Kheinlandes und zwei in Gegenden gefunden worden,
welche zur Eömerzeit keine eigene Glasindustrie hatten.
Einer bayerischen Glashütte ist die Nachahmung des
Münchener Diatretums, das in der Benesisstraße zu Köln
gefunden worden war, vollkommen gelungen, aber die
Arbeit verlangte ein halbes Jahr Zeit.
Auch das angeblich kunstlose 4. Jahrh. hat zwei
für die Folge hochbedeutsame Techniken zur Entwicklung
gebracht, die Malerei auf Glas und die Vergoldung.
Man trug gewöhnlich Erdfarben auf ohne sie einzu-
brennen. Auch die Vergoldung wurde — und zwar
schon bei den Kölnischen Schlangengläsern — in ober-