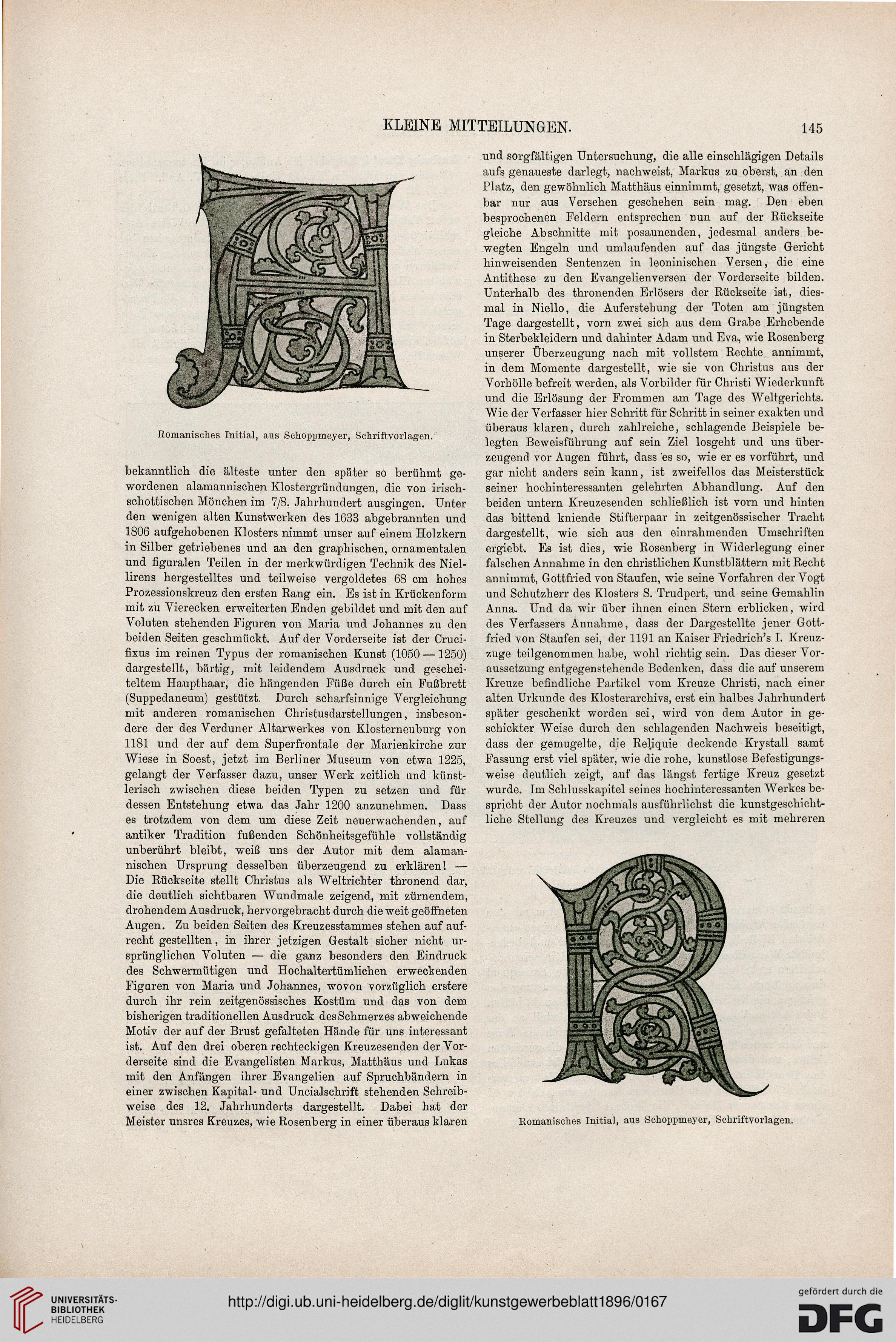KLEINE MITTEILUNGEN.
145
Romanisches Initial, aus Schoppmeyer, Schriftvorlagen.
bekanntlich die älteste unter den später so berühmt ge-
wordenen alamannischen Klostergründungen, die von irisch-
schottischen Mönchen im 7/8. Jahrhundert ausgingen. Unter
den wenigen alten Kunstwerken des 1633 abgebrannten und
1806 aufgehobenen Klosters nimmt unser auf einem Holzkern
in Silber getriebenes und an den graphischen, ornamentalen
und figuralen Teilen in der merkwürdigen Technik des Niel-
lirens hergestelltes und teilweise vergoldetes 68 cm hohes
Prozessionskreuz den ersten Rang ein. Es ist in Krückenform
mit zu Vierecken erweiterten Enden gebildet und mit den auf
Voluten stehenden Figuren von Maria und Johannes zu den
beiden Seiten geschmückt. Auf der Vorderseite ist der Cruci-
fixus im reinen Typus der romanischen Kunst (1050—1250)
dargestellt, bärtig, mit leidendem Ausdruck und geschei-
teltem Haupthaar, die hängenden Füße durch ein Fußbrett
(Suppedaneum) gestützt. Durch scharfsinnige Vergleichung
mit anderen romanischen Christusdarstellungen, insbeson-
dere der des Verduner Altarwerkes von Klosterneuburg von
1181 und der auf dem Superfrontale der Marienkirche zur
Wiese in Soest, jetzt im Berliner Museum von etwa 1225,
gelangt der Verfasser dazu, unser Werk zeitlich und künst-
lerisch zwischen diese beiden Typen zu setzen und für
dessen Entstehung etwa das Jahr 1200 anzunehmen. Dass
es trotzdem von dem um diese Zeit neuerwachenden, auf
antiker Tradition fußenden Schönheitsgefühle vollständig
unberührt bleibt, weiß uns der Autor mit dem alaman-
nischen Ursprung desselben überzeugend zu erklären! —
Die Rückseite stellt Christus als Weltrichter thronend dar,
die deutlich sichtbaren Wundmale zeigend, mit zürnendem,
drohendem Ausdruck, hervorgebracht durch die weit geöffneten
Augen. Zu beiden Seiten des Kreuzesstammes stehen auf auf-
recht gestellten, in ihrer jetzigen Gestalt sicher nicht ur-
sprünglichen Voluten — die ganz besonders den Eindruck
des Schwermütigen und Hochaltertümlichen erweckenden
Figuren von Maria und Johannes, wovon vorzüglich erstere
durch ihr rein zeitgenössisches Kostüm und das von dem
bisherigen traditionellen Ausdruck des Schmerzes abweichende
Motiv der auf der Brust gefalteten Hände für uns interessant
ist. Auf den drei oberen rechteckigen Kreuzesenden der Vor-
derseite sind die Evangelisten Markus, Matthäus und Lukas
mit den Anfängen ihrer Evangelien auf Spruchbändern in
einer zwischen Kapital- und Uncialschrift stehenden Schreib-
weise des 12. Jahrhunderts dargestellt. Dabei hat der
Meister unsres Kreuzes, wie Rosenberg in einer überaus klaren
und sorgfältigen Untersuchung, die alle einschlägigen Details
aufs genaueste darlegt, nachweist, Markus zu oberst, an den
Platz, den gewöhnlich Matthäus einnimmt, gesetzt, was offen-
bar nur aus Versehen geschehen sein mag. Den eben
besprochenen Feldern entsprechen nun auf der Rückseite
gleiche Abschnitte mit posaunenden, jedesmal anders be-
wegten Engeln und umlaufenden auf das jüngste Gericht
hinweisenden Sentenzen in leoninischen Versen, die eine
Antithese zu den Evangelienversen der Vorderseite bilden.
Unterhalb des thronenden Erlösers der Rückseite ißt, dies-
mal in Niello, die Auferstehung der Toten am jüngsten
Tage dargestellt, vorn zwei sich aus dem Grabe Erhebende
in Sterbekleidern und dahinter Adam und Eva, wie Rosenberg
unserer Überzeugung nach mit vollstem Rechte annimmt,
in dem Momente dargestellt, wie sie von Christus aus der
Vorhölle befreit werden, als Vorbilder für Christi Wiederkunft
und die Erlösung der Frommen am Tage des Weltgerichts.
Wie der Verfasser hier Schritt für Schritt in seiner exakten und
überaus klaren, durch zahlreiche, schlagende Beispiele be-
legten Beweisführung auf sein Ziel losgeht und uns über-
zeugend vor Augen führt, dass 'es so, wie er es vorführt, und
gar nicht anders sein kann, ist zweifellos das Meisterstück
seiner hochinteressanten gelehrten Abhandlung. Auf den
beiden untern Kreuzesenden schließlich ist vorn und hinten
das bittend kniende Stifterpaar in zeitgenössischer Tracht
dargestellt, wie sich aus den einrahmenden Umschriften
ergiebt. Es ist dies, wie Rosenberg in Widerlegung einer
falschen Annahme in den christlichen Kunstblättern mit Recht
annimmt, Gottfried von Staufen, wie seine Vorfahren der Vogt
und Schutzherr des Klosters S. Trudpert, und seine Gemahlin
Anna. Und da wir über ihnen einen Stern erblicken, wird
des Verfassers Annahme, dass der Dargestellte jener Gott-
fried von Staufen sei, der 1191 an Kaiser Friedrich's I. Kreuz-
zuge teilgenommen habe, wohl richtig sein. Das dieser Vor-
aussetzung entgegenstehende Bedenken, dass die auf unserem
Kreuze befindliche Partikel vom Kreuze Christi, nach einer
alten Urkunde des Klosterarchivs, erst ein halbes Jahrhundert
später geschenkt worden sei, wird von dem Autor in ge-
schickter Weise durch den schlagenden Nachweis beseitigt,
dass der gemugelte, die Reliquie deckende Krystall samt
Fassung erst viel später, wie die rohe, kunstlose Befestigungs-
weise deutlich zeigt, auf das längst fertige Kreuz gesetzt
wurde. Im Schlusskapitel seines hochinteressanten Werkes be-
spricht der Autor nochmals ausführlichst die kunstgeschicht-
liche Stellung des Kreuzes und vergleicht es mit mehreren
Romanisches Initial, aus Schoppmeyer, Schriftvorlagen.
145
Romanisches Initial, aus Schoppmeyer, Schriftvorlagen.
bekanntlich die älteste unter den später so berühmt ge-
wordenen alamannischen Klostergründungen, die von irisch-
schottischen Mönchen im 7/8. Jahrhundert ausgingen. Unter
den wenigen alten Kunstwerken des 1633 abgebrannten und
1806 aufgehobenen Klosters nimmt unser auf einem Holzkern
in Silber getriebenes und an den graphischen, ornamentalen
und figuralen Teilen in der merkwürdigen Technik des Niel-
lirens hergestelltes und teilweise vergoldetes 68 cm hohes
Prozessionskreuz den ersten Rang ein. Es ist in Krückenform
mit zu Vierecken erweiterten Enden gebildet und mit den auf
Voluten stehenden Figuren von Maria und Johannes zu den
beiden Seiten geschmückt. Auf der Vorderseite ist der Cruci-
fixus im reinen Typus der romanischen Kunst (1050—1250)
dargestellt, bärtig, mit leidendem Ausdruck und geschei-
teltem Haupthaar, die hängenden Füße durch ein Fußbrett
(Suppedaneum) gestützt. Durch scharfsinnige Vergleichung
mit anderen romanischen Christusdarstellungen, insbeson-
dere der des Verduner Altarwerkes von Klosterneuburg von
1181 und der auf dem Superfrontale der Marienkirche zur
Wiese in Soest, jetzt im Berliner Museum von etwa 1225,
gelangt der Verfasser dazu, unser Werk zeitlich und künst-
lerisch zwischen diese beiden Typen zu setzen und für
dessen Entstehung etwa das Jahr 1200 anzunehmen. Dass
es trotzdem von dem um diese Zeit neuerwachenden, auf
antiker Tradition fußenden Schönheitsgefühle vollständig
unberührt bleibt, weiß uns der Autor mit dem alaman-
nischen Ursprung desselben überzeugend zu erklären! —
Die Rückseite stellt Christus als Weltrichter thronend dar,
die deutlich sichtbaren Wundmale zeigend, mit zürnendem,
drohendem Ausdruck, hervorgebracht durch die weit geöffneten
Augen. Zu beiden Seiten des Kreuzesstammes stehen auf auf-
recht gestellten, in ihrer jetzigen Gestalt sicher nicht ur-
sprünglichen Voluten — die ganz besonders den Eindruck
des Schwermütigen und Hochaltertümlichen erweckenden
Figuren von Maria und Johannes, wovon vorzüglich erstere
durch ihr rein zeitgenössisches Kostüm und das von dem
bisherigen traditionellen Ausdruck des Schmerzes abweichende
Motiv der auf der Brust gefalteten Hände für uns interessant
ist. Auf den drei oberen rechteckigen Kreuzesenden der Vor-
derseite sind die Evangelisten Markus, Matthäus und Lukas
mit den Anfängen ihrer Evangelien auf Spruchbändern in
einer zwischen Kapital- und Uncialschrift stehenden Schreib-
weise des 12. Jahrhunderts dargestellt. Dabei hat der
Meister unsres Kreuzes, wie Rosenberg in einer überaus klaren
und sorgfältigen Untersuchung, die alle einschlägigen Details
aufs genaueste darlegt, nachweist, Markus zu oberst, an den
Platz, den gewöhnlich Matthäus einnimmt, gesetzt, was offen-
bar nur aus Versehen geschehen sein mag. Den eben
besprochenen Feldern entsprechen nun auf der Rückseite
gleiche Abschnitte mit posaunenden, jedesmal anders be-
wegten Engeln und umlaufenden auf das jüngste Gericht
hinweisenden Sentenzen in leoninischen Versen, die eine
Antithese zu den Evangelienversen der Vorderseite bilden.
Unterhalb des thronenden Erlösers der Rückseite ißt, dies-
mal in Niello, die Auferstehung der Toten am jüngsten
Tage dargestellt, vorn zwei sich aus dem Grabe Erhebende
in Sterbekleidern und dahinter Adam und Eva, wie Rosenberg
unserer Überzeugung nach mit vollstem Rechte annimmt,
in dem Momente dargestellt, wie sie von Christus aus der
Vorhölle befreit werden, als Vorbilder für Christi Wiederkunft
und die Erlösung der Frommen am Tage des Weltgerichts.
Wie der Verfasser hier Schritt für Schritt in seiner exakten und
überaus klaren, durch zahlreiche, schlagende Beispiele be-
legten Beweisführung auf sein Ziel losgeht und uns über-
zeugend vor Augen führt, dass 'es so, wie er es vorführt, und
gar nicht anders sein kann, ist zweifellos das Meisterstück
seiner hochinteressanten gelehrten Abhandlung. Auf den
beiden untern Kreuzesenden schließlich ist vorn und hinten
das bittend kniende Stifterpaar in zeitgenössischer Tracht
dargestellt, wie sich aus den einrahmenden Umschriften
ergiebt. Es ist dies, wie Rosenberg in Widerlegung einer
falschen Annahme in den christlichen Kunstblättern mit Recht
annimmt, Gottfried von Staufen, wie seine Vorfahren der Vogt
und Schutzherr des Klosters S. Trudpert, und seine Gemahlin
Anna. Und da wir über ihnen einen Stern erblicken, wird
des Verfassers Annahme, dass der Dargestellte jener Gott-
fried von Staufen sei, der 1191 an Kaiser Friedrich's I. Kreuz-
zuge teilgenommen habe, wohl richtig sein. Das dieser Vor-
aussetzung entgegenstehende Bedenken, dass die auf unserem
Kreuze befindliche Partikel vom Kreuze Christi, nach einer
alten Urkunde des Klosterarchivs, erst ein halbes Jahrhundert
später geschenkt worden sei, wird von dem Autor in ge-
schickter Weise durch den schlagenden Nachweis beseitigt,
dass der gemugelte, die Reliquie deckende Krystall samt
Fassung erst viel später, wie die rohe, kunstlose Befestigungs-
weise deutlich zeigt, auf das längst fertige Kreuz gesetzt
wurde. Im Schlusskapitel seines hochinteressanten Werkes be-
spricht der Autor nochmals ausführlichst die kunstgeschicht-
liche Stellung des Kreuzes und vergleicht es mit mehreren
Romanisches Initial, aus Schoppmeyer, Schriftvorlagen.