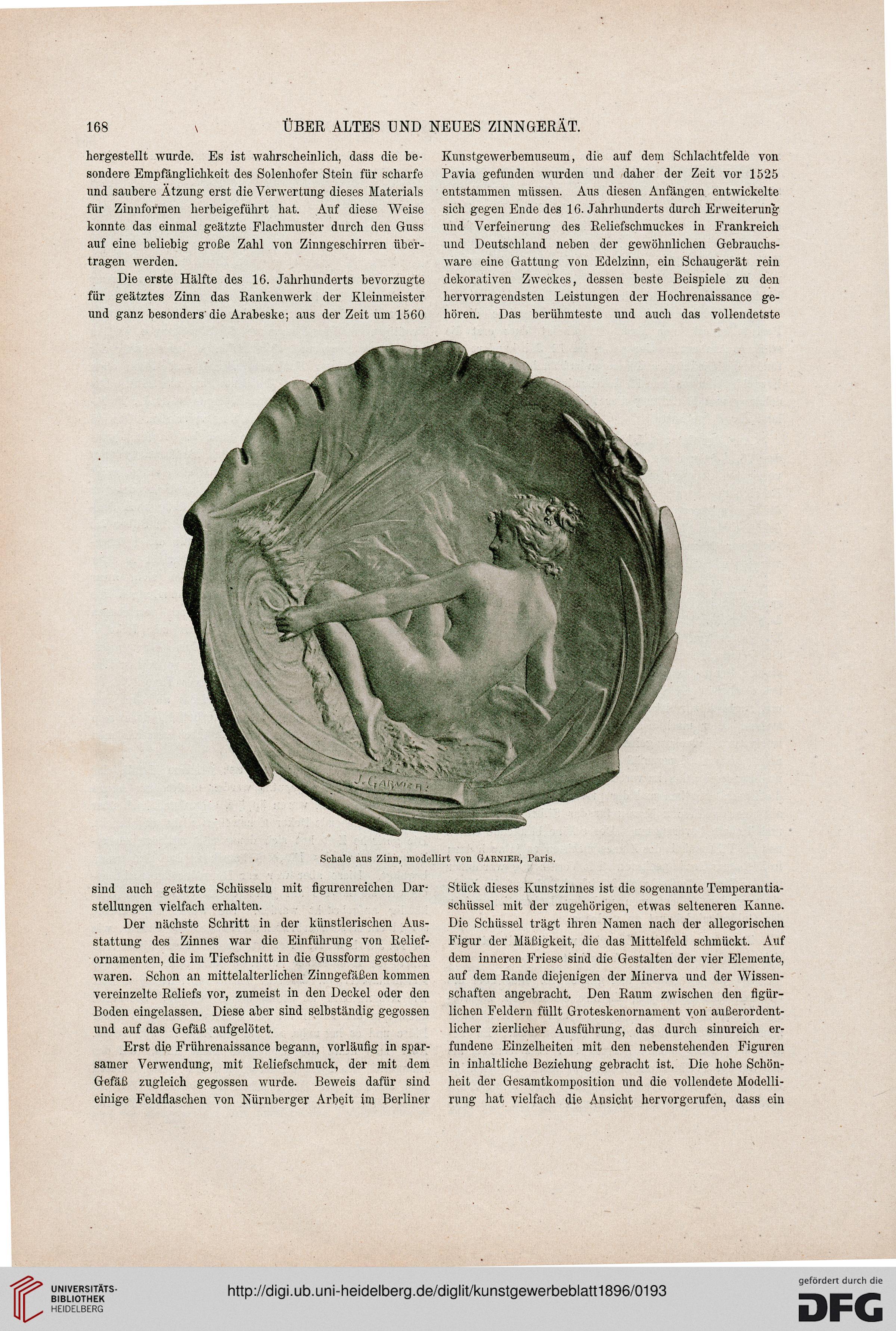168
ÜBER ALTES UND NEUES ZINN GERÄT.
hergestellt wurde. Es ist wahrscheinlich, dass die be-
sondere Empfänglichkeit des Solenhofer Stein für scharfe
und saubere Ätzung erst die Verwertung dieses Materials
für Zinnforraen herbeigeführt hat. Auf diese Weise
konnte das einmal geätzte Flachmuster durch den Guss
auf eine beliebig große Zahl von Zinngeschirren über-
tragen werden.
Die erste Hälfte des 16. Jahrhunderts bevorzugte
für geätztes Zinn das Eankenwerk der Kiemmeister
und ganz besonders'die Arabeske; aus der Zeit um 1560
Kunstgewerbemuseum, die auf dem Schlachtfelde von
Pavia gefunden wurden und daher der Zeit vor 1525
entstammen müssen. Aus diesen Anfängen entwickelte
sich gegen Ende des 16. Jahrhunderts durch Erweiterung
und Verfeinerung des Keliefschmuckes in Frankreich
und Deutschland neben der gewöhnlichen Gebrauchs-
ware eine Gattung von Edelzinn, ein Schaugerät rein
dekorativen Zweckes, dessen beste Beispiele zu den
hervorragendsten Leistungen der Hochrenaissance ge-
hören. Das berühmteste und auch das vollendetste
Schale aus Zinn, modellirt von Garnier, Paris.
sind auch geätzte Schüsseln mit figurenreichen Dar-
stellungen vielfach erhalten.
Der nächste Schritt in der künstlerischen Aus-
stattung des Zinnes war die Einführung von Eelief-
ornamenten, die im Tiefschnitt in die Gussform gestochen
waren. Schon an mittelalterlichen Zinngefäßen kommen
vereinzelte Keliefs vor, zumeist in den Deckel oder den
Boden eingelassen. Diese aber sind selbständig gegossen
und auf das Gefäß aufgelötet.
Erst die Frührenaissance begann, vorläufig in spar-
samer Verwendung, mit Keliefschmuck, der mit dem
Gefäß zugleich gegossen wurde. Beweis dafür sind
einige Feldflaschen von Nürnberger Arbeit im Berliner
Stück dieses Kunstzinnes ist die sogenannte Temperautia-
schüssel mit der zugehörigen, etwas selteneren Kanne.
Die Schüssel trägt ihren Namen nach der allegorischen
Figur der Mäßigkeit, die das Mittelfeld schmückt. Auf
dem inneren Friese sind die Gestalten der vier Elemente,
auf dem Kande diejenigen der Minerva und der Wissen-
schaften angebracht. Den Kaum zwischen den figür-
lichen Feldern füllt Groteskenornament von außerordent-
licher zierlicher Ausführung, das durch sinnreich er-
fundene Einzelheiten mit den nebenstehenden Figuren
in inhaltliche Beziehung gebracht ist. Die hohe Schön-
heit der Gesamtkomposition und die vollendete Modelli-
rung hat vielfach die Ansicht hervorgerufen, dass ein
ÜBER ALTES UND NEUES ZINN GERÄT.
hergestellt wurde. Es ist wahrscheinlich, dass die be-
sondere Empfänglichkeit des Solenhofer Stein für scharfe
und saubere Ätzung erst die Verwertung dieses Materials
für Zinnforraen herbeigeführt hat. Auf diese Weise
konnte das einmal geätzte Flachmuster durch den Guss
auf eine beliebig große Zahl von Zinngeschirren über-
tragen werden.
Die erste Hälfte des 16. Jahrhunderts bevorzugte
für geätztes Zinn das Eankenwerk der Kiemmeister
und ganz besonders'die Arabeske; aus der Zeit um 1560
Kunstgewerbemuseum, die auf dem Schlachtfelde von
Pavia gefunden wurden und daher der Zeit vor 1525
entstammen müssen. Aus diesen Anfängen entwickelte
sich gegen Ende des 16. Jahrhunderts durch Erweiterung
und Verfeinerung des Keliefschmuckes in Frankreich
und Deutschland neben der gewöhnlichen Gebrauchs-
ware eine Gattung von Edelzinn, ein Schaugerät rein
dekorativen Zweckes, dessen beste Beispiele zu den
hervorragendsten Leistungen der Hochrenaissance ge-
hören. Das berühmteste und auch das vollendetste
Schale aus Zinn, modellirt von Garnier, Paris.
sind auch geätzte Schüsseln mit figurenreichen Dar-
stellungen vielfach erhalten.
Der nächste Schritt in der künstlerischen Aus-
stattung des Zinnes war die Einführung von Eelief-
ornamenten, die im Tiefschnitt in die Gussform gestochen
waren. Schon an mittelalterlichen Zinngefäßen kommen
vereinzelte Keliefs vor, zumeist in den Deckel oder den
Boden eingelassen. Diese aber sind selbständig gegossen
und auf das Gefäß aufgelötet.
Erst die Frührenaissance begann, vorläufig in spar-
samer Verwendung, mit Keliefschmuck, der mit dem
Gefäß zugleich gegossen wurde. Beweis dafür sind
einige Feldflaschen von Nürnberger Arbeit im Berliner
Stück dieses Kunstzinnes ist die sogenannte Temperautia-
schüssel mit der zugehörigen, etwas selteneren Kanne.
Die Schüssel trägt ihren Namen nach der allegorischen
Figur der Mäßigkeit, die das Mittelfeld schmückt. Auf
dem inneren Friese sind die Gestalten der vier Elemente,
auf dem Kande diejenigen der Minerva und der Wissen-
schaften angebracht. Den Kaum zwischen den figür-
lichen Feldern füllt Groteskenornament von außerordent-
licher zierlicher Ausführung, das durch sinnreich er-
fundene Einzelheiten mit den nebenstehenden Figuren
in inhaltliche Beziehung gebracht ist. Die hohe Schön-
heit der Gesamtkomposition und die vollendete Modelli-
rung hat vielfach die Ansicht hervorgerufen, dass ein