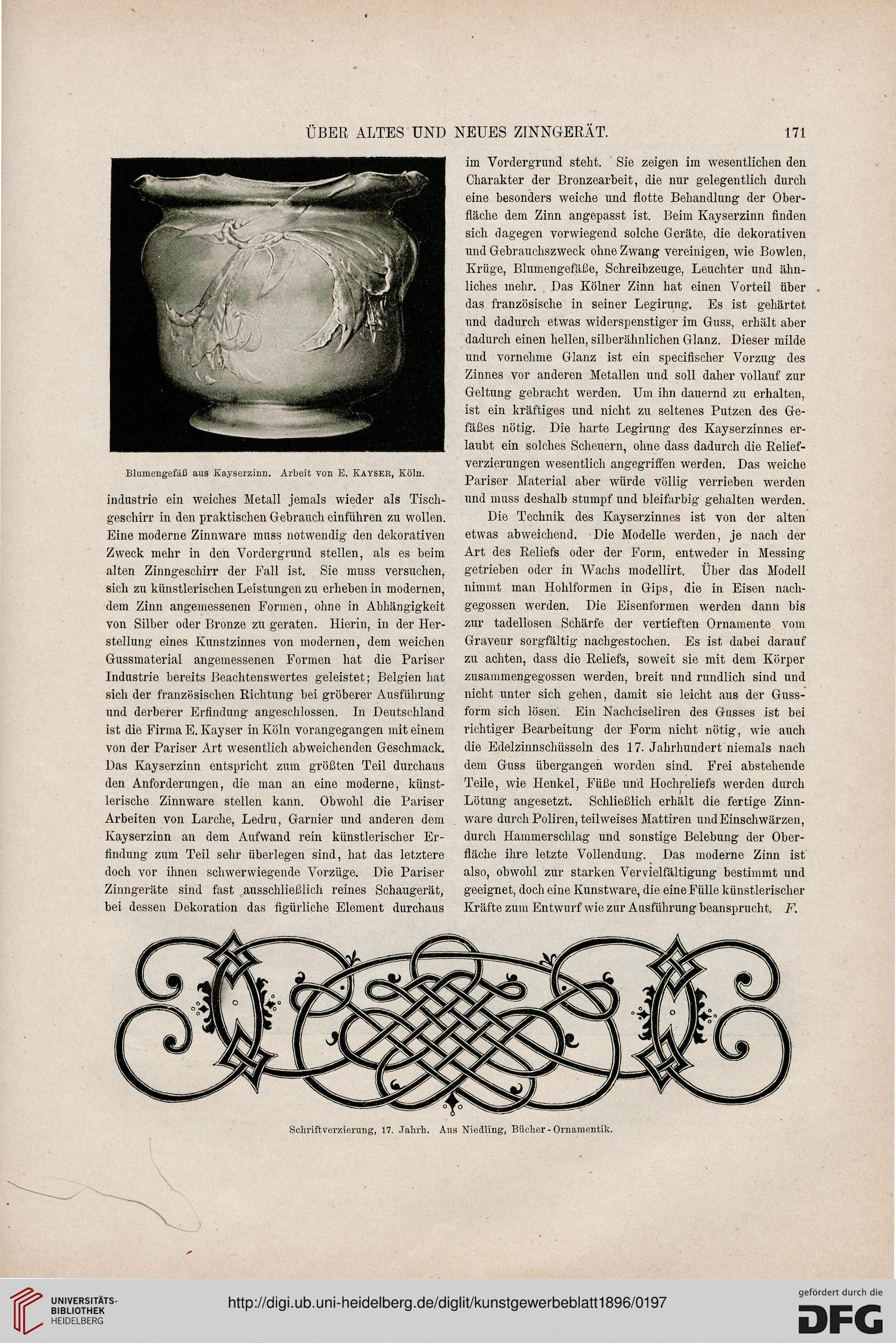ÜBER ALTES UND NEUES ZINNGERÄT.
171
Blumengefäß aus Kayserzinn. Arbeit von E. Kaysee, Köln.
Industrie ein weiches Metall jemals wieder als Tisch-
geschirr in den praktischen Gebranch einführen zu wollen.
Eine moderne Zinnware miiss notwendig den dekorativen
Zweck mehr in den Vordergrund stellen, als es beim
alten Zinngeschirr der Fall ist. Sie muss versuchen,
sich zu künstlerischen Leistungen zu erheben in modernen,
dem Zinn angemessenen Formen, ohne in Abhängigkeit
von Silber oder Bronze zu geraten. Hierin, in der Her-
stellung eines Kunstzinnes von modernen, dem weichen
Gussmaterial angemessenen Formen hat die Pariser
Industrie bereits Beachtenswertes geleistet; Belgien hat
sich der französischen Richtung bei gröberer Ausführung
und derberer Erfindung angeschlossen. In Deutschland
ist die Firma E. Kayser in Köln vorangegangen mit einem
von der Pariser Art wesentlich abweichenden Geschmack.
Bas Kayserzinn entspricht zum größten Teil durchaus
den Anforderungen, die man an eine moderne, künst-
lerische Zinnware stellen kann. Obwohl die Pariser
Arbeiten von Lärche, Ledru, Garnier und anderen dem
Kayserzinn an dem Aufwand rein künstlerischer Er-
findung zum Teil sehr überlegen sind, hat das letztere
doch vor ihnen schwerwiegende Vorzüge. Die Pariser
Zinngeräte sind fast ausschließlich reines Schaugerät,
bei dessen Dekoration das figürliche Element durchaus
im Vordergrund steht. Sie zeigen im wesentlichen den
Charakter der Bronzearbeit, die nur gelegentlich durch
eine besonders weiche und flotte Behandlung der Ober-
fläche dem Zinn angepasst ist. Beim Kayserzinn finden
sich dagegen vorwiegend solche Geräte, die dekorativen
und Gebrauchszweck ohne Zwang vereinigen, wie Bowlen,
Krüge, Blumengefäße, Schreibzeuge, Leuchter und ähn-
liches mehr. . Das Kölner Zinn hat einen Vorteil über
das französische in seiner Legirung. Es ist gehärtet
und dadurch etwas widerspenstiger im Guss, erhält aber
dadurch einen hellen, silberähnlichen Glanz. Dieser milde
und vornehme Glanz ist ein specifischer Vorzug des
Zinnes vor anderen Metallen und soll daher vollauf zur
Geltung gebracht werden. Um ihn dauernd zu erhalten,
ist ein kräftiges und nicht zu seltenes Putzen des Ge-
fäßes nötig. Die harte Legirung des Kayserzinnes er-
laubt ein solches Scheuern, ohne dass dadurch die Relief-
verzierungen wesentlich angegriffen werden. Das weiche
Pariser Material aber würde völlig verrieben werden
und muss deshalb stumpf und bleifarbig gehalten werden.
Die Technik des Kayserzinnes ist von der alten
etwas abweichend. Die Modelle werden, je nach der
Art des Reliefs oder der Form, entweder in Messing
getrieben oder in Wachs modellirt. Über das Modell
nimmt man Hohlformen in Gips, die in Eisen nach-
gegossen werden. Die Eisenformen werden dann bis
zur tadellosen Schärfe der vertieften Ornamente vom
Graveur sorgfältig nachgestochen. Es ist dabei darauf
zu achten, dass die Reliefs, soweit sie mit dem Körper
zusammengegossen werden, breit und rundlich sind und
nicht unter sich gehen, damit sie leicht aus der Guss-
form sich lösen. Ein Nacheiseliren des Gusses ist bei
richtiger Bearbeitung der Form nicht nötig, wie auch
die Edelzinnschüsseln des 17. Jahrhundert niemals nach
dem Guss übergangen worden sind. Frei abstehende
Teile, wie Henkel, Füße und Hochreliefs werden durch
Lötung angesetzt. Schließlich erhält die fertige Zinn-
ware durch Poliren, teilweises Mattiren und Einschwärzen,
durch Hammerschlag und sonstige Belebung der Ober-
fläche ihre letzte Vollendung. Das moderne Zinn ist
also, obwohl zur starken Vervielfältigung bestimmt und
geeignet, doch eine Kunstware, die eine Fülle künstlerischer
Kräfte zum Entwurf wie zur Ausführung beansprucht. F.
Schriftverzierang, 17. Jahrh. Aus Niedling, Bücher-Ornamentik.
171
Blumengefäß aus Kayserzinn. Arbeit von E. Kaysee, Köln.
Industrie ein weiches Metall jemals wieder als Tisch-
geschirr in den praktischen Gebranch einführen zu wollen.
Eine moderne Zinnware miiss notwendig den dekorativen
Zweck mehr in den Vordergrund stellen, als es beim
alten Zinngeschirr der Fall ist. Sie muss versuchen,
sich zu künstlerischen Leistungen zu erheben in modernen,
dem Zinn angemessenen Formen, ohne in Abhängigkeit
von Silber oder Bronze zu geraten. Hierin, in der Her-
stellung eines Kunstzinnes von modernen, dem weichen
Gussmaterial angemessenen Formen hat die Pariser
Industrie bereits Beachtenswertes geleistet; Belgien hat
sich der französischen Richtung bei gröberer Ausführung
und derberer Erfindung angeschlossen. In Deutschland
ist die Firma E. Kayser in Köln vorangegangen mit einem
von der Pariser Art wesentlich abweichenden Geschmack.
Bas Kayserzinn entspricht zum größten Teil durchaus
den Anforderungen, die man an eine moderne, künst-
lerische Zinnware stellen kann. Obwohl die Pariser
Arbeiten von Lärche, Ledru, Garnier und anderen dem
Kayserzinn an dem Aufwand rein künstlerischer Er-
findung zum Teil sehr überlegen sind, hat das letztere
doch vor ihnen schwerwiegende Vorzüge. Die Pariser
Zinngeräte sind fast ausschließlich reines Schaugerät,
bei dessen Dekoration das figürliche Element durchaus
im Vordergrund steht. Sie zeigen im wesentlichen den
Charakter der Bronzearbeit, die nur gelegentlich durch
eine besonders weiche und flotte Behandlung der Ober-
fläche dem Zinn angepasst ist. Beim Kayserzinn finden
sich dagegen vorwiegend solche Geräte, die dekorativen
und Gebrauchszweck ohne Zwang vereinigen, wie Bowlen,
Krüge, Blumengefäße, Schreibzeuge, Leuchter und ähn-
liches mehr. . Das Kölner Zinn hat einen Vorteil über
das französische in seiner Legirung. Es ist gehärtet
und dadurch etwas widerspenstiger im Guss, erhält aber
dadurch einen hellen, silberähnlichen Glanz. Dieser milde
und vornehme Glanz ist ein specifischer Vorzug des
Zinnes vor anderen Metallen und soll daher vollauf zur
Geltung gebracht werden. Um ihn dauernd zu erhalten,
ist ein kräftiges und nicht zu seltenes Putzen des Ge-
fäßes nötig. Die harte Legirung des Kayserzinnes er-
laubt ein solches Scheuern, ohne dass dadurch die Relief-
verzierungen wesentlich angegriffen werden. Das weiche
Pariser Material aber würde völlig verrieben werden
und muss deshalb stumpf und bleifarbig gehalten werden.
Die Technik des Kayserzinnes ist von der alten
etwas abweichend. Die Modelle werden, je nach der
Art des Reliefs oder der Form, entweder in Messing
getrieben oder in Wachs modellirt. Über das Modell
nimmt man Hohlformen in Gips, die in Eisen nach-
gegossen werden. Die Eisenformen werden dann bis
zur tadellosen Schärfe der vertieften Ornamente vom
Graveur sorgfältig nachgestochen. Es ist dabei darauf
zu achten, dass die Reliefs, soweit sie mit dem Körper
zusammengegossen werden, breit und rundlich sind und
nicht unter sich gehen, damit sie leicht aus der Guss-
form sich lösen. Ein Nacheiseliren des Gusses ist bei
richtiger Bearbeitung der Form nicht nötig, wie auch
die Edelzinnschüsseln des 17. Jahrhundert niemals nach
dem Guss übergangen worden sind. Frei abstehende
Teile, wie Henkel, Füße und Hochreliefs werden durch
Lötung angesetzt. Schließlich erhält die fertige Zinn-
ware durch Poliren, teilweises Mattiren und Einschwärzen,
durch Hammerschlag und sonstige Belebung der Ober-
fläche ihre letzte Vollendung. Das moderne Zinn ist
also, obwohl zur starken Vervielfältigung bestimmt und
geeignet, doch eine Kunstware, die eine Fülle künstlerischer
Kräfte zum Entwurf wie zur Ausführung beansprucht. F.
Schriftverzierang, 17. Jahrh. Aus Niedling, Bücher-Ornamentik.