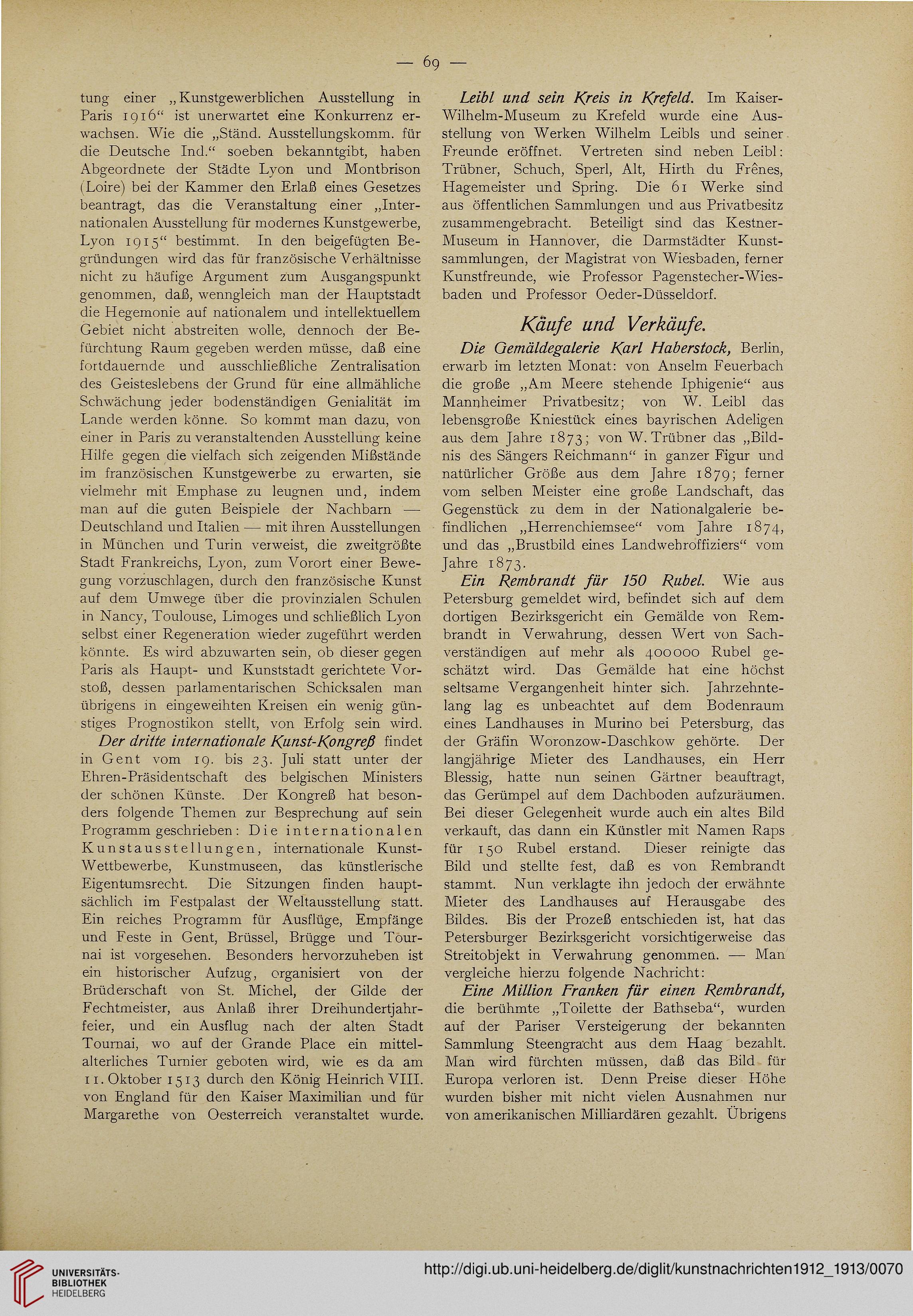- 69 -
tung einer „ Kunstgewerblichen Ausstellung in
Paris 1916" ist unerwartet eine Konkurrenz er-
wachsen. Wie die „Ständ. Ausstellungskomm. für
die Deutsche Ind." soeben bekanntgibt, haben
Abgeordnete der Städte Lyon und Montbrison
(Loire) bei der Kammer den Erlaß eines Gesetzes
beantragt, das die Veranstaltung einer „Inter-
nationalen Ausstellung für modernes Kunstgewerbe,
Lyon 1915" bestimmt. In den beigefügten Be-
gründungen wird das für französische Verhältnisse
nicht zu häufige Argument zum Ausgangspunkt
genommen, daß, wenngleich man der Hauptstadt
die Hegemonie auf nationalem und intellektuellem
Gebiet nicht abstreiten wolle, dennoch der Be-
fürchtung Raum gegeben werden müsse, daß eine
fortdauernde und ausschließliche Zentralisation
des Geisteslebens der Grund für eine allmähliche
Schwächung jeder bodenständigen Genialität im
Lande werden könne. So kommt man dazu, von
einer in Paris zu veranstaltenden Ausstellung keine
Hilfe gegen die vielfach sich zeigenden Mißstände
im französischen Kunstgewerbe zu erwarten, sie
vielmehr mit Emphase zu leugnen und, indem
man auf die guten Beispiele der Nachbarn —
Deutschland und Italien — mit ihren Ausstellungen
in München und Turin verweist, die zweitgrößte
Stadt Frankreichs, Lyon, zum Vorort einer Bewe-
gung vorzuschlagen, durch den französische Kunst
auf dem Umwege über die provinzialen Schulen
in Nancy, Toulouse, Limoges und schließlich Lyon
selbst einer Regeneration wieder zugeführt werden
könnte. Es wird abzuwarten sein, ob dieser gegen
Paris als Haupt- und Kunststadt gerichtete Vor-
stoß, dessen parlamentarischen Schicksalen man
übrigens in eingeweihten Kreisen ein wenig gün-
stiges Prognostikon stellt, von Erfolg sein wird.
Der dritte internationale Kunst-Kongreß findet
in Gent vom 19. bis 23. Juli statt unter der
Ehren-Präsidentschaft des belgischen Ministers
der schönen Künste. Der Kongreß hat beson-
ders folgende Themen zur Besprechung auf sein
Programm geschrieben : Die internationalen
Kunstausstellungen, internationale Kunst-
Wettbewerbe, Kunstmuseen, das künstlerische
Eigentumsrecht. Die Sitzungen finden haupt-
sächlich im Festpalast der Weltausstellung statt.
Ein reiches Programm für Ausflüge, Empfänge
und Feste in Gent, Brüssel, Brügge und Tour-
nai ist vorgesehen. Besonders hervorzuheben ist
ein historischer Aufzug, organisiert von der
Brüderschaft von St. Michel, der Gilde der
Fechtmeister, aus Anlaß ihrer Dreihundertjahr-
feier, und ein Ausflug nach der alten Stadt
Tournai, wo auf der Grande Place ein mittel-
alterliches Turnier geboten wird, wie es da am
11. Oktober 1513 durch den König Heinrich VIII.
von England für den Kaiser Maximilian und für
Margarethe von Oesterreich veranstaltet wurde.
Leibi und sein Kreis in Krefeld. Im Kaiser-
Wilhelm-Museum zu Krefeld wurde eine Aus-
stellung von Werken Wilhelm Leibis und seiner
Freunde eröffnet. Vertreten sind neben Leibi:
Trübner, Schuch, Sperl, Alt, Hirth du Frenes,
Hagemeister und Spring. Die 61 Werke sind
aus öffentlichen Sammlungen und aus Privatbesitz
zusammengebracht. Beteiligt sind das Kestner-
Museum in Hannover, die Darmstädter Kunst-
sammlungen, der Magistrat von Wiesbaden, ferner
Kunstfreunde, wie Professor Pagenstecher-Wies-
baden und Professor Oeder-Düsseldorf.
Käufe und Verkäufe.
Die Gemäldegalerie Karl Haberstock, Berlin,
erwarb im letzten Monat: von Anselm Feuerbach
die große „Am Meere stehende Iphigenie" aus
Mannheimer Privatbesitz; von W. Leibi das
lebensgroße Kniestück eines bayrischen Adeligen
aus dem Jahre 1873; von W. Trübner das „Bild-
nis des Sängers Reichmann" in ganzer Figur und
natürlicher Größe aus dem Jahre 1879; ferner
vom selben Meister eine große Landschaft, das
Gegenstück zu dem in der Nationalgalerie be-
findlichen „Herrenchiemsee" vom Jahre 1874,
und das „Brustbild eines Landwehroffiziers" vom
Jahre 1873.
Ein Rembrandt für 150 Rubel. Wie aus
Petersburg gemeldet wird, befindet sich auf dem
dortigen Bezirksgericht ein Gemälde von Rem-
brandt in Verwahrung, dessen Wert von Sach-
verständigen auf mehr als 400000 Rubel ge-
schätzt wird. Das Gemälde hat eine höchst
seltsame Vergangenheit hinter sich. Jahrzehnte-
lang lag es unbeachtet auf dem Bodenraum
eines Landhauses in Murino bei Petersburg, das
der Gräfin Woronzow-Daschkow gehörte. Der
langjährige Mieter des Landhauses, ein Herr
Blessig, hatte nun seinen Gärtner beauftragt,
das Gerumpel auf dem Dachboden aufzuräumen.
Bei dieser Gelegenheit wurde auch ein altes Bild
verkauft, das dann ein Künstler mit Namen Raps
für 150 Rubel erstand. Dieser reinigte das
Bild und stellte fest, daß es von Rembrandt
stammt. Nun verklagte ihn jedoch der erwähnte
Mieter des Landhauses auf Herausgabe des
Bildes. Bis der Prozeß entschieden ist, hat das
Petersburger Bezirksgericht vorsichtigerweise das
Streitobjekt in Verwahrung genommen. — Man
vergleiche hierzu folgende Nachricht:
Eine Million Franken für einen Rembrandt,
die berühmte „Toilette der Bathseba", wurden
auf der Pariser Versteigerung der bekannten
Sammlung Steengracht aus dem Haag bezahlt.
Man wird fürchten müssen, daß das Bild für
Europa verloren ist. Denn Preise dieser Höhe
wurden bisher mit nicht vielen Ausnahmen nur
von amerikanischen Milliardären gezahlt. Übrigens
tung einer „ Kunstgewerblichen Ausstellung in
Paris 1916" ist unerwartet eine Konkurrenz er-
wachsen. Wie die „Ständ. Ausstellungskomm. für
die Deutsche Ind." soeben bekanntgibt, haben
Abgeordnete der Städte Lyon und Montbrison
(Loire) bei der Kammer den Erlaß eines Gesetzes
beantragt, das die Veranstaltung einer „Inter-
nationalen Ausstellung für modernes Kunstgewerbe,
Lyon 1915" bestimmt. In den beigefügten Be-
gründungen wird das für französische Verhältnisse
nicht zu häufige Argument zum Ausgangspunkt
genommen, daß, wenngleich man der Hauptstadt
die Hegemonie auf nationalem und intellektuellem
Gebiet nicht abstreiten wolle, dennoch der Be-
fürchtung Raum gegeben werden müsse, daß eine
fortdauernde und ausschließliche Zentralisation
des Geisteslebens der Grund für eine allmähliche
Schwächung jeder bodenständigen Genialität im
Lande werden könne. So kommt man dazu, von
einer in Paris zu veranstaltenden Ausstellung keine
Hilfe gegen die vielfach sich zeigenden Mißstände
im französischen Kunstgewerbe zu erwarten, sie
vielmehr mit Emphase zu leugnen und, indem
man auf die guten Beispiele der Nachbarn —
Deutschland und Italien — mit ihren Ausstellungen
in München und Turin verweist, die zweitgrößte
Stadt Frankreichs, Lyon, zum Vorort einer Bewe-
gung vorzuschlagen, durch den französische Kunst
auf dem Umwege über die provinzialen Schulen
in Nancy, Toulouse, Limoges und schließlich Lyon
selbst einer Regeneration wieder zugeführt werden
könnte. Es wird abzuwarten sein, ob dieser gegen
Paris als Haupt- und Kunststadt gerichtete Vor-
stoß, dessen parlamentarischen Schicksalen man
übrigens in eingeweihten Kreisen ein wenig gün-
stiges Prognostikon stellt, von Erfolg sein wird.
Der dritte internationale Kunst-Kongreß findet
in Gent vom 19. bis 23. Juli statt unter der
Ehren-Präsidentschaft des belgischen Ministers
der schönen Künste. Der Kongreß hat beson-
ders folgende Themen zur Besprechung auf sein
Programm geschrieben : Die internationalen
Kunstausstellungen, internationale Kunst-
Wettbewerbe, Kunstmuseen, das künstlerische
Eigentumsrecht. Die Sitzungen finden haupt-
sächlich im Festpalast der Weltausstellung statt.
Ein reiches Programm für Ausflüge, Empfänge
und Feste in Gent, Brüssel, Brügge und Tour-
nai ist vorgesehen. Besonders hervorzuheben ist
ein historischer Aufzug, organisiert von der
Brüderschaft von St. Michel, der Gilde der
Fechtmeister, aus Anlaß ihrer Dreihundertjahr-
feier, und ein Ausflug nach der alten Stadt
Tournai, wo auf der Grande Place ein mittel-
alterliches Turnier geboten wird, wie es da am
11. Oktober 1513 durch den König Heinrich VIII.
von England für den Kaiser Maximilian und für
Margarethe von Oesterreich veranstaltet wurde.
Leibi und sein Kreis in Krefeld. Im Kaiser-
Wilhelm-Museum zu Krefeld wurde eine Aus-
stellung von Werken Wilhelm Leibis und seiner
Freunde eröffnet. Vertreten sind neben Leibi:
Trübner, Schuch, Sperl, Alt, Hirth du Frenes,
Hagemeister und Spring. Die 61 Werke sind
aus öffentlichen Sammlungen und aus Privatbesitz
zusammengebracht. Beteiligt sind das Kestner-
Museum in Hannover, die Darmstädter Kunst-
sammlungen, der Magistrat von Wiesbaden, ferner
Kunstfreunde, wie Professor Pagenstecher-Wies-
baden und Professor Oeder-Düsseldorf.
Käufe und Verkäufe.
Die Gemäldegalerie Karl Haberstock, Berlin,
erwarb im letzten Monat: von Anselm Feuerbach
die große „Am Meere stehende Iphigenie" aus
Mannheimer Privatbesitz; von W. Leibi das
lebensgroße Kniestück eines bayrischen Adeligen
aus dem Jahre 1873; von W. Trübner das „Bild-
nis des Sängers Reichmann" in ganzer Figur und
natürlicher Größe aus dem Jahre 1879; ferner
vom selben Meister eine große Landschaft, das
Gegenstück zu dem in der Nationalgalerie be-
findlichen „Herrenchiemsee" vom Jahre 1874,
und das „Brustbild eines Landwehroffiziers" vom
Jahre 1873.
Ein Rembrandt für 150 Rubel. Wie aus
Petersburg gemeldet wird, befindet sich auf dem
dortigen Bezirksgericht ein Gemälde von Rem-
brandt in Verwahrung, dessen Wert von Sach-
verständigen auf mehr als 400000 Rubel ge-
schätzt wird. Das Gemälde hat eine höchst
seltsame Vergangenheit hinter sich. Jahrzehnte-
lang lag es unbeachtet auf dem Bodenraum
eines Landhauses in Murino bei Petersburg, das
der Gräfin Woronzow-Daschkow gehörte. Der
langjährige Mieter des Landhauses, ein Herr
Blessig, hatte nun seinen Gärtner beauftragt,
das Gerumpel auf dem Dachboden aufzuräumen.
Bei dieser Gelegenheit wurde auch ein altes Bild
verkauft, das dann ein Künstler mit Namen Raps
für 150 Rubel erstand. Dieser reinigte das
Bild und stellte fest, daß es von Rembrandt
stammt. Nun verklagte ihn jedoch der erwähnte
Mieter des Landhauses auf Herausgabe des
Bildes. Bis der Prozeß entschieden ist, hat das
Petersburger Bezirksgericht vorsichtigerweise das
Streitobjekt in Verwahrung genommen. — Man
vergleiche hierzu folgende Nachricht:
Eine Million Franken für einen Rembrandt,
die berühmte „Toilette der Bathseba", wurden
auf der Pariser Versteigerung der bekannten
Sammlung Steengracht aus dem Haag bezahlt.
Man wird fürchten müssen, daß das Bild für
Europa verloren ist. Denn Preise dieser Höhe
wurden bisher mit nicht vielen Ausnahmen nur
von amerikanischen Milliardären gezahlt. Übrigens