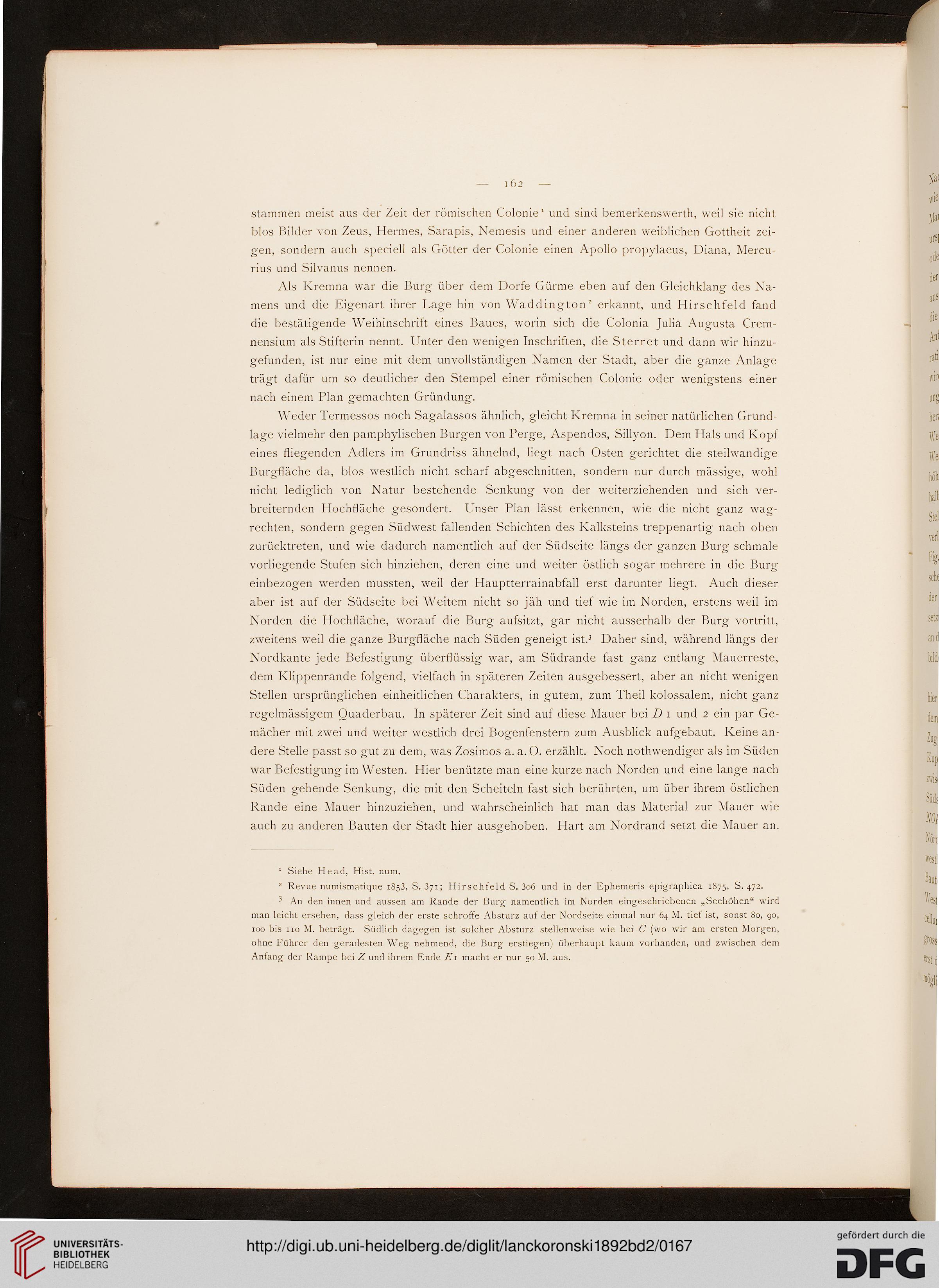— IÖ2 —
stammen meist aus der Zeit der römischen Colonie1 und sind bemerkenswerth, weil sie nicht
blos Bilder von Zeus, Hermes, Sarapis, Nemesis und einer anderen weiblichen Gottheit zei-
gen, sondern auch speciell als Götter der Colonie einen Apollo propylaeus, Diana, Mercu-
rius und Silvanus nennen.
Als Kremna war die Burg über dem Dorfe Gürme eben auf den Gleichklang- des Na-
mens und die Eigenart ihrer Lage hin von Waddington2 erkannt, und Hirschfeld fand
die bestätigende Weihinschrift eines Baues, worin sich die Colonia Julia Augusta Crem-
nensium als Stifterin nennt. Unter den wenigen Inschriften, die Sterret und dann wir hinzu-
gefunden, ist nur eine mit dem unvollständigen Namen der Stadt, aber die ganze Anlage
trägt dafür um so deutlicher den Stempel einer römischen Colonie oder wenigstens einer
nach einem Plan gemachten Gründung.
Weder Tennessos noch Sagalassos ähnlich, gleicht Kremna in seiner natürlichen Grund-
lage vielmehr den pamphylischen Burgen von Perge, Aspendos, Sillyon. Dem Hals und Kopf
eines fliegenden Adlers im Grundriss ähnelnd, liegt nach Osten gerichtet die steilwandige
Burgfläche da, blos westlich nicht scharf abgeschnitten, sondern nur durch massige, wohl
nicht lediglich von Natur bestehende Senkung von der weiterziehenden und sich ver-
breiternden Hochfläche gesondert. Unser Plan lässt erkennen, wie die nicht ganz wag-
rechten, sondern gegen Südwest fallenden Schichten des Kalksteins treppenartig nach oben
zurücktreten, und wie dadurch namentlich auf der Südseite längs der ganzen Burg schmale
vorliegende Stufen sich hinziehen, deren eine und weiter östlich sogar mehrere in die Burg
einbezogen werden mussten, weil der Hauptterrainabfall erst darunter liegt. Auch dieser
aber ist auf der Südseite bei Weitem nicht so jäh und tief wie im Norden, erstens weil im
Norden die Hochfläche, worauf die Burg aufsitzt, gar nicht ausserhalb der Burg vortritt,
zweitens weil die ganze Burgfläche nach Süden geneigt ist.3 Daher sind, während längs der
Nordkante jede Befestigung überflüssig war, am Südrande fast ganz entlang Mauerreste,
dem Klippenrande folgend, vielfach in späteren Zeiten ausgebessert, aber an nicht wenigen
Stellen ursprünglichen einheitlichen Charakters, in gutem, zum Theil kolossalem, nicht ganz
regelmässigem Ouaderbau. In späterer Zeit sind auf diese Mauer bei D i und 2 ein par Ge-
mächer mit zwei und weiter westlich drei Bogenfenstern zum Ausblick aufgebaut. Keine an-
dere Stelle passt so gut zu dem, was Zosimos a. a. O. erzählt. Noch nothwendiger als im Süden
war Befestigung im Westen. Hier benützte man eine kurze nach Norden und eine lange nach
Süden gehende Senkung, die mit den Scheiteln fast sich berührten, um über ihrem östlichen
Rande eine Mauer hinzuziehen, und wahrscheinlich hat man das Material zur Mauer wie
auch zu anderen Bauten der Stadt hier ausgehoben. Hart am Nordrand setzt die Mauer an.
1 Siehe He ad, Hist. num.
2 Revue numismatique 1853, S. 371; Hirschfeld S. 3o6 und in der Ephemeris epigraphica 1S75, S. 472.
3 An den innen und aussen am Rande der Burg namentlich im Norden eingeschriebenen „Seehühen'' wird
man leicht ersehen, dass gleich der erste schroffe Absturz auf der Nordseite einmal nur 64 M. tiet ist, sonst 80, 90,
100 bis 110 M. beträgt. Südlich dagegen ist solcher Absturz stellenweise wie bei C (wo wir am ersten Morgen,
ohne Führer den geradesten Weg nehmend, die Burg erstiegen) überhaupt kaum vorhanden, und zwischen dem
Anfang der Rampe bei Z und ihrem Ende E\ macht er nur 50 M. aus.
stammen meist aus der Zeit der römischen Colonie1 und sind bemerkenswerth, weil sie nicht
blos Bilder von Zeus, Hermes, Sarapis, Nemesis und einer anderen weiblichen Gottheit zei-
gen, sondern auch speciell als Götter der Colonie einen Apollo propylaeus, Diana, Mercu-
rius und Silvanus nennen.
Als Kremna war die Burg über dem Dorfe Gürme eben auf den Gleichklang- des Na-
mens und die Eigenart ihrer Lage hin von Waddington2 erkannt, und Hirschfeld fand
die bestätigende Weihinschrift eines Baues, worin sich die Colonia Julia Augusta Crem-
nensium als Stifterin nennt. Unter den wenigen Inschriften, die Sterret und dann wir hinzu-
gefunden, ist nur eine mit dem unvollständigen Namen der Stadt, aber die ganze Anlage
trägt dafür um so deutlicher den Stempel einer römischen Colonie oder wenigstens einer
nach einem Plan gemachten Gründung.
Weder Tennessos noch Sagalassos ähnlich, gleicht Kremna in seiner natürlichen Grund-
lage vielmehr den pamphylischen Burgen von Perge, Aspendos, Sillyon. Dem Hals und Kopf
eines fliegenden Adlers im Grundriss ähnelnd, liegt nach Osten gerichtet die steilwandige
Burgfläche da, blos westlich nicht scharf abgeschnitten, sondern nur durch massige, wohl
nicht lediglich von Natur bestehende Senkung von der weiterziehenden und sich ver-
breiternden Hochfläche gesondert. Unser Plan lässt erkennen, wie die nicht ganz wag-
rechten, sondern gegen Südwest fallenden Schichten des Kalksteins treppenartig nach oben
zurücktreten, und wie dadurch namentlich auf der Südseite längs der ganzen Burg schmale
vorliegende Stufen sich hinziehen, deren eine und weiter östlich sogar mehrere in die Burg
einbezogen werden mussten, weil der Hauptterrainabfall erst darunter liegt. Auch dieser
aber ist auf der Südseite bei Weitem nicht so jäh und tief wie im Norden, erstens weil im
Norden die Hochfläche, worauf die Burg aufsitzt, gar nicht ausserhalb der Burg vortritt,
zweitens weil die ganze Burgfläche nach Süden geneigt ist.3 Daher sind, während längs der
Nordkante jede Befestigung überflüssig war, am Südrande fast ganz entlang Mauerreste,
dem Klippenrande folgend, vielfach in späteren Zeiten ausgebessert, aber an nicht wenigen
Stellen ursprünglichen einheitlichen Charakters, in gutem, zum Theil kolossalem, nicht ganz
regelmässigem Ouaderbau. In späterer Zeit sind auf diese Mauer bei D i und 2 ein par Ge-
mächer mit zwei und weiter westlich drei Bogenfenstern zum Ausblick aufgebaut. Keine an-
dere Stelle passt so gut zu dem, was Zosimos a. a. O. erzählt. Noch nothwendiger als im Süden
war Befestigung im Westen. Hier benützte man eine kurze nach Norden und eine lange nach
Süden gehende Senkung, die mit den Scheiteln fast sich berührten, um über ihrem östlichen
Rande eine Mauer hinzuziehen, und wahrscheinlich hat man das Material zur Mauer wie
auch zu anderen Bauten der Stadt hier ausgehoben. Hart am Nordrand setzt die Mauer an.
1 Siehe He ad, Hist. num.
2 Revue numismatique 1853, S. 371; Hirschfeld S. 3o6 und in der Ephemeris epigraphica 1S75, S. 472.
3 An den innen und aussen am Rande der Burg namentlich im Norden eingeschriebenen „Seehühen'' wird
man leicht ersehen, dass gleich der erste schroffe Absturz auf der Nordseite einmal nur 64 M. tiet ist, sonst 80, 90,
100 bis 110 M. beträgt. Südlich dagegen ist solcher Absturz stellenweise wie bei C (wo wir am ersten Morgen,
ohne Führer den geradesten Weg nehmend, die Burg erstiegen) überhaupt kaum vorhanden, und zwischen dem
Anfang der Rampe bei Z und ihrem Ende E\ macht er nur 50 M. aus.