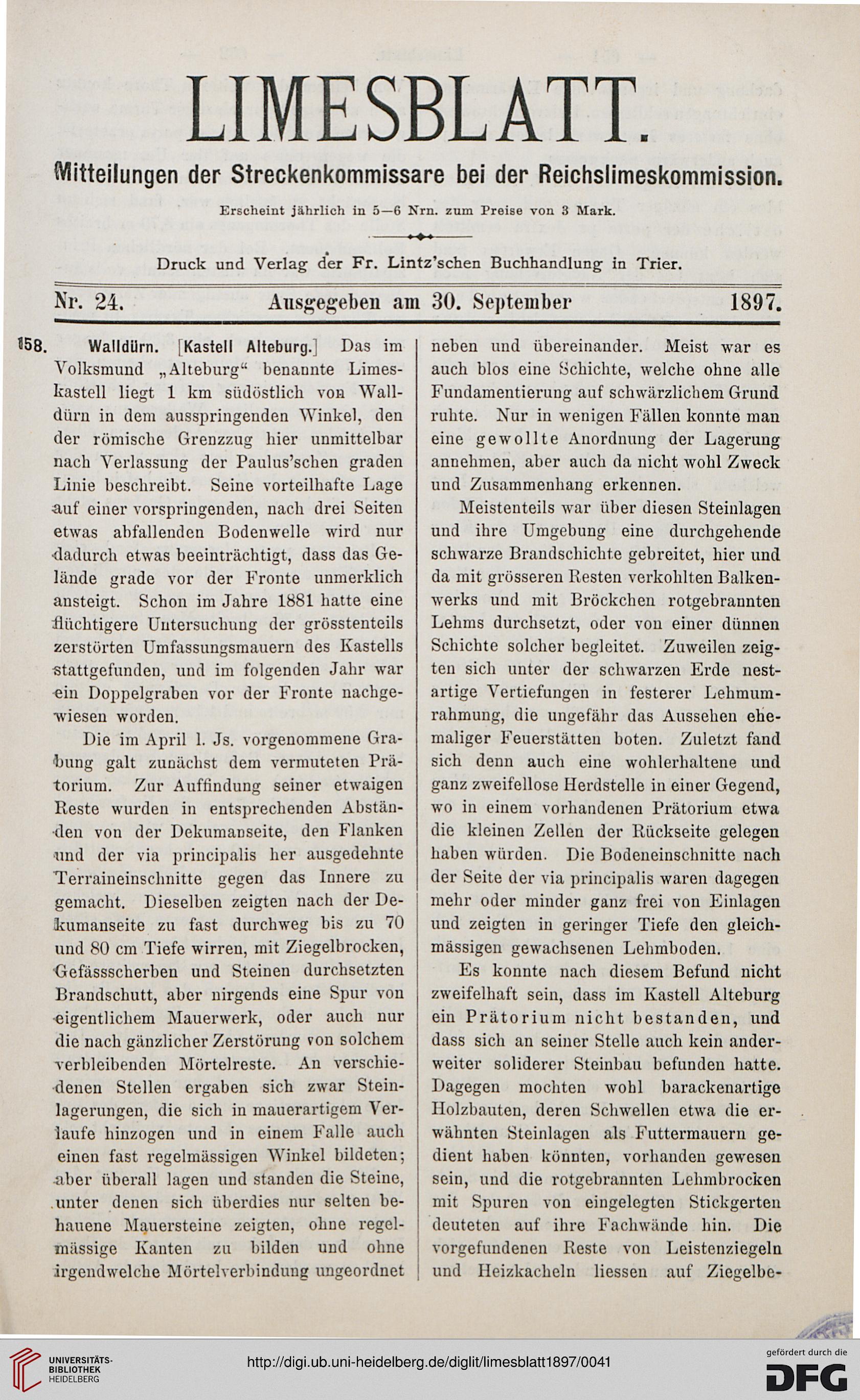LIMESBLATT.
Mitteilungen der Streckenkommissare bei der Reichslimeskommission.
Erscheint jährlich in 5—6 Nrn. zum Preise von 3 Mark.
Druck und Verlag der Fr. Lintz'schen Buchhandlung in Trier.
Nr. 24. Ausgegeben am 30. September 1897.
•58. Walldürn. |Kastell Alteburg.] Das im
Volksmund „Alteburg" benannte Limes-
kastell liegt 1 km südöstlich von Wall-
dürn in dem ausspringenden Winkel, den
der römische Grenzzug hier unmittelbar
nach Verlassung der Paulus'schen graden
Linie beschreibt. Seine vorteilhafte Lage
auf einer vorspringenden, nach drei Seiten
etwas abfallenden Bodenwelle wird nur
•dadurch etwas beeinträchtigt, dass das Ge-
lände grade vor der Fronte unmerklich
ansteigt. Schon im Jahre 1881 hatte eine
flüchtigere Untersuchung der grösstenteils
zerstörten Umfassungsmauern des Kastells
stattgefunden, und im folgenden Jahr war
ein Doppelgrabeu vor der Fronte nachge-
wiesen worden.
Die im April 1. Js. vorgenommene Gra-
nting galt zunächst dem vermuteten Prä-
torium. Zur Auffindung seiner etwaigen
Reste wurden in entsprechenden Abstän-
den von der Dekumanseite, den Flanken
und der via principalis her ausgedehnte
Terraineinschnitte gegen das Innere zu
gemacht. Dieselben zeigten nach der De-
kumanseite zu fast durchweg bis zu 70
und 80 cm Tiefe wirren, mit Ziegelbrocken,
Gefässscherben und Steinen durchsetzten
Brandschutt, aber nirgends eine Spur von
eigentlichem Mauerwerk, oder auch nur
die nach gänzlicher Zerstörung von solchem
verbleibenden Mörtelreste. An verschie-
denen Stellen ergaben sich zwar Stein-
lagerungen, die sich in mauerartigem Ver-
laufe hinzogen und in einem Falle auch
einen fast regelmässigen Winkel bildeten;
«her überall lagen und standen die Steine,
unter denen sich überdies nur selten be-
haltene Mauersteine zeigten, ohne regel-
mässige Kanten zu bilden und ohne
irgendwelche Mörtelverbindung ungeordnet
neben und übereinander. Meist war es
auch blos eine Schichte, welche ohne alle
Fundamentierung auf schwärzlichem Grund
ruhte. Nur in wenigen Fällen konnte man
eine gewollte Anordnung der Lagerung
annehmen, aber auch da nicht wohl Zweck
und Zusammenhang erkennen.
Meistenteils war über diesen Steinlagen
und ihre Umgebung eine durchgehende
schwarze Brandschichte gebreitet, hier und
da mit grösseren Kesten verkohlten Balken-
werks und mit Bröckchen rotgebraunten
Lehms durchsetzt, oder vou einer dünnen
Schichte solcher begleitet. Zuweilen zeig-
ten sich unter der schwarzen Erde nest-
artige Vertiefungen in festerer Lehmum-
rahmung, die ungefähr das Aussehen ehe-
maliger Feuerstätten boten. Zuletzt fand
sich denn auch eine wohlerhaltene und
ganz zw eifellose Herdstelle in einer Gegend,
wo in einem vorhandenen Prätorium etwa
die kleinen Zellen der Rückseite gelegen
haben würden. Die Bodeneinschnitte nach
der Seite der via principalis waren dagegen
mehr oder minder ganz frei von Einlagen
und zeigten in geringer Tiefe den gleich-
massigen gewachsenen Lehmboden.
Es konnte nach diesem Befund nicht
zweifelhaft sein, dass im Kastell Alteburg
ein Prätorium nicht bestanden, und
dass sich an seiner Stelle auch kein ander-
weiter soliderer Steinbau befunden hatte.
Dagegen mochten wohl barackenartige
Holzbauten, deren Schwellen etwa die er-
wähnten Steinlagen als Futtermaucrn ge-
dient haben könnten, vorhanden gewesen
sein, und die rotgebrannten Lehmbrocken
mit Spuren von eingelegten Stickgerten
deuteten auf ihre Fachwände hin. Die
vorgefundenen Reste von Leistenziegeln
j und Heizkacheln Hessen auf Ziegelbe-
Mitteilungen der Streckenkommissare bei der Reichslimeskommission.
Erscheint jährlich in 5—6 Nrn. zum Preise von 3 Mark.
Druck und Verlag der Fr. Lintz'schen Buchhandlung in Trier.
Nr. 24. Ausgegeben am 30. September 1897.
•58. Walldürn. |Kastell Alteburg.] Das im
Volksmund „Alteburg" benannte Limes-
kastell liegt 1 km südöstlich von Wall-
dürn in dem ausspringenden Winkel, den
der römische Grenzzug hier unmittelbar
nach Verlassung der Paulus'schen graden
Linie beschreibt. Seine vorteilhafte Lage
auf einer vorspringenden, nach drei Seiten
etwas abfallenden Bodenwelle wird nur
•dadurch etwas beeinträchtigt, dass das Ge-
lände grade vor der Fronte unmerklich
ansteigt. Schon im Jahre 1881 hatte eine
flüchtigere Untersuchung der grösstenteils
zerstörten Umfassungsmauern des Kastells
stattgefunden, und im folgenden Jahr war
ein Doppelgrabeu vor der Fronte nachge-
wiesen worden.
Die im April 1. Js. vorgenommene Gra-
nting galt zunächst dem vermuteten Prä-
torium. Zur Auffindung seiner etwaigen
Reste wurden in entsprechenden Abstän-
den von der Dekumanseite, den Flanken
und der via principalis her ausgedehnte
Terraineinschnitte gegen das Innere zu
gemacht. Dieselben zeigten nach der De-
kumanseite zu fast durchweg bis zu 70
und 80 cm Tiefe wirren, mit Ziegelbrocken,
Gefässscherben und Steinen durchsetzten
Brandschutt, aber nirgends eine Spur von
eigentlichem Mauerwerk, oder auch nur
die nach gänzlicher Zerstörung von solchem
verbleibenden Mörtelreste. An verschie-
denen Stellen ergaben sich zwar Stein-
lagerungen, die sich in mauerartigem Ver-
laufe hinzogen und in einem Falle auch
einen fast regelmässigen Winkel bildeten;
«her überall lagen und standen die Steine,
unter denen sich überdies nur selten be-
haltene Mauersteine zeigten, ohne regel-
mässige Kanten zu bilden und ohne
irgendwelche Mörtelverbindung ungeordnet
neben und übereinander. Meist war es
auch blos eine Schichte, welche ohne alle
Fundamentierung auf schwärzlichem Grund
ruhte. Nur in wenigen Fällen konnte man
eine gewollte Anordnung der Lagerung
annehmen, aber auch da nicht wohl Zweck
und Zusammenhang erkennen.
Meistenteils war über diesen Steinlagen
und ihre Umgebung eine durchgehende
schwarze Brandschichte gebreitet, hier und
da mit grösseren Kesten verkohlten Balken-
werks und mit Bröckchen rotgebraunten
Lehms durchsetzt, oder vou einer dünnen
Schichte solcher begleitet. Zuweilen zeig-
ten sich unter der schwarzen Erde nest-
artige Vertiefungen in festerer Lehmum-
rahmung, die ungefähr das Aussehen ehe-
maliger Feuerstätten boten. Zuletzt fand
sich denn auch eine wohlerhaltene und
ganz zw eifellose Herdstelle in einer Gegend,
wo in einem vorhandenen Prätorium etwa
die kleinen Zellen der Rückseite gelegen
haben würden. Die Bodeneinschnitte nach
der Seite der via principalis waren dagegen
mehr oder minder ganz frei von Einlagen
und zeigten in geringer Tiefe den gleich-
massigen gewachsenen Lehmboden.
Es konnte nach diesem Befund nicht
zweifelhaft sein, dass im Kastell Alteburg
ein Prätorium nicht bestanden, und
dass sich an seiner Stelle auch kein ander-
weiter soliderer Steinbau befunden hatte.
Dagegen mochten wohl barackenartige
Holzbauten, deren Schwellen etwa die er-
wähnten Steinlagen als Futtermaucrn ge-
dient haben könnten, vorhanden gewesen
sein, und die rotgebrannten Lehmbrocken
mit Spuren von eingelegten Stickgerten
deuteten auf ihre Fachwände hin. Die
vorgefundenen Reste von Leistenziegeln
j und Heizkacheln Hessen auf Ziegelbe-