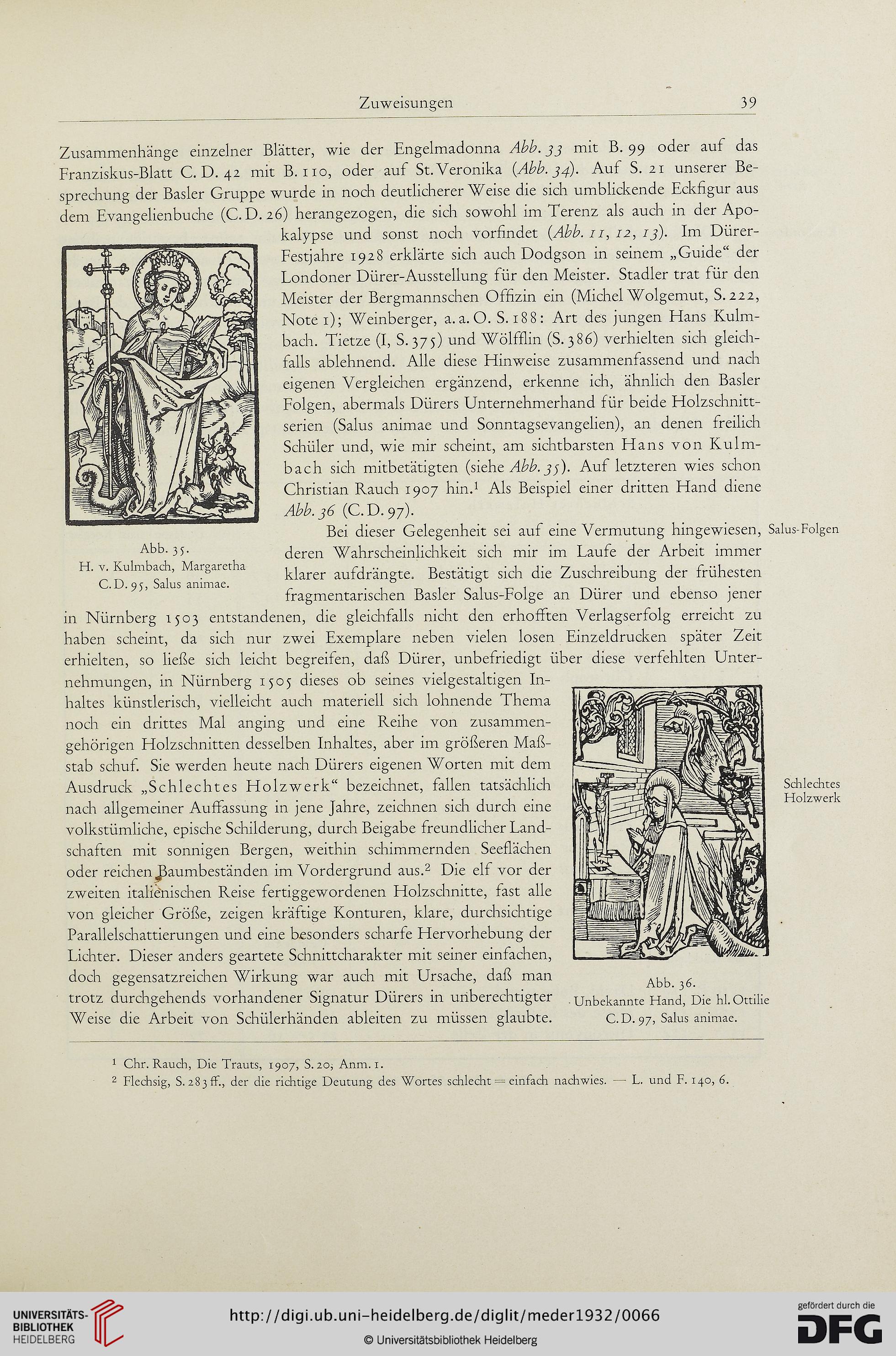Zuweisungen
39
Zusammenhänge einzelner Blätter, wie der Engelmadonna Abb. 33 mit B. 99 oder auf das
Franziskus-Blatt C. D. 42 mit B. 110, oder auf St. Veronika (Abb. 34). Auf S. 21 unserer Be-
sprechung der Basler Gruppe wurde in noch deutlicherer Weise die sich umblickende Eckfigur aus
dem Evangelienbuche (C. D. 26) herangezogen, die sich sowohl im Terenz als auch in der Apo-
kalypse und sonst noch vorfindet (Abb. 11, 12, 13). Ina Dürer-
Festjahre 1928 erklärte sich auch Dodgson in seinem „Guide“ der
Londoner Dürer-Ausstellung für den Meister. Stadler trat für den
Meister der Bergmannschen Offizin ein (Michel Wolgemut, S. 222,
Notei); Weinberger, a. a. O. S. 188: Art des jungen Hans Kulm-
bach. Tietze (I, S.375) und Wölfflin (S. 386) verhielten sich gleich-
falls ablehnend. Alle diese Hinweise zusammenfassend und nach
eigenen Vergleichen ergänzend, erkenne ich, ähnlich den Basler
Folgen, abermals Dürers Unternehmerhand für beide Holzschnitt-
serien (Salus anirnae und Sonntagsevangelien), an denen freilich
Schüler und, wie mir scheint, am sichtbarsten Hans von Kulm-
bach sich mitbetätigten (siehe Abb. 33). Auf letzteren wies schon
Christian Rauch 1907 hin.1 Als Beispiel einer dritten Hand diene
Abb. 36 (C.D. 97).
Bei dieser Gelegenheit sei auf eine Vermutung hingewiesen, Salus-Folgen
deren Wahrscheinlichkeit sich mir im Laufe der Arbeit immer
klarer aufdrängte. Bestätigt sich die Zuschreibung der frühesten
fragmentarischen Basler Salus-Folge an Dürer und ebenso jener
in Nürnberg 1503 entstandenen, die gleichfalls nicht den erhofften Verlagserfolg erreicht zu
haben scheint, da sich nur zwei Exemplare neben vielen losen Einzeldrucken später Zeit
erhielten, so ließe sich leicht begreifen, daß Dürer, unbefriedigt über diese verfehlten Unter-
nehmungen, in Nürnberg 1505 dieses ob seines vielgestaltigen In-
haltes künstlerisch, vielleicht auch materiell sich lohnende Thema
noch ein drittes Mal anging und eine Reihe von zusammen-
gehörigen Holzschnitten desselben Inhaltes, aber im größeren Maß-
stab schuf. Sie werden heute nach Dürers eigenen Worten mit dem
Ausdruck „Schlechtes Holzwerk“ bezeichnet, fallen tatsächlich
nach allgemeiner Auffassung in jene Jahre, zeichnen sich durch eine
volkstümliche, epische Schilderung, durch Beigabe freundlicher Land-
schaften mit sonnigen Bergen, weithin schimmernden Seeflächen
oder reichen Jlaumbeständen im Vordergrund aus.2 Die elf vor der
zweiten italienischen Reise fertiggewordenen Holzschnitte, fast alle
von gleicher Größe, zeigen kräftige Konturen, klare, durchsichtige
Parallelschattierungen und eine besonders scharfe Hervorhebung der
Lichter. Dieser anders geartete Schnittcharakter mit seiner einfachen,
doch gegensatzreichen Wirkung war auch mit Ursache, daß man
trotz durchgehends vorhandener Signatur Dürers in unberechtigter
Weise die Arbeit von Schülerhänden ableiten zu müssen glaubte.
Schlechtes
Holzwerk
Abb. 36.
Unbekannte Hand, Die hl. Ottilie
C.D. 97, Salus anirnae.
Abb. 35.
H. v. Kulmbach, Margaretha
C.D. 95, Salus anirnae.
1 Chr. Rauch, Die Trauts, 1907, S. 20, Anm. 1.
2 Flechsig, S. 283 ff., der die richtige Deutung des Wortes schlecht = einfach nachwies. — L. und F. 140, 6.
39
Zusammenhänge einzelner Blätter, wie der Engelmadonna Abb. 33 mit B. 99 oder auf das
Franziskus-Blatt C. D. 42 mit B. 110, oder auf St. Veronika (Abb. 34). Auf S. 21 unserer Be-
sprechung der Basler Gruppe wurde in noch deutlicherer Weise die sich umblickende Eckfigur aus
dem Evangelienbuche (C. D. 26) herangezogen, die sich sowohl im Terenz als auch in der Apo-
kalypse und sonst noch vorfindet (Abb. 11, 12, 13). Ina Dürer-
Festjahre 1928 erklärte sich auch Dodgson in seinem „Guide“ der
Londoner Dürer-Ausstellung für den Meister. Stadler trat für den
Meister der Bergmannschen Offizin ein (Michel Wolgemut, S. 222,
Notei); Weinberger, a. a. O. S. 188: Art des jungen Hans Kulm-
bach. Tietze (I, S.375) und Wölfflin (S. 386) verhielten sich gleich-
falls ablehnend. Alle diese Hinweise zusammenfassend und nach
eigenen Vergleichen ergänzend, erkenne ich, ähnlich den Basler
Folgen, abermals Dürers Unternehmerhand für beide Holzschnitt-
serien (Salus anirnae und Sonntagsevangelien), an denen freilich
Schüler und, wie mir scheint, am sichtbarsten Hans von Kulm-
bach sich mitbetätigten (siehe Abb. 33). Auf letzteren wies schon
Christian Rauch 1907 hin.1 Als Beispiel einer dritten Hand diene
Abb. 36 (C.D. 97).
Bei dieser Gelegenheit sei auf eine Vermutung hingewiesen, Salus-Folgen
deren Wahrscheinlichkeit sich mir im Laufe der Arbeit immer
klarer aufdrängte. Bestätigt sich die Zuschreibung der frühesten
fragmentarischen Basler Salus-Folge an Dürer und ebenso jener
in Nürnberg 1503 entstandenen, die gleichfalls nicht den erhofften Verlagserfolg erreicht zu
haben scheint, da sich nur zwei Exemplare neben vielen losen Einzeldrucken später Zeit
erhielten, so ließe sich leicht begreifen, daß Dürer, unbefriedigt über diese verfehlten Unter-
nehmungen, in Nürnberg 1505 dieses ob seines vielgestaltigen In-
haltes künstlerisch, vielleicht auch materiell sich lohnende Thema
noch ein drittes Mal anging und eine Reihe von zusammen-
gehörigen Holzschnitten desselben Inhaltes, aber im größeren Maß-
stab schuf. Sie werden heute nach Dürers eigenen Worten mit dem
Ausdruck „Schlechtes Holzwerk“ bezeichnet, fallen tatsächlich
nach allgemeiner Auffassung in jene Jahre, zeichnen sich durch eine
volkstümliche, epische Schilderung, durch Beigabe freundlicher Land-
schaften mit sonnigen Bergen, weithin schimmernden Seeflächen
oder reichen Jlaumbeständen im Vordergrund aus.2 Die elf vor der
zweiten italienischen Reise fertiggewordenen Holzschnitte, fast alle
von gleicher Größe, zeigen kräftige Konturen, klare, durchsichtige
Parallelschattierungen und eine besonders scharfe Hervorhebung der
Lichter. Dieser anders geartete Schnittcharakter mit seiner einfachen,
doch gegensatzreichen Wirkung war auch mit Ursache, daß man
trotz durchgehends vorhandener Signatur Dürers in unberechtigter
Weise die Arbeit von Schülerhänden ableiten zu müssen glaubte.
Schlechtes
Holzwerk
Abb. 36.
Unbekannte Hand, Die hl. Ottilie
C.D. 97, Salus anirnae.
Abb. 35.
H. v. Kulmbach, Margaretha
C.D. 95, Salus anirnae.
1 Chr. Rauch, Die Trauts, 1907, S. 20, Anm. 1.
2 Flechsig, S. 283 ff., der die richtige Deutung des Wortes schlecht = einfach nachwies. — L. und F. 140, 6.