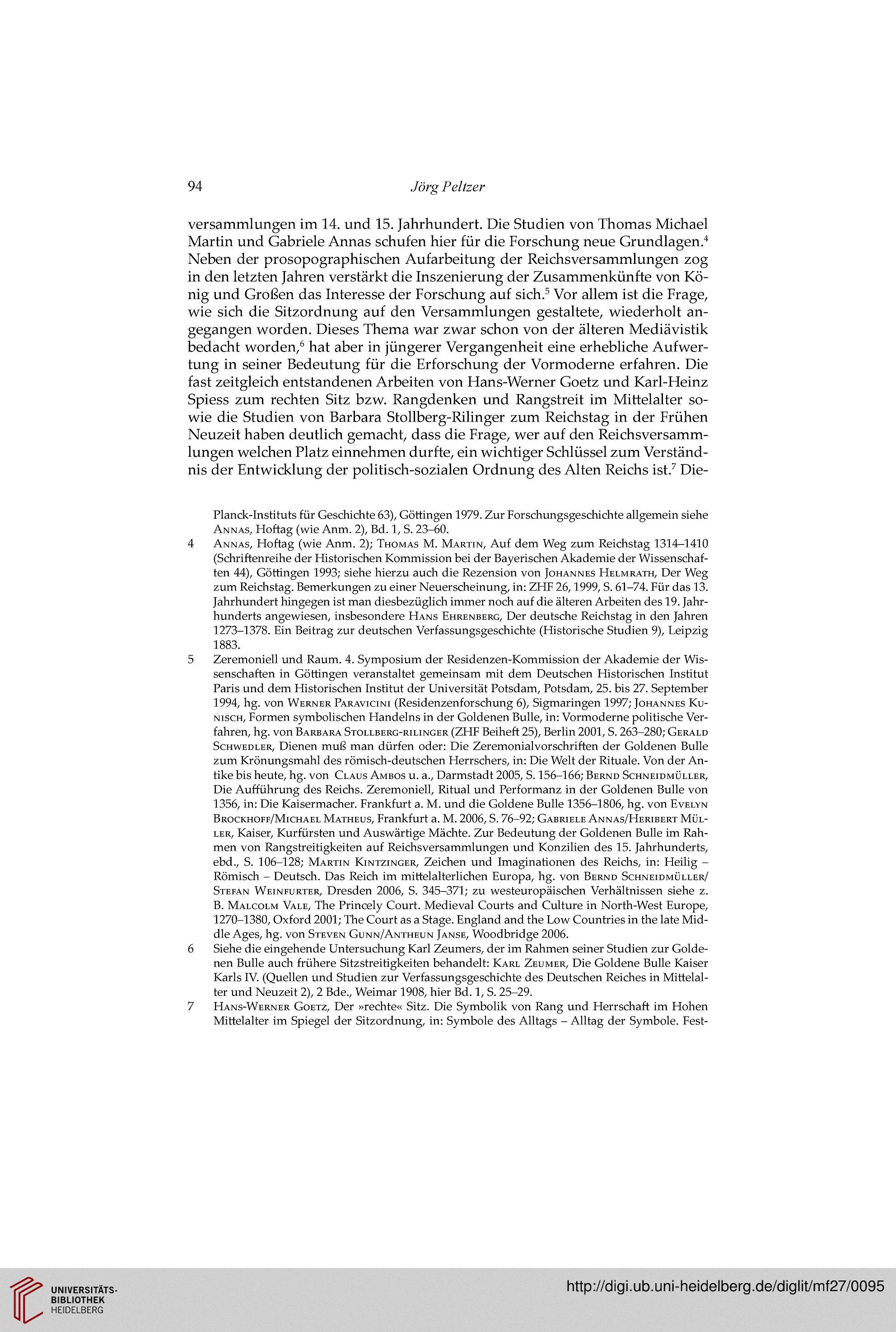94
Jörg Peltzer
Versammlungen im 14. und 15. Jahrhundert. Die Studien von Thomas Michael
Martin und Gabriele Annas schufen hier für die Forschung neue Grundlagen.4
Neben der prosopographischen Aufarbeitung der Reichsversammlungen zog
in den letzten Jahren verstärkt die Inszenierung der Zusammenkünfte von Kö-
nig und Großen das Interesse der Forschung auf sich.5 Vor allem ist die Frage,
wie sich die Sitzordnung auf den Versammlungen gestaltete, wiederholt an-
gegangen worden. Dieses Thema war zwar schon von der älteren Mediävistik
bedacht worden,6 hat aber in jüngerer Vergangenheit eine erhebliche Aufwer-
tung in seiner Bedeutung für die Erforschung der Vormoderne erfahren. Die
fast zeitgleich entstandenen Arbeiten von Hans-Werner Goetz und Karl-Heinz
Spiess zum rechten Sitz bzw. Rangdenken und Rangstreit im Mittelalter so-
wie die Studien von Barbara Stollberg-Rilinger zum Reichstag in der Frühen
Neuzeit haben deutlich gemacht, dass die Frage, wer auf den Reichsversamm-
lungen welchen Platz einnehmen durfte, ein wichtiger Schlüssel zum Verständ-
nis der Entwicklung der politisch-sozialen Ordnung des Alten Reichs ist.7 Die-
Planck-Instituts für Geschichte 63), Göttingen 1979. Zur Forschungsgeschichte allgemein siehe
Annas, Hoftag (wie Anm. 2), Bd. 1, S. 23-60.
4 Annas, Hoftag (wie Anm. 2); Thomas M. Martin, Auf dem Weg zum Reichstag 1314—1410
(Schriftenreihe der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaf-
ten 44), Göttingen 1993; siehe hierzu auch die Rezension von Johannes Helmrath, Der Weg
zum Reichstag. Bemerkungen zu einer Neuerscheinung, in: ZHF 26,1999, S. 61-74. Für das 13.
Jahrhundert hingegen ist man diesbezüglich immer noch auf die älteren Arbeiten des 19. Jahr-
hunderts angewiesen, insbesondere Hans Ehrenberg, Der deutsche Reichstag in den Jahren
1273-1378. Ein Beitrag zur deutschen Verfassungsgeschichte (Historische Studien 9), Leipzig
1883.
5 Zeremoniell und Raum. 4. Symposium der Residenzen-Kommission der Akademie der Wis-
senschaften in Göttingen veranstaltet gemeinsam mit dem Deutschen Historischen Institut
Paris und dem Historischen Institut der Universität Potsdam, Potsdam, 25. bis 27. September
1994, hg. von Werner Paravicini (Residenzenforschung 6), Sigmaringen 1997; Johannes Ku-
nisch. Formen symbolischen Handelns in der Goldenen Bulle, in: Vormoderne politische Ver-
fahren, hg. von Barbara Stollberg-rilinger (ZHF Beiheft 25), Berlin 2001, S. 263-280; Gerald
Schwedler, Dienen muß man dürfen oder: Die Zeremonialvorschriften der Goldenen Bulle
zum Krönungsmahl des römisch-deutschen Herrschers, in: Die Welt der Rituale. Von der An-
tike bis heute, hg. von Claus Ambos u. a., Darmstadt 2005, S. 156-166; Bernd Schneidmüller,
Die Aufführung des Reichs. Zeremoniell, Ritual und Performanz in der Goldenen Bulle von
1356, in: Die Kaisermacher. Frankfurt a. M. und die Goldene Bulle 1356-1806, hg. von Evelyn
Brockhoff/Michael Matheus, Frankfurt a. M. 2006, S. 76-92; Gabriele Annas/Heribert Mül-
ler, Kaiser, Kurfürsten und Auswärtige Mächte. Zur Bedeutung der Goldenen Bulle im Rah-
men von Rangstreitigkeiten auf Reichsversammlungen und Konzilien des 15. Jahrhunderts,
ebd., S. 106-128; Martin Kintzinger, Zeichen und Imaginationen des Reichs, in: Heilig -
Römisch - Deutsch. Das Reich im mittelalterlichen Europa, hg. von Bernd Schneidmüller/
Stefan Weinfurter, Dresden 2006, S. 345-371; zu westeuropäischen Verhältnissen siehe z.
B. Malcolm Vale, The Princely Court. Medieval Courts and Culture in North-West Europe,
1270-1380, Oxford 2001; The Court as a Stage. England and the Low Countries in the late Mid-
dle Ages, hg. von Steven Gunn/Antheun Janse, Woodbridge 2006.
6 Siehe die eingehende Untersuchung Karl Zeumers, der im Rahmen seiner Studien zur Golde-
nen Bulle auch frühere Sitzstreitigkeiten behandelt: Karl Zeumer, Die Goldene Bulle Kaiser
Karls IV. (Quellen und Studien zur Verfassungsgeschichte des Deutschen Reiches in Mittelal-
ter und Neuzeit 2), 2 Bde., Weimar 1908, hier Bd. 1, S. 25-29.
7 Hans-Werner Goetz, Der »rechte« Sitz. Die Symbolik von Rang und Herrschaft im Hohen
Mittelalter im Spiegel der Sitzordnung, in: Symbole des Alltags - Alltag der Symbole. Fest-
Jörg Peltzer
Versammlungen im 14. und 15. Jahrhundert. Die Studien von Thomas Michael
Martin und Gabriele Annas schufen hier für die Forschung neue Grundlagen.4
Neben der prosopographischen Aufarbeitung der Reichsversammlungen zog
in den letzten Jahren verstärkt die Inszenierung der Zusammenkünfte von Kö-
nig und Großen das Interesse der Forschung auf sich.5 Vor allem ist die Frage,
wie sich die Sitzordnung auf den Versammlungen gestaltete, wiederholt an-
gegangen worden. Dieses Thema war zwar schon von der älteren Mediävistik
bedacht worden,6 hat aber in jüngerer Vergangenheit eine erhebliche Aufwer-
tung in seiner Bedeutung für die Erforschung der Vormoderne erfahren. Die
fast zeitgleich entstandenen Arbeiten von Hans-Werner Goetz und Karl-Heinz
Spiess zum rechten Sitz bzw. Rangdenken und Rangstreit im Mittelalter so-
wie die Studien von Barbara Stollberg-Rilinger zum Reichstag in der Frühen
Neuzeit haben deutlich gemacht, dass die Frage, wer auf den Reichsversamm-
lungen welchen Platz einnehmen durfte, ein wichtiger Schlüssel zum Verständ-
nis der Entwicklung der politisch-sozialen Ordnung des Alten Reichs ist.7 Die-
Planck-Instituts für Geschichte 63), Göttingen 1979. Zur Forschungsgeschichte allgemein siehe
Annas, Hoftag (wie Anm. 2), Bd. 1, S. 23-60.
4 Annas, Hoftag (wie Anm. 2); Thomas M. Martin, Auf dem Weg zum Reichstag 1314—1410
(Schriftenreihe der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaf-
ten 44), Göttingen 1993; siehe hierzu auch die Rezension von Johannes Helmrath, Der Weg
zum Reichstag. Bemerkungen zu einer Neuerscheinung, in: ZHF 26,1999, S. 61-74. Für das 13.
Jahrhundert hingegen ist man diesbezüglich immer noch auf die älteren Arbeiten des 19. Jahr-
hunderts angewiesen, insbesondere Hans Ehrenberg, Der deutsche Reichstag in den Jahren
1273-1378. Ein Beitrag zur deutschen Verfassungsgeschichte (Historische Studien 9), Leipzig
1883.
5 Zeremoniell und Raum. 4. Symposium der Residenzen-Kommission der Akademie der Wis-
senschaften in Göttingen veranstaltet gemeinsam mit dem Deutschen Historischen Institut
Paris und dem Historischen Institut der Universität Potsdam, Potsdam, 25. bis 27. September
1994, hg. von Werner Paravicini (Residenzenforschung 6), Sigmaringen 1997; Johannes Ku-
nisch. Formen symbolischen Handelns in der Goldenen Bulle, in: Vormoderne politische Ver-
fahren, hg. von Barbara Stollberg-rilinger (ZHF Beiheft 25), Berlin 2001, S. 263-280; Gerald
Schwedler, Dienen muß man dürfen oder: Die Zeremonialvorschriften der Goldenen Bulle
zum Krönungsmahl des römisch-deutschen Herrschers, in: Die Welt der Rituale. Von der An-
tike bis heute, hg. von Claus Ambos u. a., Darmstadt 2005, S. 156-166; Bernd Schneidmüller,
Die Aufführung des Reichs. Zeremoniell, Ritual und Performanz in der Goldenen Bulle von
1356, in: Die Kaisermacher. Frankfurt a. M. und die Goldene Bulle 1356-1806, hg. von Evelyn
Brockhoff/Michael Matheus, Frankfurt a. M. 2006, S. 76-92; Gabriele Annas/Heribert Mül-
ler, Kaiser, Kurfürsten und Auswärtige Mächte. Zur Bedeutung der Goldenen Bulle im Rah-
men von Rangstreitigkeiten auf Reichsversammlungen und Konzilien des 15. Jahrhunderts,
ebd., S. 106-128; Martin Kintzinger, Zeichen und Imaginationen des Reichs, in: Heilig -
Römisch - Deutsch. Das Reich im mittelalterlichen Europa, hg. von Bernd Schneidmüller/
Stefan Weinfurter, Dresden 2006, S. 345-371; zu westeuropäischen Verhältnissen siehe z.
B. Malcolm Vale, The Princely Court. Medieval Courts and Culture in North-West Europe,
1270-1380, Oxford 2001; The Court as a Stage. England and the Low Countries in the late Mid-
dle Ages, hg. von Steven Gunn/Antheun Janse, Woodbridge 2006.
6 Siehe die eingehende Untersuchung Karl Zeumers, der im Rahmen seiner Studien zur Golde-
nen Bulle auch frühere Sitzstreitigkeiten behandelt: Karl Zeumer, Die Goldene Bulle Kaiser
Karls IV. (Quellen und Studien zur Verfassungsgeschichte des Deutschen Reiches in Mittelal-
ter und Neuzeit 2), 2 Bde., Weimar 1908, hier Bd. 1, S. 25-29.
7 Hans-Werner Goetz, Der »rechte« Sitz. Die Symbolik von Rang und Herrschaft im Hohen
Mittelalter im Spiegel der Sitzordnung, in: Symbole des Alltags - Alltag der Symbole. Fest-