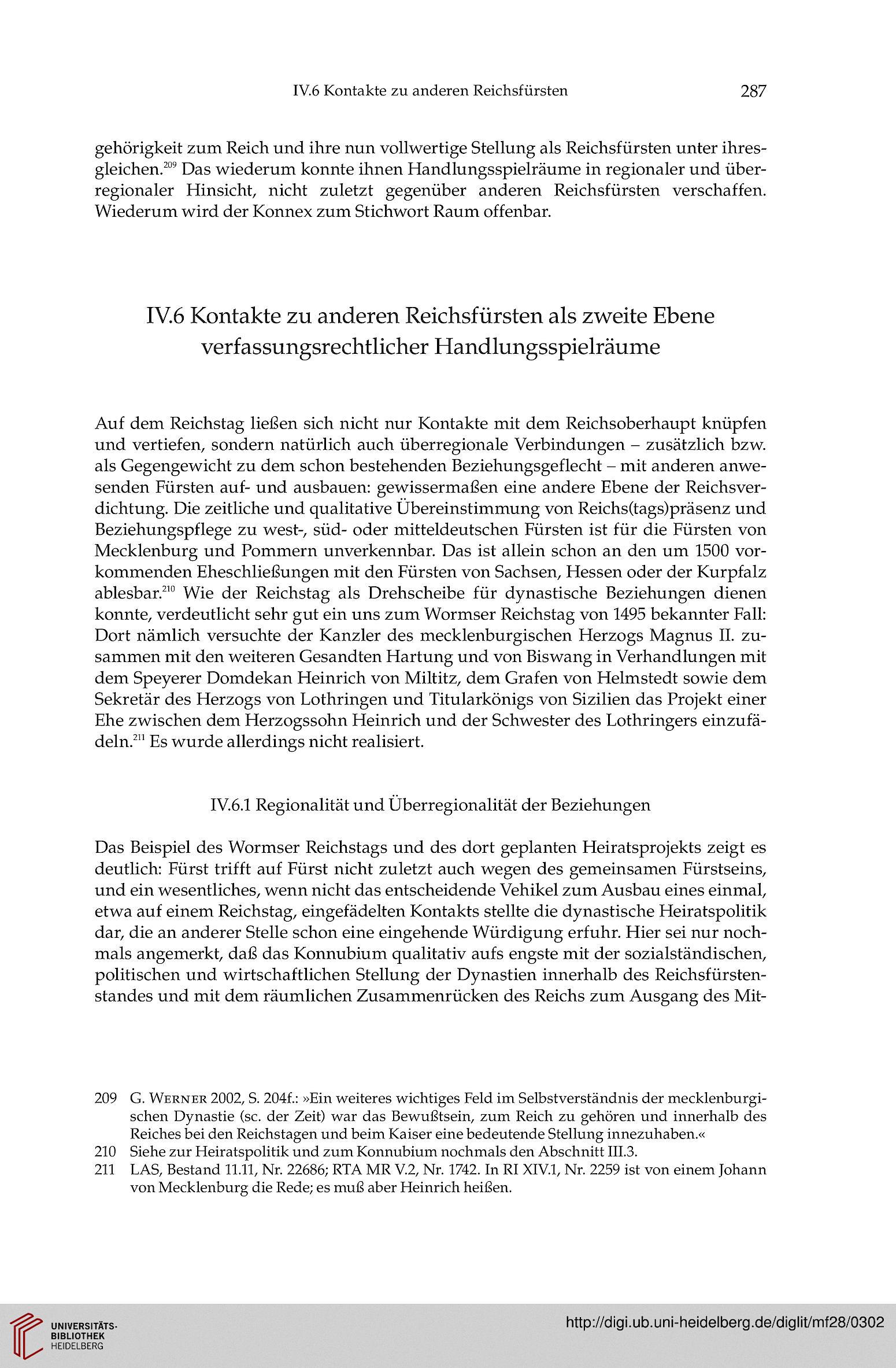IV.6 Kontakte zu anderen Reichsfürsten
287
gehörigkeit zum Reich und ihre nun vollwertige Stellung als Reichsfürsten unter ihres-
gleichen.'" Das wiederum konnte ihnen Handlungsspielräume in regionaler und über-
regionaler Hinsicht, nicht zuletzt gegenüber anderen Reichsfürsten verschaffen.
Wiederum wird der Konnex zum Stichwort Raum offenbar.
IV.6 Kontakte zu anderen Reichsfürsten als zweite Ebene
verfassungsrechtlicher Handlungsspielräume
Auf dem Reichstag ließen sich nicht nur Kontakte mit dem Reichsoberhaupt knüpfen
und vertiefen, sondern natürlich auch überregionale Verbindungen - zusätzlich bzw.
als Gegengewicht zu dem schon bestehenden Beziehungsgeflecht - mit anderen anwe-
senden Fürsten auf- und ausbauen: gewissermaßen eine andere Ebene der Reichsver-
dichtung. Die zeitliche und qualitative Übereinstimmung von Reichs(tags)präsenz und
Beziehungspflege zu west-, süd- oder mitteldeutschen Fürsten ist für die Fürsten von
Mecklenburg und Pommern unverkennbar. Das ist allein schon an den um 1500 vor-
kommenden Eheschließungen mit den Fürsten von Sachsen, Hessen oder der Kurpfalz
ablesbar.'*" Wie der Reichstag als Drehscheibe für dynastische Beziehungen dienen
konnte, verdeutlicht sehr gut ein uns zum Wormser Reichstag von 1495 bekannter Fall:
Dort nämlich versuchte der Kanzler des mecklenburgischen Herzogs Magnus II. zu-
sammen mit den weiteren Gesandten Hartung und von Biswang in Verhandlungen mit
dem Speyerer Domdekan Heinrich von Miltitz, dem Grafen von Helmstedt sowie dem
Sekretär des Herzogs von Lothringen und Titularkönigs von Sizilien das Projekt einer
Ehe zwischen dem Herzogssohn Heinrich und der Schwester des Lothringers einzufä-
delnr" Es wurde allerdings nicht realisiert.
IV.6.1 Regionalität und Überregionalität der Beziehungen
Das Beispiel des Wormser Reichstags und des dort geplanten Heiratsprojekts zeigt es
deutlich: Fürst trifft auf Fürst nicht zuletzt auch wegen des gemeinsamen Fürstseins,
und ein wesentliches, wenn nicht das entscheidende Vehikel zum Ausbau eines einmal,
etwa auf einem Reichstag, eingefädelten Kontakts stellte die dynastische Heiratspolitik
dar, die an anderer Stelle schon eine eingehende Würdigung erfuhr. Hier sei nur noch-
mals angemerkt, daß das Konnubium qualitativ aufs engste mit der sozialständischen,
politischen und wirtschaftlichen Stellung der Dynastien innerhalb des Reichsfürsten-
standes und mit dem räumlichen Zusammenrücken des Reichs zum Ausgang des Mit-
209 G. WERNER 2002, S. 204f.: »Ein weiteres wichtiges Feld im Seibstverständnis der mecklenburgi-
schen Dynastie (sc. der Zeit) war das Bewußtsein, zum Reich zu gehören und innerhalb des
Reiches bei den Reichstagen und beim Kaiser eine bedeutende Stellung innezuhaben.«
210 Siehe zur Heiratspolitik und zum Konnubium nochmals den Abschnitt 111.3.
211 LAS, Bestand 11.11, Nr. 22686; RTA MR V.2, Nr. 1742. In RI XIV.l, Nr. 2259 ist von einem Johann
von Mecklenburg die Rede; es muß aber Heinrich heißen.
287
gehörigkeit zum Reich und ihre nun vollwertige Stellung als Reichsfürsten unter ihres-
gleichen.'" Das wiederum konnte ihnen Handlungsspielräume in regionaler und über-
regionaler Hinsicht, nicht zuletzt gegenüber anderen Reichsfürsten verschaffen.
Wiederum wird der Konnex zum Stichwort Raum offenbar.
IV.6 Kontakte zu anderen Reichsfürsten als zweite Ebene
verfassungsrechtlicher Handlungsspielräume
Auf dem Reichstag ließen sich nicht nur Kontakte mit dem Reichsoberhaupt knüpfen
und vertiefen, sondern natürlich auch überregionale Verbindungen - zusätzlich bzw.
als Gegengewicht zu dem schon bestehenden Beziehungsgeflecht - mit anderen anwe-
senden Fürsten auf- und ausbauen: gewissermaßen eine andere Ebene der Reichsver-
dichtung. Die zeitliche und qualitative Übereinstimmung von Reichs(tags)präsenz und
Beziehungspflege zu west-, süd- oder mitteldeutschen Fürsten ist für die Fürsten von
Mecklenburg und Pommern unverkennbar. Das ist allein schon an den um 1500 vor-
kommenden Eheschließungen mit den Fürsten von Sachsen, Hessen oder der Kurpfalz
ablesbar.'*" Wie der Reichstag als Drehscheibe für dynastische Beziehungen dienen
konnte, verdeutlicht sehr gut ein uns zum Wormser Reichstag von 1495 bekannter Fall:
Dort nämlich versuchte der Kanzler des mecklenburgischen Herzogs Magnus II. zu-
sammen mit den weiteren Gesandten Hartung und von Biswang in Verhandlungen mit
dem Speyerer Domdekan Heinrich von Miltitz, dem Grafen von Helmstedt sowie dem
Sekretär des Herzogs von Lothringen und Titularkönigs von Sizilien das Projekt einer
Ehe zwischen dem Herzogssohn Heinrich und der Schwester des Lothringers einzufä-
delnr" Es wurde allerdings nicht realisiert.
IV.6.1 Regionalität und Überregionalität der Beziehungen
Das Beispiel des Wormser Reichstags und des dort geplanten Heiratsprojekts zeigt es
deutlich: Fürst trifft auf Fürst nicht zuletzt auch wegen des gemeinsamen Fürstseins,
und ein wesentliches, wenn nicht das entscheidende Vehikel zum Ausbau eines einmal,
etwa auf einem Reichstag, eingefädelten Kontakts stellte die dynastische Heiratspolitik
dar, die an anderer Stelle schon eine eingehende Würdigung erfuhr. Hier sei nur noch-
mals angemerkt, daß das Konnubium qualitativ aufs engste mit der sozialständischen,
politischen und wirtschaftlichen Stellung der Dynastien innerhalb des Reichsfürsten-
standes und mit dem räumlichen Zusammenrücken des Reichs zum Ausgang des Mit-
209 G. WERNER 2002, S. 204f.: »Ein weiteres wichtiges Feld im Seibstverständnis der mecklenburgi-
schen Dynastie (sc. der Zeit) war das Bewußtsein, zum Reich zu gehören und innerhalb des
Reiches bei den Reichstagen und beim Kaiser eine bedeutende Stellung innezuhaben.«
210 Siehe zur Heiratspolitik und zum Konnubium nochmals den Abschnitt 111.3.
211 LAS, Bestand 11.11, Nr. 22686; RTA MR V.2, Nr. 1742. In RI XIV.l, Nr. 2259 ist von einem Johann
von Mecklenburg die Rede; es muß aber Heinrich heißen.