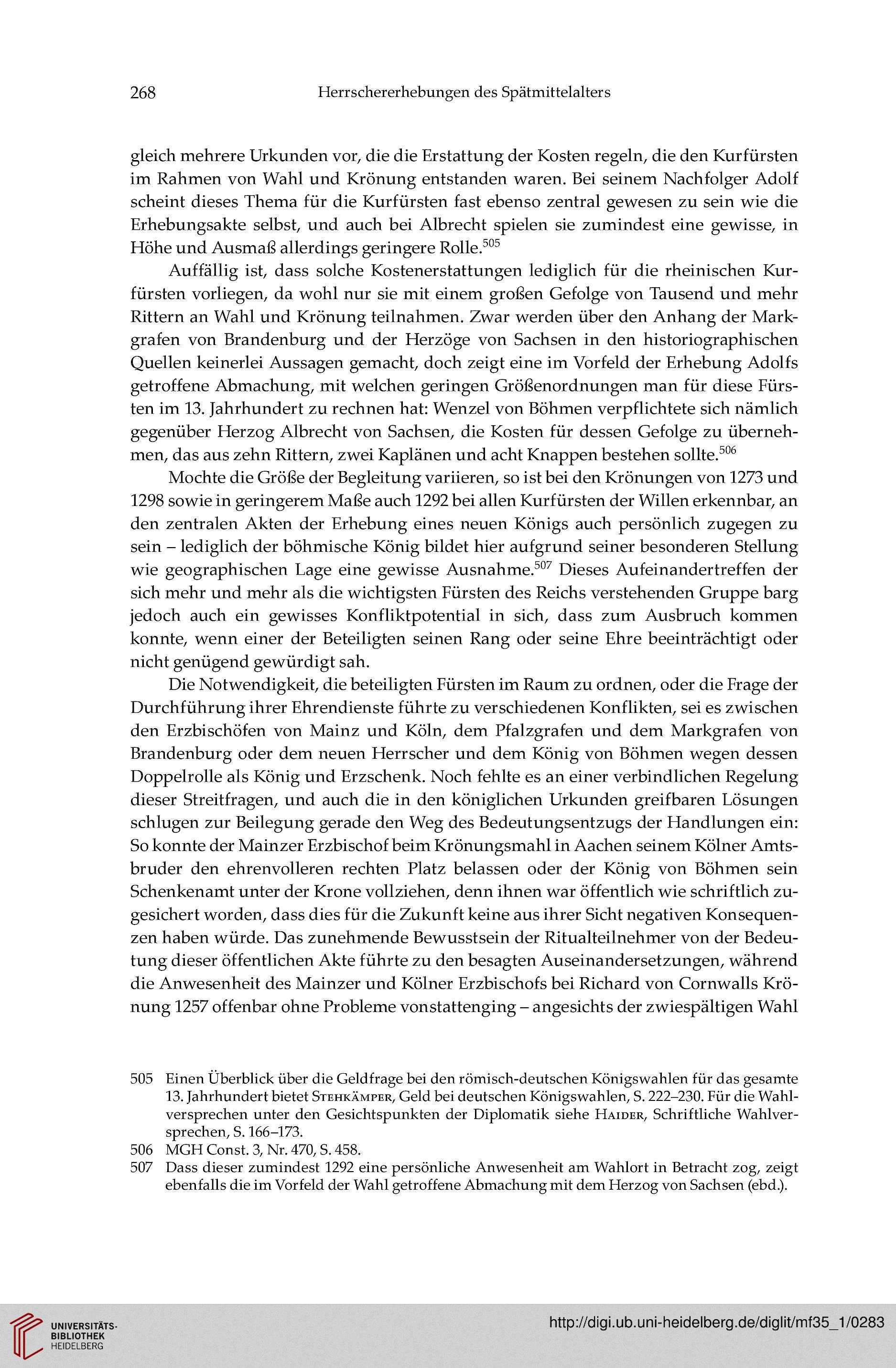268
Herrschererhebungen des Spätmittelalters
gleich mehrere Urkunden vor, die die Erstattung der Kosten regeln, die den Kurfürsten
im Rahmen von Wahl und Krönung entstanden waren. Bei seinem Nachfolger Adolf
scheint dieses Thema für die Kurfürsten fast ebenso zentral gewesen zu sein wie die
Erhebungsakte selbst, und auch bei Albrecht spielen sie zumindest eine gewisse, in
Höhe und Ausmaß allerdings geringere Rolle.'"'
Auffällig ist, dass solche Kostenerstattungen lediglich für die rheinischen Kur-
fürsten vorliegen, da wohl nur sie mit einem großen Gefolge von Tausend und mehr
Rittern an Wahl und Krönung teilnahmen. Zwar werden über den Anhang der Mark-
grafen von Brandenburg und der Herzoge von Sachsen in den historiographischen
Quellen keinerlei Aussagen gemacht, doch zeigt eine im Vorfeld der Erhebung Adolfs
getroffene Abmachung, mit welchen geringen Größenordnungen man für diese Fürs-
ten im 13. Jahrhundert zu rechnen hat: Wenzel von Böhmen verpflichtete sich nämlich
gegenüber Herzog Albrecht von Sachsen, die Kosten für dessen Gefolge zu überneh-
men, das aus zehn Rittern, zwei Kaplänen und acht Knappen bestehen sollte."""
Mochte die Größe der Begleitung variieren, so ist bei den Krönungen von 1273 und
1298 sowie in geringerem Maße auch 1292 bei allen Kurfürsten der Willen erkennbar, an
den zentralen Akten der Erhebung eines neuen Königs auch persönlich zugegen zu
sein - lediglich der böhmische König bildet hier aufgrund seiner besonderen Stellung
wie geographischen Lage eine gewisse Ausnahme.""^ Dieses Aufeinandertreffen der
sich mehr und mehr als die wichtigsten Fürsten des Reichs verstehenden Gruppe barg
jedoch auch ein gewisses Konfliktpotential in sich, dass zum Ausbruch kommen
konnte, wenn einer der Beteiligten seinen Rang oder seine Ehre beeinträchtigt oder
nicht genügend gewürdigt sah.
Die Notwendigkeit, die beteiligten Fürsten im Raum zu ordnen, oder die Frage der
Durchführung ihrer Ehrendienste führte zu verschiedenen Konflikten, sei es zwischen
den Erzbischöfen von Mainz und Köln, dem Pfalzgrafen und dem Markgrafen von
Brandenburg oder dem neuen Herrscher und dem König von Böhmen wegen dessen
Doppelrolle als König und Erzschenk. Noch fehlte es an einer verbindlichen Regelung
dieser Streitfragen, und auch die in den königlichen Urkunden greifbaren Lösungen
schlugen zur Beilegung gerade den Weg des Bedeutungsentzugs der Handlungen ein:
So konnte der Mainzer Erzbischof beim Krönungsmahl in Aachen seinem Kölner Amts-
bruder den ehrenvolleren rechten Platz belassen oder der König von Böhmen sein
Schenkenamt unter der Krone vollziehen, denn ihnen war öffentlich wie schriftlich zu-
gesichert worden, dass dies für die Zukunft keine aus ihrer Sicht negativen Konsequen-
zen haben würde. Das zunehmende Bewusstsein der Ritualteilnehmer von der Bedeu-
tung dieser öffentlichen Akte führte zu den besagten Auseinandersetzungen, während
die Anwesenheit des Mainzer und Kölner Erzbischofs bei Richard von Cornwalls Krö-
nung 1257 offenbar ohne Probleme vonstattenging - angesichts der zwiespältigen Wahl
505 Einen Überblick über die Geldfrage bei den römisch-deutschen Königswahlen für das gesamte
13. Jahrhundert bietet STEHKÄMPER, Geld bei deutschen Königswahlen, S. 222-230. Für die Wahl-
versprechen unter den Gesichtspunkten der Diplomatik siehe HAIDER, Schriftliche Wahlver-
sprechen, S. 166-173.
506 MGH Const. 3, Nr. 470, S. 458.
507 Dass dieser zumindest 1292 eine persönliche Anwesenheit am Wahlort in Betracht zog, zeigt
ebenfalls die im Vorfeld der Wahl getroffene Abmachung mit dem Herzog von Sachsen (ebd.).
Herrschererhebungen des Spätmittelalters
gleich mehrere Urkunden vor, die die Erstattung der Kosten regeln, die den Kurfürsten
im Rahmen von Wahl und Krönung entstanden waren. Bei seinem Nachfolger Adolf
scheint dieses Thema für die Kurfürsten fast ebenso zentral gewesen zu sein wie die
Erhebungsakte selbst, und auch bei Albrecht spielen sie zumindest eine gewisse, in
Höhe und Ausmaß allerdings geringere Rolle.'"'
Auffällig ist, dass solche Kostenerstattungen lediglich für die rheinischen Kur-
fürsten vorliegen, da wohl nur sie mit einem großen Gefolge von Tausend und mehr
Rittern an Wahl und Krönung teilnahmen. Zwar werden über den Anhang der Mark-
grafen von Brandenburg und der Herzoge von Sachsen in den historiographischen
Quellen keinerlei Aussagen gemacht, doch zeigt eine im Vorfeld der Erhebung Adolfs
getroffene Abmachung, mit welchen geringen Größenordnungen man für diese Fürs-
ten im 13. Jahrhundert zu rechnen hat: Wenzel von Böhmen verpflichtete sich nämlich
gegenüber Herzog Albrecht von Sachsen, die Kosten für dessen Gefolge zu überneh-
men, das aus zehn Rittern, zwei Kaplänen und acht Knappen bestehen sollte."""
Mochte die Größe der Begleitung variieren, so ist bei den Krönungen von 1273 und
1298 sowie in geringerem Maße auch 1292 bei allen Kurfürsten der Willen erkennbar, an
den zentralen Akten der Erhebung eines neuen Königs auch persönlich zugegen zu
sein - lediglich der böhmische König bildet hier aufgrund seiner besonderen Stellung
wie geographischen Lage eine gewisse Ausnahme.""^ Dieses Aufeinandertreffen der
sich mehr und mehr als die wichtigsten Fürsten des Reichs verstehenden Gruppe barg
jedoch auch ein gewisses Konfliktpotential in sich, dass zum Ausbruch kommen
konnte, wenn einer der Beteiligten seinen Rang oder seine Ehre beeinträchtigt oder
nicht genügend gewürdigt sah.
Die Notwendigkeit, die beteiligten Fürsten im Raum zu ordnen, oder die Frage der
Durchführung ihrer Ehrendienste führte zu verschiedenen Konflikten, sei es zwischen
den Erzbischöfen von Mainz und Köln, dem Pfalzgrafen und dem Markgrafen von
Brandenburg oder dem neuen Herrscher und dem König von Böhmen wegen dessen
Doppelrolle als König und Erzschenk. Noch fehlte es an einer verbindlichen Regelung
dieser Streitfragen, und auch die in den königlichen Urkunden greifbaren Lösungen
schlugen zur Beilegung gerade den Weg des Bedeutungsentzugs der Handlungen ein:
So konnte der Mainzer Erzbischof beim Krönungsmahl in Aachen seinem Kölner Amts-
bruder den ehrenvolleren rechten Platz belassen oder der König von Böhmen sein
Schenkenamt unter der Krone vollziehen, denn ihnen war öffentlich wie schriftlich zu-
gesichert worden, dass dies für die Zukunft keine aus ihrer Sicht negativen Konsequen-
zen haben würde. Das zunehmende Bewusstsein der Ritualteilnehmer von der Bedeu-
tung dieser öffentlichen Akte führte zu den besagten Auseinandersetzungen, während
die Anwesenheit des Mainzer und Kölner Erzbischofs bei Richard von Cornwalls Krö-
nung 1257 offenbar ohne Probleme vonstattenging - angesichts der zwiespältigen Wahl
505 Einen Überblick über die Geldfrage bei den römisch-deutschen Königswahlen für das gesamte
13. Jahrhundert bietet STEHKÄMPER, Geld bei deutschen Königswahlen, S. 222-230. Für die Wahl-
versprechen unter den Gesichtspunkten der Diplomatik siehe HAIDER, Schriftliche Wahlver-
sprechen, S. 166-173.
506 MGH Const. 3, Nr. 470, S. 458.
507 Dass dieser zumindest 1292 eine persönliche Anwesenheit am Wahlort in Betracht zog, zeigt
ebenfalls die im Vorfeld der Wahl getroffene Abmachung mit dem Herzog von Sachsen (ebd.).