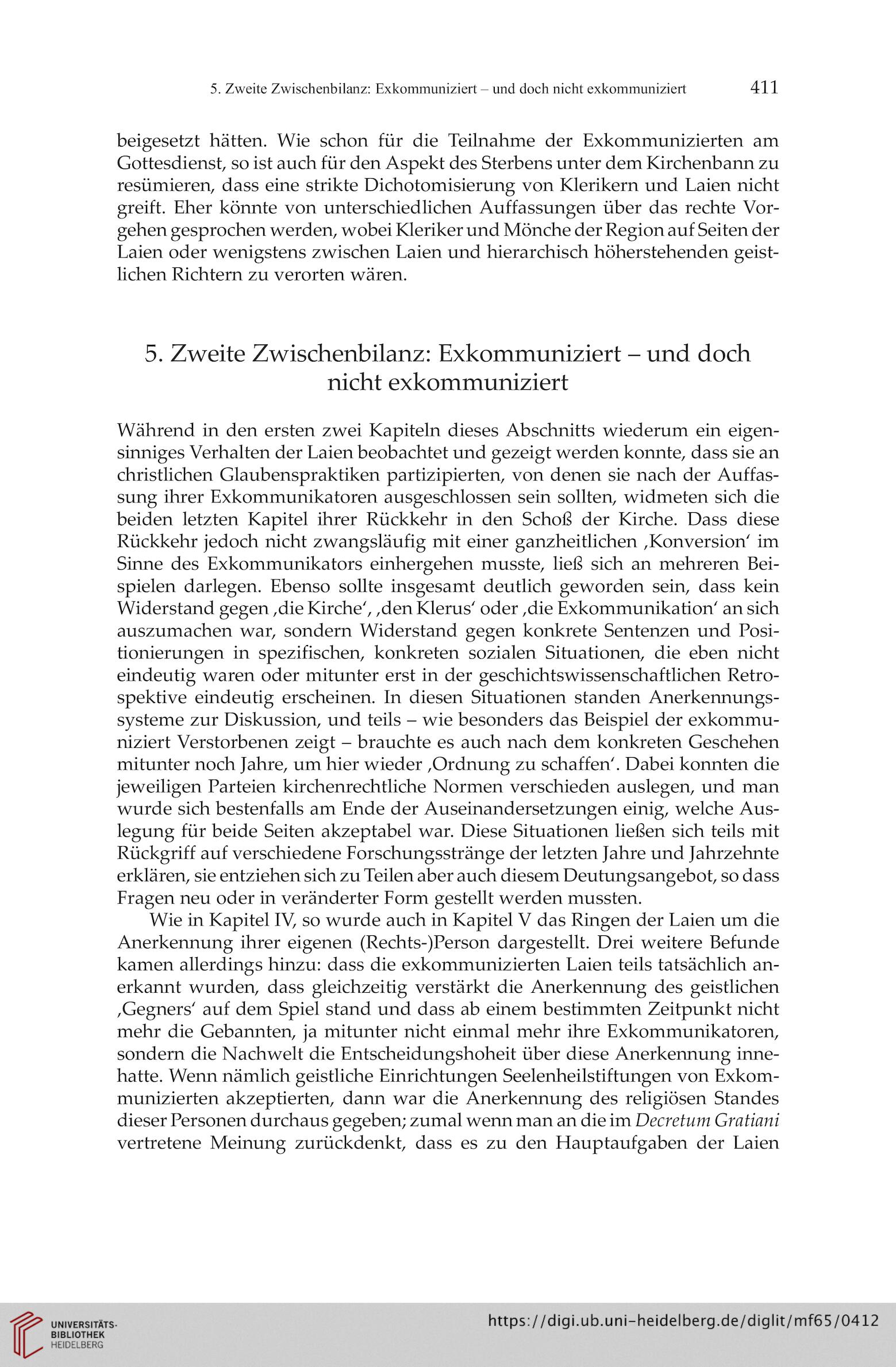5. Zweite Zwischenbilanz: Exkommuniziert - und doch nicht exkommuniziert
411
beigesetzt hätten. Wie schon für die Teilnahme der Exkommunizierten am
Gottesdienst so ist auch für den Aspekt des Sterbens unter dem Kirchenbann zu
resümieren, dass eine strikte Dichotomisierung von Klerikern und Laien nicht
greift. Eher könnte von unterschiedlichen Auffassungen über das rechte Vor-
gehen gesprochen werden, wobei Kleriker und Mönche der Region auf Seiten der
Laien oder wenigstens zwischen Laien und hierarchisch höherstehenden geist-
lichen Richtern zu verorten wären.
5. Zweite Zwischenbilanz: Exkommuniziert - und doch
nicht exkommuniziert
Während in den ersten zwei Kapiteln dieses Abschnitts wiederum ein eigen-
sinniges Verhalten der Laien beobachtet und gezeigt werden konnte, dass sie an
christlichen Glaubenspraktiken partizipierten, von denen sie nach der Auffas-
sung ihrer Exkommunikatoren ausgeschlossen sein sollten, widmeten sich die
beiden letzten Kapitel ihrer Rückkehr in den Schoß der Kirche. Dass diese
Rückkehr jedoch nicht zwangsläufig mit einer ganzheitlichen ,Konversion' im
Sinne des Exkommunikators einhergehen musste, ließ sich an mehreren Bei-
spielen darlegen. Ebenso sollte insgesamt deutlich geworden sein, dass kein
Widerstand gegen ,die Kirche', ,den Klerus' oder ,die Exkommunikation' an sich
auszumachen war, sondern Widerstand gegen konkrete Sentenzen und Posi-
tionierungen in spezifischen, konkreten sozialen Situationen, die eben nicht
eindeutig waren oder mitunter erst in der geschichtswissenschaftlichen Retro-
spektive eindeutig erscheinen. In diesen Situationen standen Anerkennungs-
systeme zur Diskussion, und teils - wie besonders das Beispiel der exkommu-
niziert Verstorbenen zeigt - brauchte es auch nach dem konkreten Geschehen
mitunter noch Jahre, um hier wieder ,Ordnung zu schaffen'. Dabei konnten die
jeweiligen Parteien kirchenrechtliche Normen verschieden auslegen, und man
wurde sich bestenfalls am Ende der Auseinandersetzungen einig, welche Aus-
legung für beide Seiten akzeptabel war. Diese Situationen ließen sich teils mit
Rückgriff auf verschiedene Forschungsstränge der letzten Jahre und Jahrzehnte
erklären, sie entziehen sich zu Teilen aber auch diesem Deutungsangebot, so dass
Fragen neu oder in veränderter Form gestellt werden mussten.
Wie in Kapitel IV, so wurde auch in Kapitel V das Ringen der Laien um die
Anerkennung ihrer eigenen (Rechts-)Person dargestellt. Drei weitere Befunde
kamen allerdings hinzu: dass die exkommunizierten Laien teils tatsächlich an-
erkannt wurden, dass gleichzeitig verstärkt die Anerkennung des geistlichen
, Gegners' auf dem Spiel stand und dass ab einem bestimmten Zeitpunkt nicht
mehr die Gebannten, ja mitunter nicht einmal mehr ihre Exkommunikatoren,
sondern die Nachwelt die Entscheidungshoheit über diese Anerkennung inne-
hatte. Wenn nämlich geistliche Einrichtungen Seelenheilstiftungen von Exkom-
munizierten akzeptierten, dann war die Anerkennung des religiösen Standes
dieser Personen durchaus gegeben; zumal wenn man an die im Decretum Gratiani
vertretene Meinung zurückdenkt, dass es zu den Hauptaufgaben der Laien
411
beigesetzt hätten. Wie schon für die Teilnahme der Exkommunizierten am
Gottesdienst so ist auch für den Aspekt des Sterbens unter dem Kirchenbann zu
resümieren, dass eine strikte Dichotomisierung von Klerikern und Laien nicht
greift. Eher könnte von unterschiedlichen Auffassungen über das rechte Vor-
gehen gesprochen werden, wobei Kleriker und Mönche der Region auf Seiten der
Laien oder wenigstens zwischen Laien und hierarchisch höherstehenden geist-
lichen Richtern zu verorten wären.
5. Zweite Zwischenbilanz: Exkommuniziert - und doch
nicht exkommuniziert
Während in den ersten zwei Kapiteln dieses Abschnitts wiederum ein eigen-
sinniges Verhalten der Laien beobachtet und gezeigt werden konnte, dass sie an
christlichen Glaubenspraktiken partizipierten, von denen sie nach der Auffas-
sung ihrer Exkommunikatoren ausgeschlossen sein sollten, widmeten sich die
beiden letzten Kapitel ihrer Rückkehr in den Schoß der Kirche. Dass diese
Rückkehr jedoch nicht zwangsläufig mit einer ganzheitlichen ,Konversion' im
Sinne des Exkommunikators einhergehen musste, ließ sich an mehreren Bei-
spielen darlegen. Ebenso sollte insgesamt deutlich geworden sein, dass kein
Widerstand gegen ,die Kirche', ,den Klerus' oder ,die Exkommunikation' an sich
auszumachen war, sondern Widerstand gegen konkrete Sentenzen und Posi-
tionierungen in spezifischen, konkreten sozialen Situationen, die eben nicht
eindeutig waren oder mitunter erst in der geschichtswissenschaftlichen Retro-
spektive eindeutig erscheinen. In diesen Situationen standen Anerkennungs-
systeme zur Diskussion, und teils - wie besonders das Beispiel der exkommu-
niziert Verstorbenen zeigt - brauchte es auch nach dem konkreten Geschehen
mitunter noch Jahre, um hier wieder ,Ordnung zu schaffen'. Dabei konnten die
jeweiligen Parteien kirchenrechtliche Normen verschieden auslegen, und man
wurde sich bestenfalls am Ende der Auseinandersetzungen einig, welche Aus-
legung für beide Seiten akzeptabel war. Diese Situationen ließen sich teils mit
Rückgriff auf verschiedene Forschungsstränge der letzten Jahre und Jahrzehnte
erklären, sie entziehen sich zu Teilen aber auch diesem Deutungsangebot, so dass
Fragen neu oder in veränderter Form gestellt werden mussten.
Wie in Kapitel IV, so wurde auch in Kapitel V das Ringen der Laien um die
Anerkennung ihrer eigenen (Rechts-)Person dargestellt. Drei weitere Befunde
kamen allerdings hinzu: dass die exkommunizierten Laien teils tatsächlich an-
erkannt wurden, dass gleichzeitig verstärkt die Anerkennung des geistlichen
, Gegners' auf dem Spiel stand und dass ab einem bestimmten Zeitpunkt nicht
mehr die Gebannten, ja mitunter nicht einmal mehr ihre Exkommunikatoren,
sondern die Nachwelt die Entscheidungshoheit über diese Anerkennung inne-
hatte. Wenn nämlich geistliche Einrichtungen Seelenheilstiftungen von Exkom-
munizierten akzeptierten, dann war die Anerkennung des religiösen Standes
dieser Personen durchaus gegeben; zumal wenn man an die im Decretum Gratiani
vertretene Meinung zurückdenkt, dass es zu den Hauptaufgaben der Laien