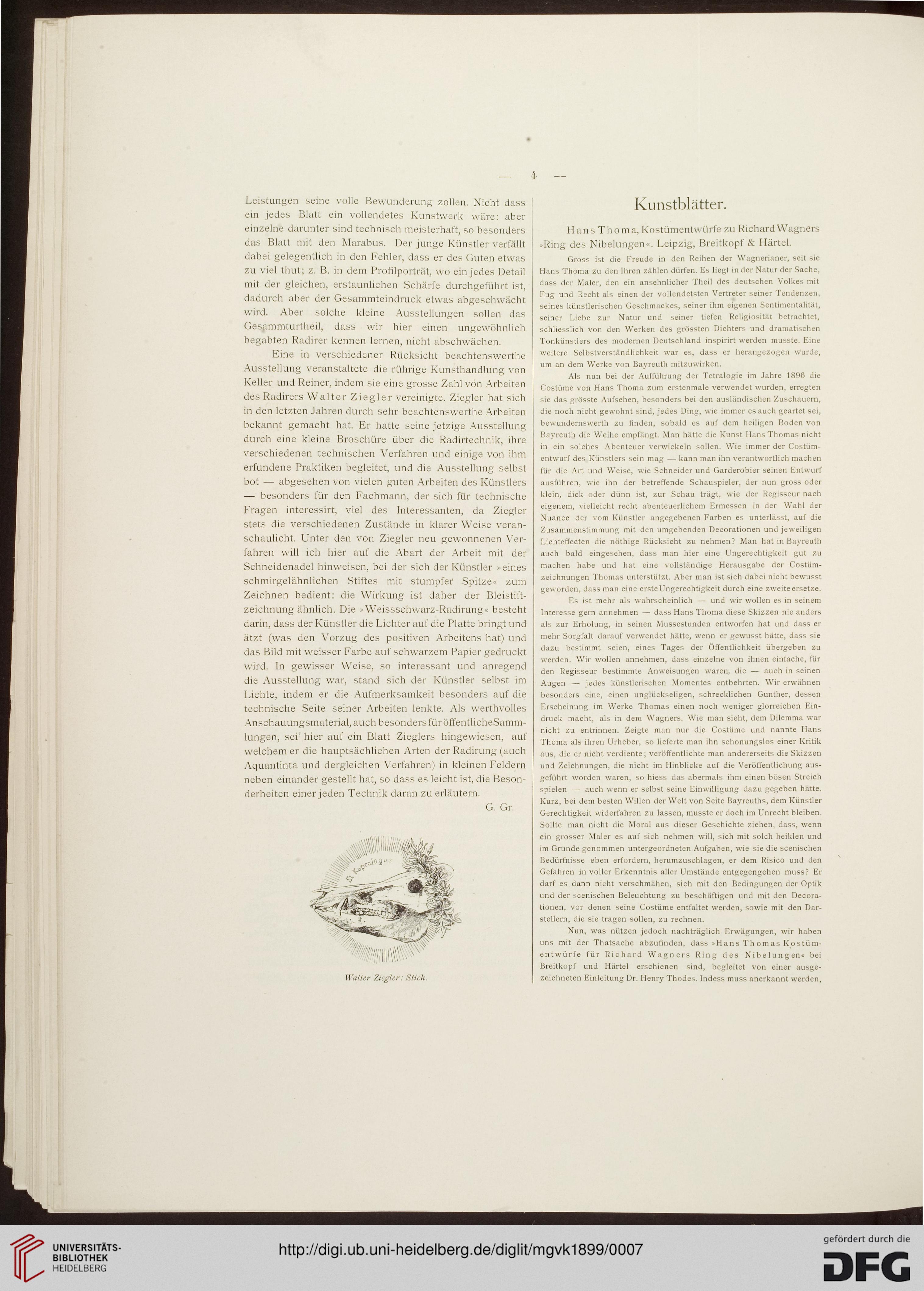— 4
Leistungen seine volle Bewunderung zollen. Nicht dass
ein jedes Blatt ein vollendetes Kunstwerk wäre: aber
einzelne darunter sind technisch meisterhaft, so besonders
das Blatt mit den Marabus. Der junge Künstler verfällt
dabei gelegentlich in den Fehler, dass er des Guten etwas
zu viel thut; z. B. in dem Profilporträt, wo ein jedes Detail
mit der gleichen, erstaunlichen Schärfe durchgeführt ist,
dadurch aber der Gesammteindruck etwas abgeschwächt
wird. Aber solche kleine Ausstellungen sollen das
Gesammturtheil, dass wir hier einen ungewöhnlich
begabten Radirer kennen lernen, nicht abschwächen.
Eine in verschiedener Rücksicht beachtenswerthe
Ausstellung veranstaltete die rührige Kunsthandlung von
Keller und Reiner, indem sie eine grosse Zahl von Arbeiten
des Radirers Walter Ziegler vereinigte. Ziegler hat sich
in den letzten Jahren durch sehr beachtenswerthe Arbeiten
bekannt gemacht hat. Er hatte seine jetzige Ausstellung
durch eine kleine Broschüre über die Radirtechnik, ihre
verschiedenen technischen Verfahren und einige von ihm
erfundene Praktiken begleitet, und die Ausstellung selbst
bot — abgesehen von vielen guten Arbeiten des Künstlers
— besonders für den Fachmann, der sich für technische
Fragen interessirt, viel des Interessanten, da Ziegler
stets die verschiedenen Zustände in klarer Weise veran-
schaulicht. Unter den von Ziegler neu gewonnenen Ver-
fahren will ich hier auf die Abart der Arbeit mit der
Schneidenadel hinweisen, bei der sich der Künstler »eines
schmirgelähnlichen Stiftes mit stumpfer Spitze« zum
Zeichnen bedient: die Wirkung ist daher der Bleistift-
zeichnung ähnlich. Die »Weissschwarz-Radirung« besteht
darin, dass der Künstler die Lichter auf die Platte bringt und
ätzt (was den Vorzug des positiven Arbeitens hat) und
das Bild mit weisser Farbe auf schwarzem Papier gedruckt
wird. In gewisser Weise, so interessant und anregend
die Ausstellung war, stand sich der Künstler selbst im
Lichte, indem er die Aufmerksamkeit besonders auf die
technische Seite seiner Arbeiten lenkte. Als werthvolles
Anschauungsmaterial, auch besonders für öffentlicheSamm-
lungen, sei hier auf ein Blatt Zieglers hingewiesen, auf
welchem er die hauptsächlichen Arten der Radirung (auch
Aquantinta und dergleichen Verfahren) in kleinen Feldern
neben einander gestellt hat, so dass es leicht ist, die Beson-
derheiten einer jeden Technik daran zu erläutern.
G Gr
Ä>^
Walter Zicglcr: Stak
Kunstblätter.
HansThoma, Kostümentwürfe zu Richard Wagners
»Ring des Nibelungen«. Leipzig, Breitkopf & Hartel.
Gross ist die Freude in den Reihen der Wagnerianer, seit sie
Hans Thoma zu den Ihren zählen dürfen. Es liegt in der Natur der Sache,
dass der Maler, den ein ansehnlicher Theil des deutschen Volkes mit
Fug und Recht als einen der vollendetsten Vertreter seiner Tendenzen,
seines künstlerischen Geschmackes, seiner ihm eigenen Sentimentalität,
seiner Liehe zur Natur und seiner tiefen Religiosität betrachtet,
schliesslich von den Werken des grössten Dichters und dramatischen
Tonkünstlers des modernen Deutschland inspirirt werden musste. Eine
weitere Selbstverständlichkeit war es, dass er herangezogen wurde,
um an dem Werke von Bayreuth mitzuwirken.
Als nun bei der Aufführung der Tetralogie im Jahre 1896 die
Costüme von Hans Thoma zum erstenmale verwendet wurden, erregten
sie das grösste Aufsehen, besonders bei den ausländischen Zuschauern,
die noch nicht gewohnt sind, jedes Ding, wie immer es auch geartet sei,
bewundernswerth zu finden, sobald es auf dem heiligen Boden von
Bayreuth die Weihe empfängt. Man hätte die Kunst Hans Thomas nicht
in ein solches Abenteuer verwickeln sollen. Wie immer der Costüm-
entwurf des Künstlers sein mag — kann man ihn verantwortlich machen
für die Art und Weise, wie Schneider und Garderobier seinen Entwurf
ausführen, wie ihn der betreffende Schauspieler, der nun gross oder
klein, dick oder dünn ist, zur Schau trägt, wie der Regisseur nach
eigenem, vielleicht recht abenteuerlichem Ermessen in der Wahl der
Nuance der vom Künstler angegebenen Farben es unterlässt, auf die
Zusammenstimmung mit den umgebenden Decorationen und jeweiligen
Lichteffecten die nöthige Rücksicht zu nehmen? Man hat in Bayreuth
auch bald eingesehen, dass man hier eine Ungerechtigkeit gut zu
machen habe und hat eine vollständige Herausgabe der Costürn-
zeichnungen Thomas unterstützt. Aber man ist sich dabei nicht bevvusst
geworden, dass man eine erste Ungerechtigkeit durch eine zweite ersetze.
Es ist mehr als wahrscheinlich — und wir wollen es in seinem
Interesse gern annehmen — dass Hans Thoma diese Skizzen nie anders
als zur Erholung, in seinen Mussestunden entworfen hat und dass er
mehr Sorgfalt darauf verwendet hätte, wenn er gewusst hätte, dass sie
dazu bestimmt seien, eines Tages der Öffentlichkeit übergeben zu
werden. Wir wollen annehmen, dass einzelne von ihnen einfache, für
den Regisseur bestimmte Anweisungen waren, die — auch in seinen
Augen — jedes künstlerischen Momentes entbehrten. Wir erwähnen
besonders eine, einen unglückseligen, schrecklichen Günther, dessen
Erscheinung im Werke Thomas einen noch weniger glorreichen Ein-
druck macht, als in dem Wagners. Wie man sieht, dem Dilemma war
nicht zu entrinnen. Zeigte man nur die Costüme und nannte Hans
Thoma als ihren Urheber, so lieferte man ihn schonungslos einer Kritik
aus, die er nicht verdiente; veröffentlichte man andererseits die Skizzen
und Zeichnungen, die nicht im Hinblicke auf die Veröffentlichung aus-
geführt worden waren, so hiess das abermals ihm einen bösen Streich
spielen — auch wenn er selbst seine Einwilligung dazu gegeben hätte.
Kurz, bei dem besten Willen der Welt von Seite Bayreuths, dem Künstler
Gerechtigkeit widerfahren zu lassen, musste er doch im Unrecht bleiben.
Sollte man nicht die Moral aus dieser Geschichte ziehen, dass, wenn
ein grosser Maler es auf sich nehmen will, sich mit solch heiklen und
im Grunde genommen untergeordneten Aufgaben, wie sie die scenischen
Bedürfnisse eben erfordern, herumzuschlagen, er dem Risico und den
Gefahren in voller Erkenntnis aller Umstände entgegengehen muss? Er
darf es dann nicht verschmähen, sich mit den Bedingungen der Optik
und der scenischen Beleuchtung zu beschäftigen und mit den Decora-
tionen, vor denen seine Costüme entfaltet werden, sowie mit den Dar-
stellern, die sie tragen sollen, zu rechnen.
Nun, was nützen jedoch nachträglich Erwägungen, wir haben
uns mit der Thatsache abzufinden, dass »Hans Thomas Kostüm-
entwürfe für Richard Wagners Ring des Nibelungen« bei
Breitkopf und Härtel erschienen sind, begleitet von einer ausge-
zeichneten Einleitung Dr. Henry Thodes. Indess muss anerkannt werden,
Leistungen seine volle Bewunderung zollen. Nicht dass
ein jedes Blatt ein vollendetes Kunstwerk wäre: aber
einzelne darunter sind technisch meisterhaft, so besonders
das Blatt mit den Marabus. Der junge Künstler verfällt
dabei gelegentlich in den Fehler, dass er des Guten etwas
zu viel thut; z. B. in dem Profilporträt, wo ein jedes Detail
mit der gleichen, erstaunlichen Schärfe durchgeführt ist,
dadurch aber der Gesammteindruck etwas abgeschwächt
wird. Aber solche kleine Ausstellungen sollen das
Gesammturtheil, dass wir hier einen ungewöhnlich
begabten Radirer kennen lernen, nicht abschwächen.
Eine in verschiedener Rücksicht beachtenswerthe
Ausstellung veranstaltete die rührige Kunsthandlung von
Keller und Reiner, indem sie eine grosse Zahl von Arbeiten
des Radirers Walter Ziegler vereinigte. Ziegler hat sich
in den letzten Jahren durch sehr beachtenswerthe Arbeiten
bekannt gemacht hat. Er hatte seine jetzige Ausstellung
durch eine kleine Broschüre über die Radirtechnik, ihre
verschiedenen technischen Verfahren und einige von ihm
erfundene Praktiken begleitet, und die Ausstellung selbst
bot — abgesehen von vielen guten Arbeiten des Künstlers
— besonders für den Fachmann, der sich für technische
Fragen interessirt, viel des Interessanten, da Ziegler
stets die verschiedenen Zustände in klarer Weise veran-
schaulicht. Unter den von Ziegler neu gewonnenen Ver-
fahren will ich hier auf die Abart der Arbeit mit der
Schneidenadel hinweisen, bei der sich der Künstler »eines
schmirgelähnlichen Stiftes mit stumpfer Spitze« zum
Zeichnen bedient: die Wirkung ist daher der Bleistift-
zeichnung ähnlich. Die »Weissschwarz-Radirung« besteht
darin, dass der Künstler die Lichter auf die Platte bringt und
ätzt (was den Vorzug des positiven Arbeitens hat) und
das Bild mit weisser Farbe auf schwarzem Papier gedruckt
wird. In gewisser Weise, so interessant und anregend
die Ausstellung war, stand sich der Künstler selbst im
Lichte, indem er die Aufmerksamkeit besonders auf die
technische Seite seiner Arbeiten lenkte. Als werthvolles
Anschauungsmaterial, auch besonders für öffentlicheSamm-
lungen, sei hier auf ein Blatt Zieglers hingewiesen, auf
welchem er die hauptsächlichen Arten der Radirung (auch
Aquantinta und dergleichen Verfahren) in kleinen Feldern
neben einander gestellt hat, so dass es leicht ist, die Beson-
derheiten einer jeden Technik daran zu erläutern.
G Gr
Ä>^
Walter Zicglcr: Stak
Kunstblätter.
HansThoma, Kostümentwürfe zu Richard Wagners
»Ring des Nibelungen«. Leipzig, Breitkopf & Hartel.
Gross ist die Freude in den Reihen der Wagnerianer, seit sie
Hans Thoma zu den Ihren zählen dürfen. Es liegt in der Natur der Sache,
dass der Maler, den ein ansehnlicher Theil des deutschen Volkes mit
Fug und Recht als einen der vollendetsten Vertreter seiner Tendenzen,
seines künstlerischen Geschmackes, seiner ihm eigenen Sentimentalität,
seiner Liehe zur Natur und seiner tiefen Religiosität betrachtet,
schliesslich von den Werken des grössten Dichters und dramatischen
Tonkünstlers des modernen Deutschland inspirirt werden musste. Eine
weitere Selbstverständlichkeit war es, dass er herangezogen wurde,
um an dem Werke von Bayreuth mitzuwirken.
Als nun bei der Aufführung der Tetralogie im Jahre 1896 die
Costüme von Hans Thoma zum erstenmale verwendet wurden, erregten
sie das grösste Aufsehen, besonders bei den ausländischen Zuschauern,
die noch nicht gewohnt sind, jedes Ding, wie immer es auch geartet sei,
bewundernswerth zu finden, sobald es auf dem heiligen Boden von
Bayreuth die Weihe empfängt. Man hätte die Kunst Hans Thomas nicht
in ein solches Abenteuer verwickeln sollen. Wie immer der Costüm-
entwurf des Künstlers sein mag — kann man ihn verantwortlich machen
für die Art und Weise, wie Schneider und Garderobier seinen Entwurf
ausführen, wie ihn der betreffende Schauspieler, der nun gross oder
klein, dick oder dünn ist, zur Schau trägt, wie der Regisseur nach
eigenem, vielleicht recht abenteuerlichem Ermessen in der Wahl der
Nuance der vom Künstler angegebenen Farben es unterlässt, auf die
Zusammenstimmung mit den umgebenden Decorationen und jeweiligen
Lichteffecten die nöthige Rücksicht zu nehmen? Man hat in Bayreuth
auch bald eingesehen, dass man hier eine Ungerechtigkeit gut zu
machen habe und hat eine vollständige Herausgabe der Costürn-
zeichnungen Thomas unterstützt. Aber man ist sich dabei nicht bevvusst
geworden, dass man eine erste Ungerechtigkeit durch eine zweite ersetze.
Es ist mehr als wahrscheinlich — und wir wollen es in seinem
Interesse gern annehmen — dass Hans Thoma diese Skizzen nie anders
als zur Erholung, in seinen Mussestunden entworfen hat und dass er
mehr Sorgfalt darauf verwendet hätte, wenn er gewusst hätte, dass sie
dazu bestimmt seien, eines Tages der Öffentlichkeit übergeben zu
werden. Wir wollen annehmen, dass einzelne von ihnen einfache, für
den Regisseur bestimmte Anweisungen waren, die — auch in seinen
Augen — jedes künstlerischen Momentes entbehrten. Wir erwähnen
besonders eine, einen unglückseligen, schrecklichen Günther, dessen
Erscheinung im Werke Thomas einen noch weniger glorreichen Ein-
druck macht, als in dem Wagners. Wie man sieht, dem Dilemma war
nicht zu entrinnen. Zeigte man nur die Costüme und nannte Hans
Thoma als ihren Urheber, so lieferte man ihn schonungslos einer Kritik
aus, die er nicht verdiente; veröffentlichte man andererseits die Skizzen
und Zeichnungen, die nicht im Hinblicke auf die Veröffentlichung aus-
geführt worden waren, so hiess das abermals ihm einen bösen Streich
spielen — auch wenn er selbst seine Einwilligung dazu gegeben hätte.
Kurz, bei dem besten Willen der Welt von Seite Bayreuths, dem Künstler
Gerechtigkeit widerfahren zu lassen, musste er doch im Unrecht bleiben.
Sollte man nicht die Moral aus dieser Geschichte ziehen, dass, wenn
ein grosser Maler es auf sich nehmen will, sich mit solch heiklen und
im Grunde genommen untergeordneten Aufgaben, wie sie die scenischen
Bedürfnisse eben erfordern, herumzuschlagen, er dem Risico und den
Gefahren in voller Erkenntnis aller Umstände entgegengehen muss? Er
darf es dann nicht verschmähen, sich mit den Bedingungen der Optik
und der scenischen Beleuchtung zu beschäftigen und mit den Decora-
tionen, vor denen seine Costüme entfaltet werden, sowie mit den Dar-
stellern, die sie tragen sollen, zu rechnen.
Nun, was nützen jedoch nachträglich Erwägungen, wir haben
uns mit der Thatsache abzufinden, dass »Hans Thomas Kostüm-
entwürfe für Richard Wagners Ring des Nibelungen« bei
Breitkopf und Härtel erschienen sind, begleitet von einer ausge-
zeichneten Einleitung Dr. Henry Thodes. Indess muss anerkannt werden,