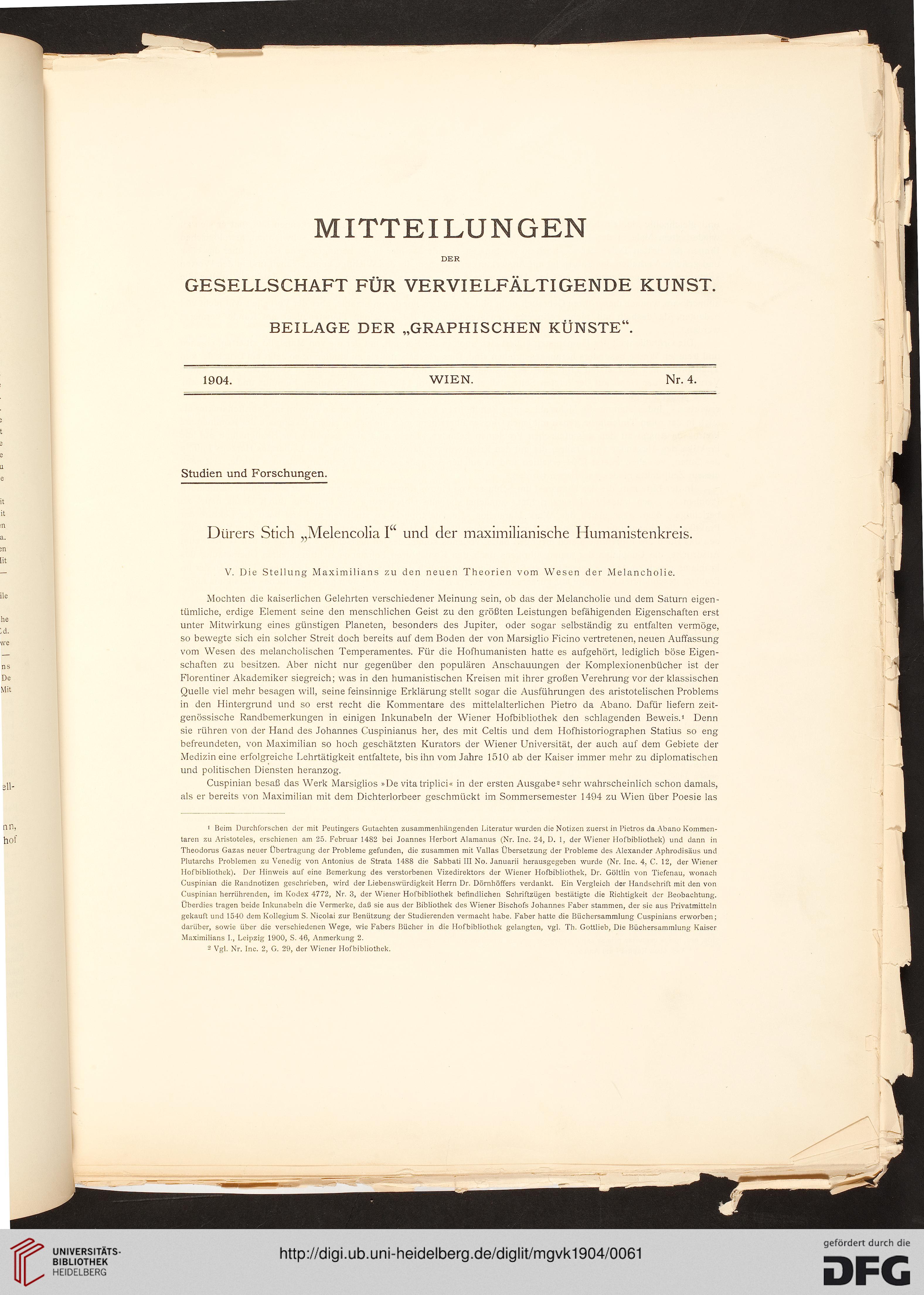MITTEILUNGEN
DER
GESELLSCHAFT FÜR VERVIELFÄLTIGENDE KUNST.
BEILAGE DER „GRAPHISCHEN KÜNSTE".
1904. WIEN. Nr. 4.
Studien und Forschungen.
Dürers Stich „Melencolia I" und der maximilianische Humanistenkreis.
V. Die Stellung Maximilians zu den neuen Theorien vom Wesen der Melancholie.
Mochten die kaiserlichen Gelehrten verschiedener Meinung sein, ob das der Melancholie und dem Saturn eigen-
tümliche, erdige Element seine den menschlichen Geist zu den größten Leistungen befähigenden Eigenschaften erst
unter Mitwirkung eines günstigen Planeten, besonders des Jupiter, oder sogar selbständig zu entfalten vermöge,
so bewegte sich ein solcher Streit doch bereits auf dem Boden der von Marsiglio Ficino vertretenen, neuen Auffassung
vom Wesen des melancholischen Temperamentes. Für die Hofhumanisten hatte es aufgehört, lediglich böse Eigen-
schaften zu besitzen. Aber nicht nur gegenüber den populären Anschauungen der Komplexionenbücher ist der
Florentiner Akademiker siegreich; was in den humanistischen Kreisen mit ihrer großen Verehrung vor der klassischen
Quelle viel mehr besagen will, seine feinsinnige Erklärung stellt sogar die Ausführungen des aristotelischen Problems
in den Hintergrund und so erst recht die Kommentare des mittelalterlichen Pietro da Abano. Dafür liefern zeit-
genössische Randbemerkungen in einigen Inkunabeln der Wiener Hofbibliothek den schlagenden Beweis.1 Denn
sie rühren von der Hand des Johannes Cuspinianus her, des mit Celtis und dem Hofhistoriographen Statius so eng
befreundeten, von Maximilian so hoch geschätzten Kurators der Wiener Universität, der auch auf dem Gebiete der
Medizin eine erfolgreiche Lehrtätigkeit entfaltete, bis ihn vom Jahre 1510 ab der Kaiser immer mehr zu diplomatischen
und politischen Diensten heranzog.
Cuspinian besaß das Werk Marsiglios »De vita triplici« in der ersten Ausgabe3 sehr wahrscheinlich schon damals,
als er bereits von Maximilian mit dem Dichterlorbeer geschmückt im Sommersemester 1494 zu Wien über Poesie las
' Beim Durchforschen der mit Peutingers Gutachten zusammenhängenden Literatur wurden die Notizen zuerst in Pietros da Abano Kommen-
taren zu Aristoteles, erschienen am 25. Februar 1482 bei Joannes Herbort Alamanus (Nr. Inc. 24, D. 1, der Wiener Hofbibliothek) und dann in
Theodoras Gazas neuer Übertragung der Probleme gefunden, die zusammen mit Vallas Übersetzung der Probleme des Alexander Aphrodisäus und
Plutarchs Problemen zu Venedig von Antonius de Strata 1488 die Sabbati III No. Januarii herausgegeben wurde (Nr. Inc. 4, C. 12, der Wiener
Hofbibliothek). Der Hinweis auf eine Bemerkung des verstorbenen Vizedirektors der Wiener Hofbibliothek, Dr. Göltlin von Tiefenau, wonach
Cuspinian die Randnotizen geschrieben, wird der Liebenswürdigkeit Herrn Dr. Dörnhöffers verdankt. Ein Vergleich der Handschrift mit den von
Cuspinian herrührenden, im Kodex 4772, Nr. 3, der Wiener Hofbibliothek befindlichen Schriftzügen bestätigte die Richtigkeit der Beobachtung.
Überdies tragen beide Inkunabeln die Vermerke, daß sie aus der Bibliothek des Wiener Bischofs Johannes Faber stammen, der sie aus Privatmitteln
gekauft und 1540 dem Kollegium S. Nicolai zur Benützung der Studierenden vermacht habe. Faber hatte die Büchersammlung Cuspinians erworben;
darüber, sowie über die verschiedenen Wege, wie Fabers Bücher in die Hofbibliothek gelangten, vgl. Th. Gottlieb, Die Büchersammlung Kaiser
Maximilians I., Leipzig 1900, S. 46, Anmerkung 2.
2 Vgl. Nr. Inc. 2, G. 29, der Wiener Hofbibliothek.
DER
GESELLSCHAFT FÜR VERVIELFÄLTIGENDE KUNST.
BEILAGE DER „GRAPHISCHEN KÜNSTE".
1904. WIEN. Nr. 4.
Studien und Forschungen.
Dürers Stich „Melencolia I" und der maximilianische Humanistenkreis.
V. Die Stellung Maximilians zu den neuen Theorien vom Wesen der Melancholie.
Mochten die kaiserlichen Gelehrten verschiedener Meinung sein, ob das der Melancholie und dem Saturn eigen-
tümliche, erdige Element seine den menschlichen Geist zu den größten Leistungen befähigenden Eigenschaften erst
unter Mitwirkung eines günstigen Planeten, besonders des Jupiter, oder sogar selbständig zu entfalten vermöge,
so bewegte sich ein solcher Streit doch bereits auf dem Boden der von Marsiglio Ficino vertretenen, neuen Auffassung
vom Wesen des melancholischen Temperamentes. Für die Hofhumanisten hatte es aufgehört, lediglich böse Eigen-
schaften zu besitzen. Aber nicht nur gegenüber den populären Anschauungen der Komplexionenbücher ist der
Florentiner Akademiker siegreich; was in den humanistischen Kreisen mit ihrer großen Verehrung vor der klassischen
Quelle viel mehr besagen will, seine feinsinnige Erklärung stellt sogar die Ausführungen des aristotelischen Problems
in den Hintergrund und so erst recht die Kommentare des mittelalterlichen Pietro da Abano. Dafür liefern zeit-
genössische Randbemerkungen in einigen Inkunabeln der Wiener Hofbibliothek den schlagenden Beweis.1 Denn
sie rühren von der Hand des Johannes Cuspinianus her, des mit Celtis und dem Hofhistoriographen Statius so eng
befreundeten, von Maximilian so hoch geschätzten Kurators der Wiener Universität, der auch auf dem Gebiete der
Medizin eine erfolgreiche Lehrtätigkeit entfaltete, bis ihn vom Jahre 1510 ab der Kaiser immer mehr zu diplomatischen
und politischen Diensten heranzog.
Cuspinian besaß das Werk Marsiglios »De vita triplici« in der ersten Ausgabe3 sehr wahrscheinlich schon damals,
als er bereits von Maximilian mit dem Dichterlorbeer geschmückt im Sommersemester 1494 zu Wien über Poesie las
' Beim Durchforschen der mit Peutingers Gutachten zusammenhängenden Literatur wurden die Notizen zuerst in Pietros da Abano Kommen-
taren zu Aristoteles, erschienen am 25. Februar 1482 bei Joannes Herbort Alamanus (Nr. Inc. 24, D. 1, der Wiener Hofbibliothek) und dann in
Theodoras Gazas neuer Übertragung der Probleme gefunden, die zusammen mit Vallas Übersetzung der Probleme des Alexander Aphrodisäus und
Plutarchs Problemen zu Venedig von Antonius de Strata 1488 die Sabbati III No. Januarii herausgegeben wurde (Nr. Inc. 4, C. 12, der Wiener
Hofbibliothek). Der Hinweis auf eine Bemerkung des verstorbenen Vizedirektors der Wiener Hofbibliothek, Dr. Göltlin von Tiefenau, wonach
Cuspinian die Randnotizen geschrieben, wird der Liebenswürdigkeit Herrn Dr. Dörnhöffers verdankt. Ein Vergleich der Handschrift mit den von
Cuspinian herrührenden, im Kodex 4772, Nr. 3, der Wiener Hofbibliothek befindlichen Schriftzügen bestätigte die Richtigkeit der Beobachtung.
Überdies tragen beide Inkunabeln die Vermerke, daß sie aus der Bibliothek des Wiener Bischofs Johannes Faber stammen, der sie aus Privatmitteln
gekauft und 1540 dem Kollegium S. Nicolai zur Benützung der Studierenden vermacht habe. Faber hatte die Büchersammlung Cuspinians erworben;
darüber, sowie über die verschiedenen Wege, wie Fabers Bücher in die Hofbibliothek gelangten, vgl. Th. Gottlieb, Die Büchersammlung Kaiser
Maximilians I., Leipzig 1900, S. 46, Anmerkung 2.
2 Vgl. Nr. Inc. 2, G. 29, der Wiener Hofbibliothek.