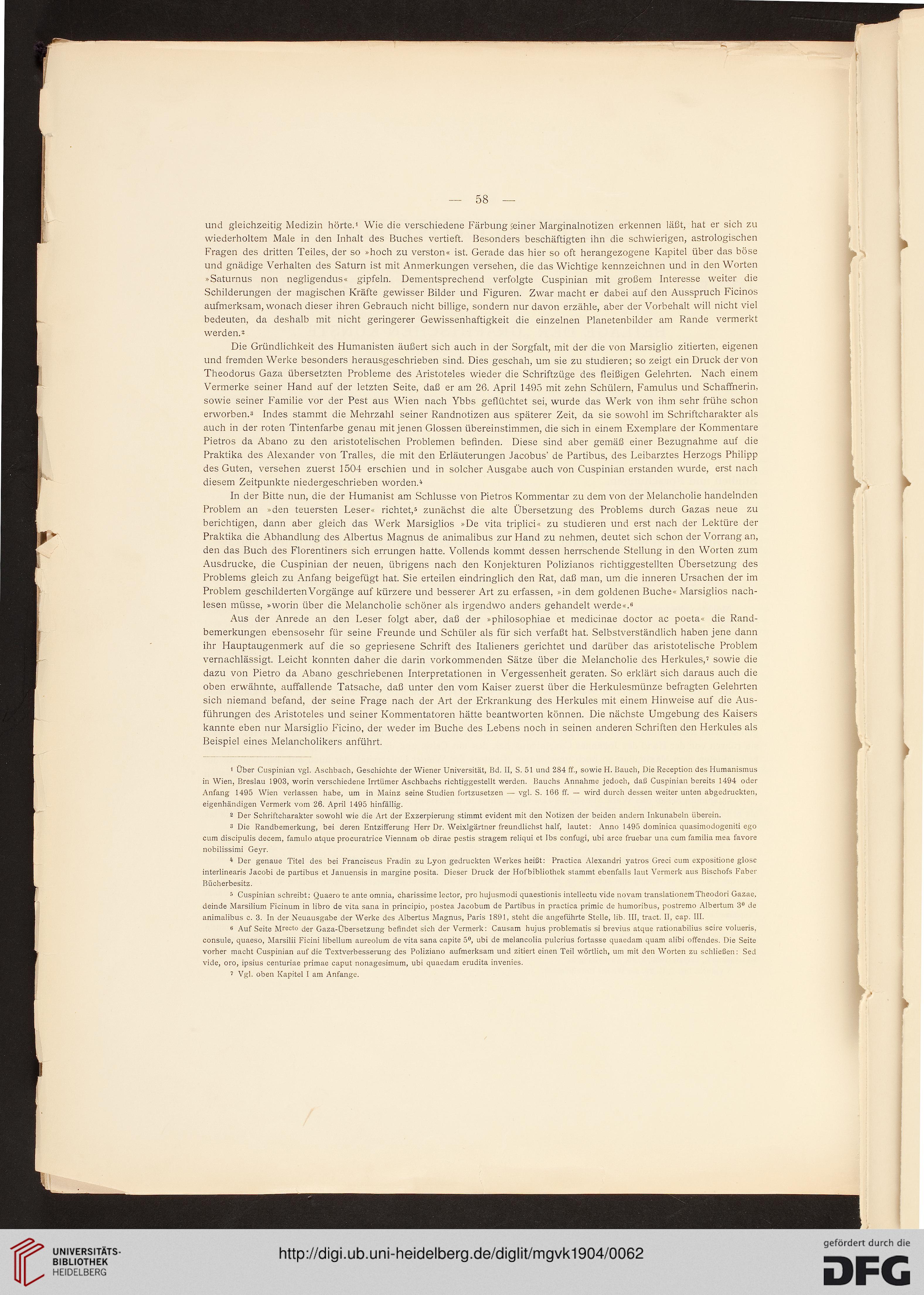— 58 —
und gleichzeitig Medizin hörte.1 Wie die verschiedene Färbung seiner Marginalnotizen erkennen läßt, hat er sich zu
wiederholtem Male in den Inhalt des Buches vertieft. Besonders beschäftigten ihn die schwierigen, astrologischen
Fragen des dritten Teiles, der so »hoch zu verston« ist. Gerade das hier so oft herangezogene Kapitel über das böse
und gnädige Verhalten des Saturn ist mit Anmerkungen versehen, die das Wichtige kennzeichnen und in den Worten
»Saturnus non negligendus« gipfeln. Dementsprechend verfolgte Cuspinian mit großem Interesse weiter die
Schilderungen der magischen Kräfte gewisser Bilder und Figuren. Zwar macht er dabei auf den Ausspruch Ficinos
aufmerksam, wonach dieser ihren Gebrauch nicht billige, sondern nur davon erzähle, aber der Vorbehalt will nicht viel
bedeuten, da deshalb mit nicht geringerer Gewissenhaftigkeit die einzelnen Planetenbilder am Rande vermerkt
werden.2
Die Gründlichkeit des Humanisten äußert sich auch in der Sorgfalt, mit der die von Marsiglio zitierten, eigenen
und fremden Werke besonders herausgeschrieben sind. Dies geschah, um sie zu studieren; so zeigt ein Druck der von
Theodorus Gaza übersetzten Probleme des Aristoteles wieder die Schriftzüge des fleißigen Gelehrten. Nach einem
Vermerke seiner Hand auf der letzten Seite, daß er am 26. April 1495 mit zehn Schülern, Famulus und Schaffnerin,
sowie seiner Familie vor der Pest aus Wien nach Ybbs geflüchtet sei, wurde das Werk von ihm sehr frühe schon
erworben.» Indes stammt die Mehrzahl seiner Randnotizen aus späterer Zeit, da sie sowohl im Schriftcharakter als
auch in der roten Tintenfarbe genau mit jenen Glossen übereinstimmen, die sich in einem Exemplare der Kommentare
Pietros da Abano zu den aristotelischen Problemen befinden. Diese sind aber gemäß einer Bezugnahme auf die
Praktika des Alexander von Tralles, die mit den Erläuterungen Jacobus' de Partibus, des Leibarztes Herzogs Philipp
des Guten, versehen zuerst 1504 erschien und in solcher Ausgabe auch von Cuspinian erstanden wurde, erst nach
diesem Zeitpunkte niedergeschrieben worden.*
In der Bitte nun, die der Humanist am Schlüsse von Pietros Kommentar zu dem von der Melancholie handelnden
Problem an »den teuersten Leser« richtet,5 zunächst die alte Übersetzung des Problems durch Gazas neue zu
berichtigen, dann aber gleich das Werk Marsiglios »De vita triplici« zu studieren und erst nach der Lektüre der
Praktika die Abhandlung des Albertus Magnus de animalibus zur Hand zu nehmen, deutet sich schon der Vorrang an,
den das Buch des Florentiners sich errungen hatte. Vollends kommt dessen herrschende Stellung in den Worten zum
Ausdrucke, die Cuspinian der neuen, übrigens nach den Konjekturen Polizianos richtiggestellten Übersetzung des
Problems gleich zu Anfang beigefügt hat. Sie erteilen eindringlich den Rat, daß man, um die inneren Ursachen der im
Problem geschilderten Vorgänge auf kürzere und besserer Art zu erfassen, »in dem goldenen Buche« Marsiglios nach-
lesen müsse, »worin über die Melancholie schöner als irgendwo anders gehandelt werde«.fi
Aus der Anrede an den Leser folgt aber, daß der »philosophiae et medicinae doctor ac poeta« die Rand-
bemerkungen ebensosehr für seine Freunde und Schüler als für sich verfaßt hat. Selbstverständlich haben jene dann
ihr Hauptaugenmerk auf die so gepriesene Schrift des Italieners gerichtet und darüber das aristotelische Problem
vernachlässigt. Leicht konnten daher die darin vorkommenden Sätze über die Melancholie des Herkules,7 sowie die
dazu von Pietro da Abano geschriebenen Interpretationen in Vergessenheit geraten. So erklärt sich daraus auch die
oben erwähnte, auffallende Tatsache, daß unter den vom Kaiser zuerst über die Herkulesmünze befragten Gelehrten
sich niemand befand, der seine Frage nach der Art der Erkrankung des Herkules mit einem Hinweise auf die Aus-
führungen des Aristoteles und seiner Kommentatoren hätte beantworten können. Die nächste Umgebung des Kaisers
kannte eben nur Marsiglio Ficino, der weder im Buche des Lebens noch in seinen anderen Schriften den Herkules als
Beispiel eines Melancholikers anführt.
1 Über Cuspinian vgl. Aschbach, Geschichte der Wiener Universität, Bd. II, S. 51 und 284 ff., sowie H. Bauch, Die Reception des Humanismus
in Wien, Breslau 1903, worin verschiedene Irrtümer Aschbachs richtiggestellt werden. Bauchs Annahme jedoch, daß Cuspinian bereits 1494 oder
Anfang 1495 Wien verlassen habe, um in Mainz seine Studien fortzusetzen — vgl. S. 166 ff. — wird durch dessen weiter unten abgedruckten,
eigenhändigen Vermerk vom 26. April 1495 hinfällig.
2 Der Schriftcharakter sowohl wie die Art der Exzerpierung stimmt evident mit den Notizen der beiden andern Inkunabeln überein.
3 Die Randbemerkung, bei deren Entzifferung Herr Dr. Weixlgärtner freundlichst half, lautet: Anno 1495 dominica quasimodogeniti ego
cum discipulis decem, famulo atque procuratrice Viennam ob dirae pestis stragem reliqui et Ibs confugi, ubi arce fruebar una cum familia mea favore
nobilissimi Geyr.
* Der genaue Titel des bei Franciscus Fradin zu Lyon gedruckten Werkes heißt: Practica Alexandri yatros Greci cum expositione glosc
interlinearis Jacobi de partibus et Januensis in margine posita. Dieser Druck der Hofbibliothek stammt ebenfalls laut Vermerk aus Bischofs Faber
Bücherbesitz.
5 Cuspinian schreibt: Quaero te ante omnia, charissime lector, pro hujusmodi quaestionis intellectu vide novam translationemTheodori Gazae.
deinde Marsilium Ficinum in libro de vita sana in principio, postea Jacobum de Partibus in practica primic de humoribus, postremo Albertum 3° de
animalibus c. 3. In der Neuausgabe der Werke des Albertus Magnus, Paris 1891, steht die angeführte Stelle, lib. III, tract. II, cap. III.
6 Auf Seite Mrecto der Gaza-Übersetzung befindet sich der Vermerk: Causam hujus problematis si brevius atque rationabilius scire volueris.
consule, quaeso, Marsilii Ficini libellum aureolum de vita sana capite 5°, ubi de melancolia pulcrius fortasse quaedam quam alibi offendes. Die Seite
vorher macht Cuspinian auf die Textverbesserung des Poliziano aufmerksam und zitiert einen Teil wörtlich, um mit den Worten zu schließen: Sed
vide, oro, ipsius centuriae primae caput nonagesimum, ubi quaedam erudita invenies.
7 Vgl. oben Kapitel I am Anfange.
und gleichzeitig Medizin hörte.1 Wie die verschiedene Färbung seiner Marginalnotizen erkennen läßt, hat er sich zu
wiederholtem Male in den Inhalt des Buches vertieft. Besonders beschäftigten ihn die schwierigen, astrologischen
Fragen des dritten Teiles, der so »hoch zu verston« ist. Gerade das hier so oft herangezogene Kapitel über das böse
und gnädige Verhalten des Saturn ist mit Anmerkungen versehen, die das Wichtige kennzeichnen und in den Worten
»Saturnus non negligendus« gipfeln. Dementsprechend verfolgte Cuspinian mit großem Interesse weiter die
Schilderungen der magischen Kräfte gewisser Bilder und Figuren. Zwar macht er dabei auf den Ausspruch Ficinos
aufmerksam, wonach dieser ihren Gebrauch nicht billige, sondern nur davon erzähle, aber der Vorbehalt will nicht viel
bedeuten, da deshalb mit nicht geringerer Gewissenhaftigkeit die einzelnen Planetenbilder am Rande vermerkt
werden.2
Die Gründlichkeit des Humanisten äußert sich auch in der Sorgfalt, mit der die von Marsiglio zitierten, eigenen
und fremden Werke besonders herausgeschrieben sind. Dies geschah, um sie zu studieren; so zeigt ein Druck der von
Theodorus Gaza übersetzten Probleme des Aristoteles wieder die Schriftzüge des fleißigen Gelehrten. Nach einem
Vermerke seiner Hand auf der letzten Seite, daß er am 26. April 1495 mit zehn Schülern, Famulus und Schaffnerin,
sowie seiner Familie vor der Pest aus Wien nach Ybbs geflüchtet sei, wurde das Werk von ihm sehr frühe schon
erworben.» Indes stammt die Mehrzahl seiner Randnotizen aus späterer Zeit, da sie sowohl im Schriftcharakter als
auch in der roten Tintenfarbe genau mit jenen Glossen übereinstimmen, die sich in einem Exemplare der Kommentare
Pietros da Abano zu den aristotelischen Problemen befinden. Diese sind aber gemäß einer Bezugnahme auf die
Praktika des Alexander von Tralles, die mit den Erläuterungen Jacobus' de Partibus, des Leibarztes Herzogs Philipp
des Guten, versehen zuerst 1504 erschien und in solcher Ausgabe auch von Cuspinian erstanden wurde, erst nach
diesem Zeitpunkte niedergeschrieben worden.*
In der Bitte nun, die der Humanist am Schlüsse von Pietros Kommentar zu dem von der Melancholie handelnden
Problem an »den teuersten Leser« richtet,5 zunächst die alte Übersetzung des Problems durch Gazas neue zu
berichtigen, dann aber gleich das Werk Marsiglios »De vita triplici« zu studieren und erst nach der Lektüre der
Praktika die Abhandlung des Albertus Magnus de animalibus zur Hand zu nehmen, deutet sich schon der Vorrang an,
den das Buch des Florentiners sich errungen hatte. Vollends kommt dessen herrschende Stellung in den Worten zum
Ausdrucke, die Cuspinian der neuen, übrigens nach den Konjekturen Polizianos richtiggestellten Übersetzung des
Problems gleich zu Anfang beigefügt hat. Sie erteilen eindringlich den Rat, daß man, um die inneren Ursachen der im
Problem geschilderten Vorgänge auf kürzere und besserer Art zu erfassen, »in dem goldenen Buche« Marsiglios nach-
lesen müsse, »worin über die Melancholie schöner als irgendwo anders gehandelt werde«.fi
Aus der Anrede an den Leser folgt aber, daß der »philosophiae et medicinae doctor ac poeta« die Rand-
bemerkungen ebensosehr für seine Freunde und Schüler als für sich verfaßt hat. Selbstverständlich haben jene dann
ihr Hauptaugenmerk auf die so gepriesene Schrift des Italieners gerichtet und darüber das aristotelische Problem
vernachlässigt. Leicht konnten daher die darin vorkommenden Sätze über die Melancholie des Herkules,7 sowie die
dazu von Pietro da Abano geschriebenen Interpretationen in Vergessenheit geraten. So erklärt sich daraus auch die
oben erwähnte, auffallende Tatsache, daß unter den vom Kaiser zuerst über die Herkulesmünze befragten Gelehrten
sich niemand befand, der seine Frage nach der Art der Erkrankung des Herkules mit einem Hinweise auf die Aus-
führungen des Aristoteles und seiner Kommentatoren hätte beantworten können. Die nächste Umgebung des Kaisers
kannte eben nur Marsiglio Ficino, der weder im Buche des Lebens noch in seinen anderen Schriften den Herkules als
Beispiel eines Melancholikers anführt.
1 Über Cuspinian vgl. Aschbach, Geschichte der Wiener Universität, Bd. II, S. 51 und 284 ff., sowie H. Bauch, Die Reception des Humanismus
in Wien, Breslau 1903, worin verschiedene Irrtümer Aschbachs richtiggestellt werden. Bauchs Annahme jedoch, daß Cuspinian bereits 1494 oder
Anfang 1495 Wien verlassen habe, um in Mainz seine Studien fortzusetzen — vgl. S. 166 ff. — wird durch dessen weiter unten abgedruckten,
eigenhändigen Vermerk vom 26. April 1495 hinfällig.
2 Der Schriftcharakter sowohl wie die Art der Exzerpierung stimmt evident mit den Notizen der beiden andern Inkunabeln überein.
3 Die Randbemerkung, bei deren Entzifferung Herr Dr. Weixlgärtner freundlichst half, lautet: Anno 1495 dominica quasimodogeniti ego
cum discipulis decem, famulo atque procuratrice Viennam ob dirae pestis stragem reliqui et Ibs confugi, ubi arce fruebar una cum familia mea favore
nobilissimi Geyr.
* Der genaue Titel des bei Franciscus Fradin zu Lyon gedruckten Werkes heißt: Practica Alexandri yatros Greci cum expositione glosc
interlinearis Jacobi de partibus et Januensis in margine posita. Dieser Druck der Hofbibliothek stammt ebenfalls laut Vermerk aus Bischofs Faber
Bücherbesitz.
5 Cuspinian schreibt: Quaero te ante omnia, charissime lector, pro hujusmodi quaestionis intellectu vide novam translationemTheodori Gazae.
deinde Marsilium Ficinum in libro de vita sana in principio, postea Jacobum de Partibus in practica primic de humoribus, postremo Albertum 3° de
animalibus c. 3. In der Neuausgabe der Werke des Albertus Magnus, Paris 1891, steht die angeführte Stelle, lib. III, tract. II, cap. III.
6 Auf Seite Mrecto der Gaza-Übersetzung befindet sich der Vermerk: Causam hujus problematis si brevius atque rationabilius scire volueris.
consule, quaeso, Marsilii Ficini libellum aureolum de vita sana capite 5°, ubi de melancolia pulcrius fortasse quaedam quam alibi offendes. Die Seite
vorher macht Cuspinian auf die Textverbesserung des Poliziano aufmerksam und zitiert einen Teil wörtlich, um mit den Worten zu schließen: Sed
vide, oro, ipsius centuriae primae caput nonagesimum, ubi quaedam erudita invenies.
7 Vgl. oben Kapitel I am Anfange.