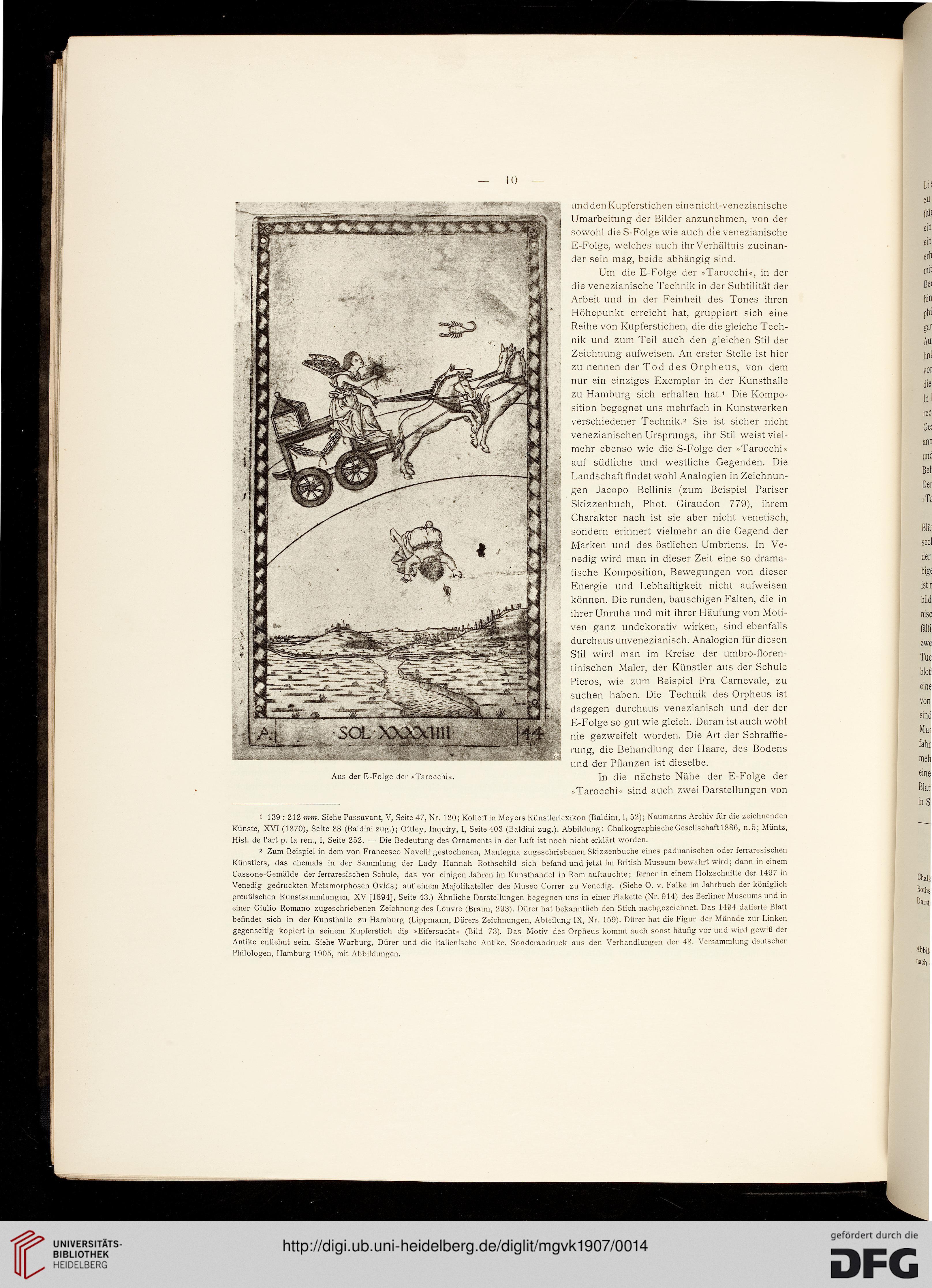I
■A|.
solxxxxim
Aus der E-Folge der »Tarocchi
und den Kupferstichen eine nicht-venezianische
Umarbeitung der Bilder anzunehmen, von der
sowohl die S-Folge wie auch die venezianische
E-Folge, welches auch ihr Verhältnis zueinan-
der sein mag, beide abhängig sind.
Um die E-Folge der »Tarocchi«, in der
die venezianische Technik in der Subtilität der
Arbeit und in der Feinheit des Tones ihren
Höhepunkt erreicht hat, gruppiert sich eine
Reihe von Kupferstichen, die die gleiche Tech-
nik und zum Teil auch den gleichen Stil der
Zeichnung aufweisen. An erster Stelle ist hier
zu nennen der Tod des Orpheus, von dem
nur ein einziges Exemplar in der Kunsthalle
zu Hamburg sich erhalten hat.1 Die Kompo-
sition begegnet uns mehrfach in Kunstwerken
verschiedener Technik.2 Sie ist sicher nicht
venezianischen Ursprungs, ihr Stil weist viel-
mehr ebenso wie die S-Folge der »Tarocchi«
auf südliche und westliche Gegenden. Die
Landschaft findet wohl Analogien in Zeichnun-
gen Jacopo Bellinis (zum Beispiel Pariser
Skizzenbuch, Phot. Giraudon 779), ihrem
Charakter nach ist sie aber nicht venetisch,
sondern erinnert vielmehr an die Gegend der
Marken und des östlichen Umbriens. In Ve-
nedig wird man in dieser Zeit eine so drama-
tische Komposition, Bewegungen von dieser
Energie und Lebhaftigkeit nicht aufweisen
können. Die runden, bauschigen Falten, die in
ihrer Unruhe und mit ihrer Häufung von Moti-
ven ganz undekorativ wirken, sind ebenfalls
durchaus unvenezianisch. Analogien für diesen
Stil wird man im Kreise der umbro-floren-
tinischen Maler, der Künstler aus der Schule
Pieros, wie zum Beispiel Fra Carnevale, zu
suchen haben. Die Technik des Orpheus ist
dagegen durchaus venezianisch und der der
E-Folge so gut wie gleich. Daran ist auch wohl
nie gezweifelt worden. Die Art der Schraffie-
rung, die Behandlung der Haare, des Bodens
und der Pflanzen ist dieselbe.
In die nächste Nähe der E-Folge der
»Tarocchi« sind auch zwei Darstellungen von
i 139 : 212»««. Siehe Passavant, V, Seite 47, Nr. 120; Kollosf in Meyers Künstlerlexikon (Baldini, I, 52); Naumanns Archiv für die zeichnenden
Künste, XVI (1870), Seite 88 (Baldini zug.); Ottley, Inquiry, I, Seite 403 (Baldini zug.). Abbildung; Chalkographische Gesellschaft 1886, n.ö; Müntz,
Hist. de l'art p. la ren., I, Seite 252. — Die Bedeutung des Ornaments in der Lust ist noch nicht erklärt worden.
2 Zum Beispiel in dem von Francesco Novelli gestochenen, Mantegna zugeschriebenen Skizzenbuche eines paduanischen oder ferraresischen
Künstlers, das ehemals in der Sammlung der Lady Hannah Rothschild sich befand und jetzt im British Museum bewahrt wird; dann in einem
Cassone-Gemälde der ferraresischen Schule, das vor einigen Jahren im Kunsthandel in Rom austauchte; ferner in einem Holzschnitte der 1497 in
Venedig gedruckten Metamorphosen Ovids; auf einem Majolikateller des Museo Correr zu Venedig. (Siehe 0. v. Falke im Jahrbuch der königlich
preußischen Kunstsammlungen, XV [1894], Seite 43.) Ähnliche Darstellungen begegnen uns in einer Plakette (Nr. 914) des Berliner Museums und in
einer Giulio Romano zugeschriebenen Zeichnung des Louvre (Braun, 293). Dürer hat bekanntlich den Stich nachgezeichnet. Das 1494 datierte Blatt
befindet sich in der Kunsthalle zu Hamburg (Lippmann, Dürers Zeichnungen, Abteilung IX, Nr. 159). Dürer hat die Figur der Mänade zur Linken
gegenseitig kopiert in seinem Kupferstich die »Eifersucht« (Bild 73). Das Motiv des Orpheus kommt auch sonst häufig vor und wird gewiß der
Antike entlehnt sein. Siehe Warburg, Dürer und die italienische Antike. Sonderabdruck aus den Verhandlungen der 48. Versammlung deutscher
Philologen, Hamburg 1905, mit Abbildungen.
nach
■A|.
solxxxxim
Aus der E-Folge der »Tarocchi
und den Kupferstichen eine nicht-venezianische
Umarbeitung der Bilder anzunehmen, von der
sowohl die S-Folge wie auch die venezianische
E-Folge, welches auch ihr Verhältnis zueinan-
der sein mag, beide abhängig sind.
Um die E-Folge der »Tarocchi«, in der
die venezianische Technik in der Subtilität der
Arbeit und in der Feinheit des Tones ihren
Höhepunkt erreicht hat, gruppiert sich eine
Reihe von Kupferstichen, die die gleiche Tech-
nik und zum Teil auch den gleichen Stil der
Zeichnung aufweisen. An erster Stelle ist hier
zu nennen der Tod des Orpheus, von dem
nur ein einziges Exemplar in der Kunsthalle
zu Hamburg sich erhalten hat.1 Die Kompo-
sition begegnet uns mehrfach in Kunstwerken
verschiedener Technik.2 Sie ist sicher nicht
venezianischen Ursprungs, ihr Stil weist viel-
mehr ebenso wie die S-Folge der »Tarocchi«
auf südliche und westliche Gegenden. Die
Landschaft findet wohl Analogien in Zeichnun-
gen Jacopo Bellinis (zum Beispiel Pariser
Skizzenbuch, Phot. Giraudon 779), ihrem
Charakter nach ist sie aber nicht venetisch,
sondern erinnert vielmehr an die Gegend der
Marken und des östlichen Umbriens. In Ve-
nedig wird man in dieser Zeit eine so drama-
tische Komposition, Bewegungen von dieser
Energie und Lebhaftigkeit nicht aufweisen
können. Die runden, bauschigen Falten, die in
ihrer Unruhe und mit ihrer Häufung von Moti-
ven ganz undekorativ wirken, sind ebenfalls
durchaus unvenezianisch. Analogien für diesen
Stil wird man im Kreise der umbro-floren-
tinischen Maler, der Künstler aus der Schule
Pieros, wie zum Beispiel Fra Carnevale, zu
suchen haben. Die Technik des Orpheus ist
dagegen durchaus venezianisch und der der
E-Folge so gut wie gleich. Daran ist auch wohl
nie gezweifelt worden. Die Art der Schraffie-
rung, die Behandlung der Haare, des Bodens
und der Pflanzen ist dieselbe.
In die nächste Nähe der E-Folge der
»Tarocchi« sind auch zwei Darstellungen von
i 139 : 212»««. Siehe Passavant, V, Seite 47, Nr. 120; Kollosf in Meyers Künstlerlexikon (Baldini, I, 52); Naumanns Archiv für die zeichnenden
Künste, XVI (1870), Seite 88 (Baldini zug.); Ottley, Inquiry, I, Seite 403 (Baldini zug.). Abbildung; Chalkographische Gesellschaft 1886, n.ö; Müntz,
Hist. de l'art p. la ren., I, Seite 252. — Die Bedeutung des Ornaments in der Lust ist noch nicht erklärt worden.
2 Zum Beispiel in dem von Francesco Novelli gestochenen, Mantegna zugeschriebenen Skizzenbuche eines paduanischen oder ferraresischen
Künstlers, das ehemals in der Sammlung der Lady Hannah Rothschild sich befand und jetzt im British Museum bewahrt wird; dann in einem
Cassone-Gemälde der ferraresischen Schule, das vor einigen Jahren im Kunsthandel in Rom austauchte; ferner in einem Holzschnitte der 1497 in
Venedig gedruckten Metamorphosen Ovids; auf einem Majolikateller des Museo Correr zu Venedig. (Siehe 0. v. Falke im Jahrbuch der königlich
preußischen Kunstsammlungen, XV [1894], Seite 43.) Ähnliche Darstellungen begegnen uns in einer Plakette (Nr. 914) des Berliner Museums und in
einer Giulio Romano zugeschriebenen Zeichnung des Louvre (Braun, 293). Dürer hat bekanntlich den Stich nachgezeichnet. Das 1494 datierte Blatt
befindet sich in der Kunsthalle zu Hamburg (Lippmann, Dürers Zeichnungen, Abteilung IX, Nr. 159). Dürer hat die Figur der Mänade zur Linken
gegenseitig kopiert in seinem Kupferstich die »Eifersucht« (Bild 73). Das Motiv des Orpheus kommt auch sonst häufig vor und wird gewiß der
Antike entlehnt sein. Siehe Warburg, Dürer und die italienische Antike. Sonderabdruck aus den Verhandlungen der 48. Versammlung deutscher
Philologen, Hamburg 1905, mit Abbildungen.
nach