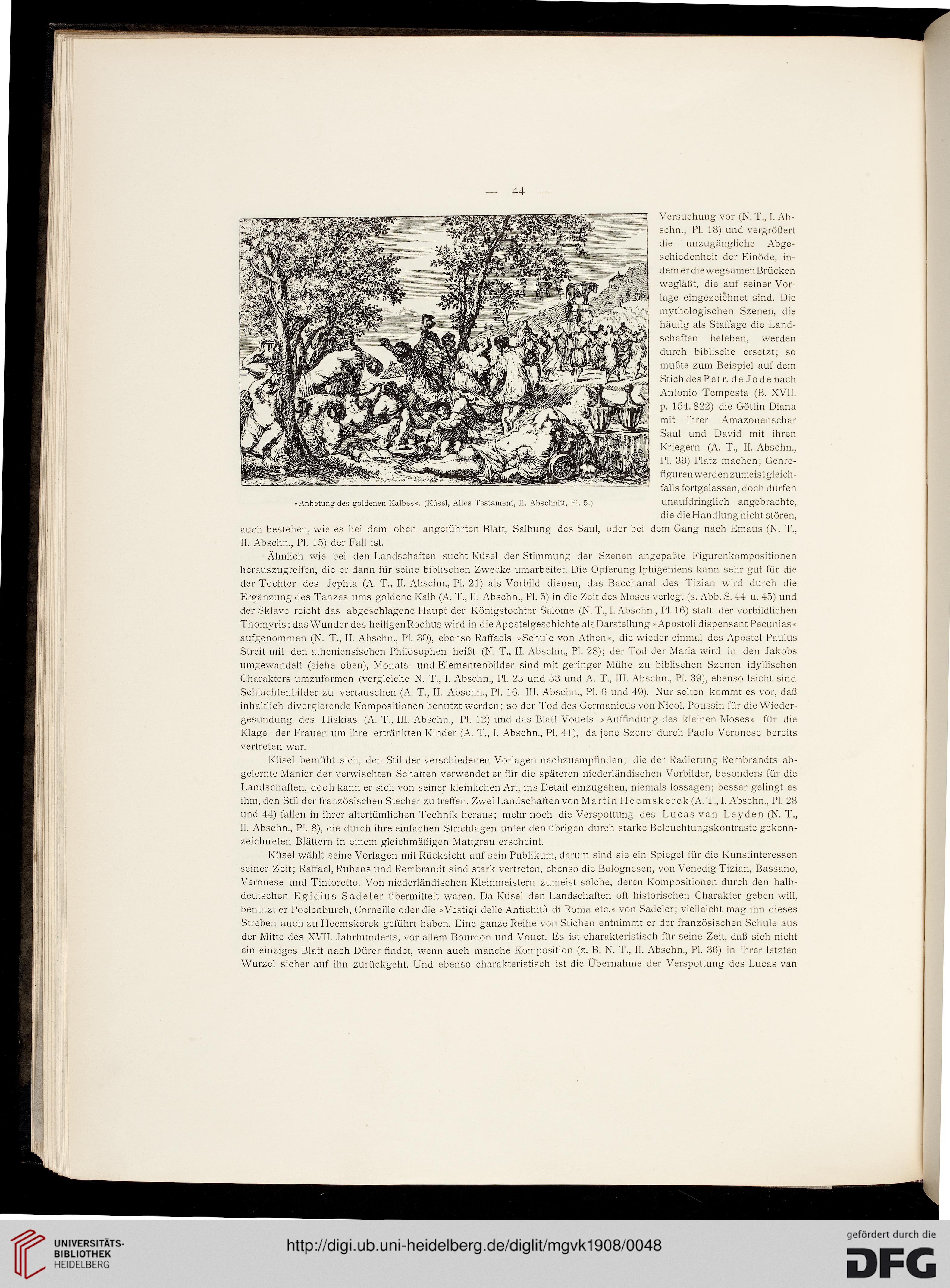— 44
Versuchung vor (N.T., I. Ab-
schn., PI. 18) und vergrößert
die unzugängliche Abge-
schiedenheit der Einöde, in-
dem er die wegsamen Brücken
wegläßt, die auf seiner Vor-
lage eingezeichnet sind. Die
mythologischen Szenen, die
häufig als Staffage die Land-
schaften beleben, werden
durch biblische ersetzt; so
mußte zum Beispiel auf dem
Stich des Petr. deJode nach
Antonio Tempesta (B. XVII.
p. 154.822) die Göttin Diana
mit ihrer Amazonenschar
Saul und David mit ihren
Kriegern (A. T., II. Abschn.,
PI. 39) Platz machen; Genre-
figuren werden zumeist gleich-
falls fortgelassen, doch dürfen
»Anbetung des goldenen Kalbes«. (Kusel, Altes Testament, H. Abschnitt, PI. 5.) Unaufdringlich angebrachte,
die die Handlung nicht stören,
auch bestehen, wie es bei dem oben angeführten Blatt, Salbung des Saul, oder bei dem Gang nach Emaus (N. T.,
II. Abschn., PI. 15) der Fall ist.
Ähnlich wie bei den Landschaften sucht Küsel der Stimmung der Szenen angepaßte Figurenkompositionen
herauszugreifen, die er dann für seine biblischen Zwecke umarbeitet. Die Opferung Iphigeniens kann sehr gut für die
der Tochter des Jephta (A. T., II. Abschn., PI. 21) als Vorbild dienen, das Bacchanal des Tizian wird durch die
Ergänzung des Tanzes ums goldene Kalb (A. T., II. Abschn., PI. 5) in die Zeit des Moses verlegt (s. Abb. S. 44 u. 45) und
der Sklave reicht das abgeschlagene Haupt der Königstochter Salome (N. T., I. Abschn., PI. 16) statt der vorbildlichen
Thomyris; das Wunder des heiligen Rochus wird in die Apostelgeschichte als Darstellung »Apostoli dispensant Pecunias«
aufgenommen (N. T., II. Abschn., PI. 30), ebenso Raffaels »Schule von Athen«, die wieder einmal des Apostel Paulus
Streit mit den atheniensischen Philosophen heißt (N. T, II. Abschn., PI. 28); der Tod der Maria wird in den Jakobs
umgewandelt (siehe oben), Monats- und Elementenbilder sind mit geringer Mühe zu biblischen Szenen idyllischen
Charakters umzuformen (vergleiche N. T., I. Abschn., PI. 23 und 33 und A. T., III. Abschn., PI. 39), ebenso leicht sind
Schlachtenbilder zu vertauschen (A. T., II. Abschn., PI. 16, III. Abschn., PI. 6 und 49). Nur selten kommt es vor, daß
inhaltlich divergierende Kompositionen benutzt werden; so der Tod des Germanicus von Nicol. Poussin für die Wieder-
gesundung des Hiskias (A. T., III. Abschn., PI. 12) und das Blatt Vouets »Auffindung des kleinen Moses« für die
Klage der Frauen um ihre ertränkten Kinder (A. T., I. Abschn., PI. 41), da jene Szene durch Paolo Veronese bereits
vertreten war.
Küsel bemüht sich, den Stil der verschiedenen Vorlagen nachzuempfinden; die der Radierung Rembrandts ab-
gelernte Manier der verwischten Schatten verwendet er für die späteren niederländischen Vorbilder, besonders für die
Landschaften, doch kann er sich von seiner kleinlichen Art, ins Detail einzugehen, niemals lossagen; besser gelingt es
ihm, den Stil der französischen Stecher zu treffen. Zwei Landschaften von Martin H eemskerck (A. T., I. Abschn., PI. 28
und 44) fallen in ihrer altertümlichen Technik heraus; mehr noch die Verspottung des Lucas van Leyden (N. T.,
II. Abschn., PI. 8), die durch ihre einfachen Strichlagen unter den übrigen durch starke Beleuchtungskontraste gekenn-
zeichneten Blättern in einem gleichmäßigen Mattgrau erscheint.
Küsel wählt seine Vorlagen mit Rücksicht auf sein Publikum, darum sind sie ein Spiegel für die Kunstinteressen
seiner Zeit; Raffael, Rubens und Rembrandt sind stark vertreten, ebenso die Bolognesen, von Venedig Tizian, Bassano,
Veronese und Tintoretto. Von niederländischen Kleinmeistern zumeist solche, deren Kompositionen durch den halb-
deutschen Egidius Sadeler übermittelt waren. Da Küsel den Landschaften oft historischen Charakter geben will,
benutzt er Poelenburch, Corneille oder die »Vestigi delle Antichitä di Roma etc.« von Sadeler; vielleicht mag ihn dieses
Streben auch zu Heemskerck geführt haben. Eine ganze Reihe von Stichen entnimmt er der französischen Schule aus
der Mitte des XVII. Jahrhunderts, vor allem Bourdon und Vouet. Es ist charakteristisch für seine Zeit, daß sich nicht
ein einziges Blatt nach Dürer findet, wenn auch manche Komposition (z. B. N. T., II. Abschn., PI. 36) in ihrer letzten
Wurzel sicher auf ihn zurückgeht. Und ebenso charakteristisch ist die Übernahme der Verspottung des Lucas van
Versuchung vor (N.T., I. Ab-
schn., PI. 18) und vergrößert
die unzugängliche Abge-
schiedenheit der Einöde, in-
dem er die wegsamen Brücken
wegläßt, die auf seiner Vor-
lage eingezeichnet sind. Die
mythologischen Szenen, die
häufig als Staffage die Land-
schaften beleben, werden
durch biblische ersetzt; so
mußte zum Beispiel auf dem
Stich des Petr. deJode nach
Antonio Tempesta (B. XVII.
p. 154.822) die Göttin Diana
mit ihrer Amazonenschar
Saul und David mit ihren
Kriegern (A. T., II. Abschn.,
PI. 39) Platz machen; Genre-
figuren werden zumeist gleich-
falls fortgelassen, doch dürfen
»Anbetung des goldenen Kalbes«. (Kusel, Altes Testament, H. Abschnitt, PI. 5.) Unaufdringlich angebrachte,
die die Handlung nicht stören,
auch bestehen, wie es bei dem oben angeführten Blatt, Salbung des Saul, oder bei dem Gang nach Emaus (N. T.,
II. Abschn., PI. 15) der Fall ist.
Ähnlich wie bei den Landschaften sucht Küsel der Stimmung der Szenen angepaßte Figurenkompositionen
herauszugreifen, die er dann für seine biblischen Zwecke umarbeitet. Die Opferung Iphigeniens kann sehr gut für die
der Tochter des Jephta (A. T., II. Abschn., PI. 21) als Vorbild dienen, das Bacchanal des Tizian wird durch die
Ergänzung des Tanzes ums goldene Kalb (A. T., II. Abschn., PI. 5) in die Zeit des Moses verlegt (s. Abb. S. 44 u. 45) und
der Sklave reicht das abgeschlagene Haupt der Königstochter Salome (N. T., I. Abschn., PI. 16) statt der vorbildlichen
Thomyris; das Wunder des heiligen Rochus wird in die Apostelgeschichte als Darstellung »Apostoli dispensant Pecunias«
aufgenommen (N. T., II. Abschn., PI. 30), ebenso Raffaels »Schule von Athen«, die wieder einmal des Apostel Paulus
Streit mit den atheniensischen Philosophen heißt (N. T, II. Abschn., PI. 28); der Tod der Maria wird in den Jakobs
umgewandelt (siehe oben), Monats- und Elementenbilder sind mit geringer Mühe zu biblischen Szenen idyllischen
Charakters umzuformen (vergleiche N. T., I. Abschn., PI. 23 und 33 und A. T., III. Abschn., PI. 39), ebenso leicht sind
Schlachtenbilder zu vertauschen (A. T., II. Abschn., PI. 16, III. Abschn., PI. 6 und 49). Nur selten kommt es vor, daß
inhaltlich divergierende Kompositionen benutzt werden; so der Tod des Germanicus von Nicol. Poussin für die Wieder-
gesundung des Hiskias (A. T., III. Abschn., PI. 12) und das Blatt Vouets »Auffindung des kleinen Moses« für die
Klage der Frauen um ihre ertränkten Kinder (A. T., I. Abschn., PI. 41), da jene Szene durch Paolo Veronese bereits
vertreten war.
Küsel bemüht sich, den Stil der verschiedenen Vorlagen nachzuempfinden; die der Radierung Rembrandts ab-
gelernte Manier der verwischten Schatten verwendet er für die späteren niederländischen Vorbilder, besonders für die
Landschaften, doch kann er sich von seiner kleinlichen Art, ins Detail einzugehen, niemals lossagen; besser gelingt es
ihm, den Stil der französischen Stecher zu treffen. Zwei Landschaften von Martin H eemskerck (A. T., I. Abschn., PI. 28
und 44) fallen in ihrer altertümlichen Technik heraus; mehr noch die Verspottung des Lucas van Leyden (N. T.,
II. Abschn., PI. 8), die durch ihre einfachen Strichlagen unter den übrigen durch starke Beleuchtungskontraste gekenn-
zeichneten Blättern in einem gleichmäßigen Mattgrau erscheint.
Küsel wählt seine Vorlagen mit Rücksicht auf sein Publikum, darum sind sie ein Spiegel für die Kunstinteressen
seiner Zeit; Raffael, Rubens und Rembrandt sind stark vertreten, ebenso die Bolognesen, von Venedig Tizian, Bassano,
Veronese und Tintoretto. Von niederländischen Kleinmeistern zumeist solche, deren Kompositionen durch den halb-
deutschen Egidius Sadeler übermittelt waren. Da Küsel den Landschaften oft historischen Charakter geben will,
benutzt er Poelenburch, Corneille oder die »Vestigi delle Antichitä di Roma etc.« von Sadeler; vielleicht mag ihn dieses
Streben auch zu Heemskerck geführt haben. Eine ganze Reihe von Stichen entnimmt er der französischen Schule aus
der Mitte des XVII. Jahrhunderts, vor allem Bourdon und Vouet. Es ist charakteristisch für seine Zeit, daß sich nicht
ein einziges Blatt nach Dürer findet, wenn auch manche Komposition (z. B. N. T., II. Abschn., PI. 36) in ihrer letzten
Wurzel sicher auf ihn zurückgeht. Und ebenso charakteristisch ist die Übernahme der Verspottung des Lucas van