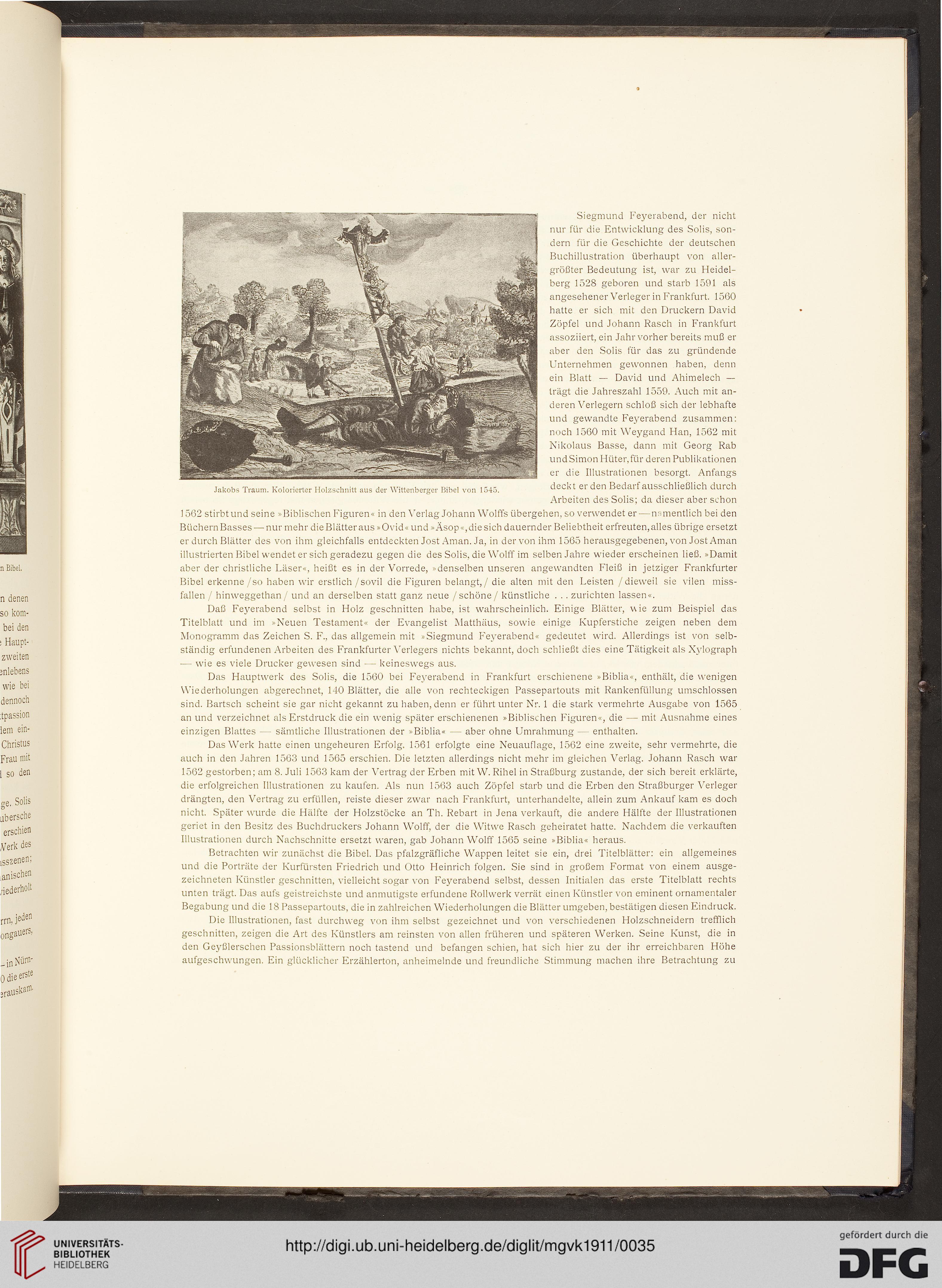Siegmund Feyerabend, der nicht
nur für die Entwicklung des Solis, son-
dern für die Geschichte der deutschen
Buchillustration überhaupt von aller-
größter Bedeutung ist, war zu Heidel-
berg 1528 geboren und starb 1591 als
angesehener Verleger in Frankfurt. 1560
hatte er sich mit den Druckern David
Zöpfel und Johann Rasch in Frankfurt
assoziiert, ein Jahr vorher bereits muß er
aber den Solis für das zu gründende
Unternehmen gewonnen haben, denn
ein Blatt — David und Ahimelech —
trägt die Jahreszahl 1559. Auch mit an-
deren Verlegern schloß sich der lebhafte
und gewandte Feyerabend zusammen:
noch 1560 mit Weygand Han, 1562 mit
Nikolaus Basse, dann mit Georg Rab
und Simon Hüter, für deren Publikationen
er die Illustrationen besorgt. Anfangs
Jakobs Traum. Kolorierter Holzschnitt aus der Wittenberger Bibel von 1545. deckt er den Bedarf ausschließlich durch
Arbeiten des Solis; da dieser aber schon
1562 stirbt und seine »Biblischen Figuren« in den Verlag Johann Wolfis übergehen, so verwendet er —namentlich bei den
Büchern Basses — nur mehr die Blätter aus »Ovid« und »Asop«, die sich dauernder Beliebtheit erfreuten, alles übrige ersetzt
er durch Blätter des von ihm gleichfalls entdeckten Jost Aman. Ja, in der von ihm 1565 herausgegebenen, von Jost Aman
illustrierten Bibel wendet er sich geradezu gegen die des Solis, die Wolff im selben Jahre wieder erscheinen ließ. »Damit
aber der christliche Läser«, heißt es in der Vorrede, »denselben unseren angewandten Fleiß in jetziger Frankfurter
Bibel erkenne/so haben wir erstlich/sovil die Figuren belangt,/ die alten mit den Leisten /dieweil sie vilen miss-
fallen / hinweggethan/ und an derselben statt ganz neue / schöne/ künstliche . . . zurichten lassen«.
Daß Feyerabend selbst in Holz geschnitten habe, ist wahrscheinlich. Einige Blätter, wie zum Beispiel das
Titelblatt und im »Neuen Testament« der Evangelist Matthäus, sowie einige Kupferstiche zeigen neben dem
Monogramm das Zeichen S. F., das allgemein mit »Siegmund Feyerabend« gedeutet wird. Allerdings ist von selb-
ständig erfundenen Arbeiten des Frankfurter Verlegers nichts bekannt, doch schließt dies eine Tätigkeit als Xylograph
— wie es viele Drucker gewesen sind — keineswegs aus.
Das Hauptwerk des Solis, die 1560 bei Feyerabend in Frankfurt erschienene »Biblia«, enthält, die wenigen
Wiederholungen abgerechnet, 140 Blätter, die alle von rechteckigen Passepartouts mit Rankenfüllung umschlossen
sind. Bartsch scheint sie gar nicht gekannt zu haben, denn er führt unter Nr. 1 die stark vermehrte Ausgabe von 1565
an und verzeichnet als Erstdruck die ein wenig später erschienenen »Biblischen Figuren«, die — mit Ausnahme eines
einzigen Blattes — sämtliche Illustrationen der »Biblia« — aber ohne Umrahmung — enthalten.
Das Werk hatte einen ungeheuren Erfolg. 1561 erfolgte eine Neuauflage, 1562 eine zweite, sehr vermehrte, die
auch in den Jahren 1563 und 1565 erschien. Die letzten allerdings nicht mehr im gleichen Verlag. Johann Rasch war
1562 gestorben; am 8. Juli 1563 kam der Vertrag der Erben mit W. Rihel in Straßburg zustande, der sich bereit erklärte,
die erfolgreichen Illustrationen zu kaufen. Als nun 1563 auch Zöpfel starb und die Erben den Straßburger Verleger
drängten, den Vertrag zu erfüllen, reiste dieser zwar nach Frankfurt, unterhandelte, allein zum Ankauf kam es doch
nicht. Später wurde die Hälfte der Holzstöcke an Th. Rebart in Jena verkauft, die andere Hälfte der Illustrationen
geriet in den Besitz des Buchdruckers Johann Wolff, der die Witwe Rasch geheiratet hatte. Nachdem die verkauften
Illustrationen durch Nachschnitte ersetzt waren, gab Johann Wolff 1565 seine »Biblia« heraus.
Betrachten wir zunächst die Bibel. Das pfalzgräfliche Wappen leitet sie ein, drei Titelblätter: ein allgemeines
und die Porträte der Kurfürsten Friedrich und Otto Heinrich folgen. Sie sind in großem Format von einem ausge-
zeichneten Künstler geschnitten, vielleicht sogar von Feyerabend selbst, dessen Initialen das erste Titelblatt rechts
unten trägt. Das aufs geistreichste und anmutigste erfundene Rollwerk verrät einen Künstler von eminent ornamentaler
Begabung und die 18 Passepartouts, die in zahlreichen Wiederholungen die Blätter umgeben, bestätigen diesen Eindruck.
Die Illustrationen, fast durchweg von ihm selbst gezeichnet und von verschiedenen Holzschneidern trefflich
geschnitten, zeigen die Art des Künstlers am reinsten von allen früheren und späteren Werken. Seine Kunst, die in
den Geyßlerschen Passionsblättern noch tastend und befangen schien, hat sich hier zu der ihr erreichbaren Höhe
aufgeschwungen. Ein glücklicher Erzählerton, anheimelnde und freundliche Stimmung machen ihre Betrachtung zu
nur für die Entwicklung des Solis, son-
dern für die Geschichte der deutschen
Buchillustration überhaupt von aller-
größter Bedeutung ist, war zu Heidel-
berg 1528 geboren und starb 1591 als
angesehener Verleger in Frankfurt. 1560
hatte er sich mit den Druckern David
Zöpfel und Johann Rasch in Frankfurt
assoziiert, ein Jahr vorher bereits muß er
aber den Solis für das zu gründende
Unternehmen gewonnen haben, denn
ein Blatt — David und Ahimelech —
trägt die Jahreszahl 1559. Auch mit an-
deren Verlegern schloß sich der lebhafte
und gewandte Feyerabend zusammen:
noch 1560 mit Weygand Han, 1562 mit
Nikolaus Basse, dann mit Georg Rab
und Simon Hüter, für deren Publikationen
er die Illustrationen besorgt. Anfangs
Jakobs Traum. Kolorierter Holzschnitt aus der Wittenberger Bibel von 1545. deckt er den Bedarf ausschließlich durch
Arbeiten des Solis; da dieser aber schon
1562 stirbt und seine »Biblischen Figuren« in den Verlag Johann Wolfis übergehen, so verwendet er —namentlich bei den
Büchern Basses — nur mehr die Blätter aus »Ovid« und »Asop«, die sich dauernder Beliebtheit erfreuten, alles übrige ersetzt
er durch Blätter des von ihm gleichfalls entdeckten Jost Aman. Ja, in der von ihm 1565 herausgegebenen, von Jost Aman
illustrierten Bibel wendet er sich geradezu gegen die des Solis, die Wolff im selben Jahre wieder erscheinen ließ. »Damit
aber der christliche Läser«, heißt es in der Vorrede, »denselben unseren angewandten Fleiß in jetziger Frankfurter
Bibel erkenne/so haben wir erstlich/sovil die Figuren belangt,/ die alten mit den Leisten /dieweil sie vilen miss-
fallen / hinweggethan/ und an derselben statt ganz neue / schöne/ künstliche . . . zurichten lassen«.
Daß Feyerabend selbst in Holz geschnitten habe, ist wahrscheinlich. Einige Blätter, wie zum Beispiel das
Titelblatt und im »Neuen Testament« der Evangelist Matthäus, sowie einige Kupferstiche zeigen neben dem
Monogramm das Zeichen S. F., das allgemein mit »Siegmund Feyerabend« gedeutet wird. Allerdings ist von selb-
ständig erfundenen Arbeiten des Frankfurter Verlegers nichts bekannt, doch schließt dies eine Tätigkeit als Xylograph
— wie es viele Drucker gewesen sind — keineswegs aus.
Das Hauptwerk des Solis, die 1560 bei Feyerabend in Frankfurt erschienene »Biblia«, enthält, die wenigen
Wiederholungen abgerechnet, 140 Blätter, die alle von rechteckigen Passepartouts mit Rankenfüllung umschlossen
sind. Bartsch scheint sie gar nicht gekannt zu haben, denn er führt unter Nr. 1 die stark vermehrte Ausgabe von 1565
an und verzeichnet als Erstdruck die ein wenig später erschienenen »Biblischen Figuren«, die — mit Ausnahme eines
einzigen Blattes — sämtliche Illustrationen der »Biblia« — aber ohne Umrahmung — enthalten.
Das Werk hatte einen ungeheuren Erfolg. 1561 erfolgte eine Neuauflage, 1562 eine zweite, sehr vermehrte, die
auch in den Jahren 1563 und 1565 erschien. Die letzten allerdings nicht mehr im gleichen Verlag. Johann Rasch war
1562 gestorben; am 8. Juli 1563 kam der Vertrag der Erben mit W. Rihel in Straßburg zustande, der sich bereit erklärte,
die erfolgreichen Illustrationen zu kaufen. Als nun 1563 auch Zöpfel starb und die Erben den Straßburger Verleger
drängten, den Vertrag zu erfüllen, reiste dieser zwar nach Frankfurt, unterhandelte, allein zum Ankauf kam es doch
nicht. Später wurde die Hälfte der Holzstöcke an Th. Rebart in Jena verkauft, die andere Hälfte der Illustrationen
geriet in den Besitz des Buchdruckers Johann Wolff, der die Witwe Rasch geheiratet hatte. Nachdem die verkauften
Illustrationen durch Nachschnitte ersetzt waren, gab Johann Wolff 1565 seine »Biblia« heraus.
Betrachten wir zunächst die Bibel. Das pfalzgräfliche Wappen leitet sie ein, drei Titelblätter: ein allgemeines
und die Porträte der Kurfürsten Friedrich und Otto Heinrich folgen. Sie sind in großem Format von einem ausge-
zeichneten Künstler geschnitten, vielleicht sogar von Feyerabend selbst, dessen Initialen das erste Titelblatt rechts
unten trägt. Das aufs geistreichste und anmutigste erfundene Rollwerk verrät einen Künstler von eminent ornamentaler
Begabung und die 18 Passepartouts, die in zahlreichen Wiederholungen die Blätter umgeben, bestätigen diesen Eindruck.
Die Illustrationen, fast durchweg von ihm selbst gezeichnet und von verschiedenen Holzschneidern trefflich
geschnitten, zeigen die Art des Künstlers am reinsten von allen früheren und späteren Werken. Seine Kunst, die in
den Geyßlerschen Passionsblättern noch tastend und befangen schien, hat sich hier zu der ihr erreichbaren Höhe
aufgeschwungen. Ein glücklicher Erzählerton, anheimelnde und freundliche Stimmung machen ihre Betrachtung zu