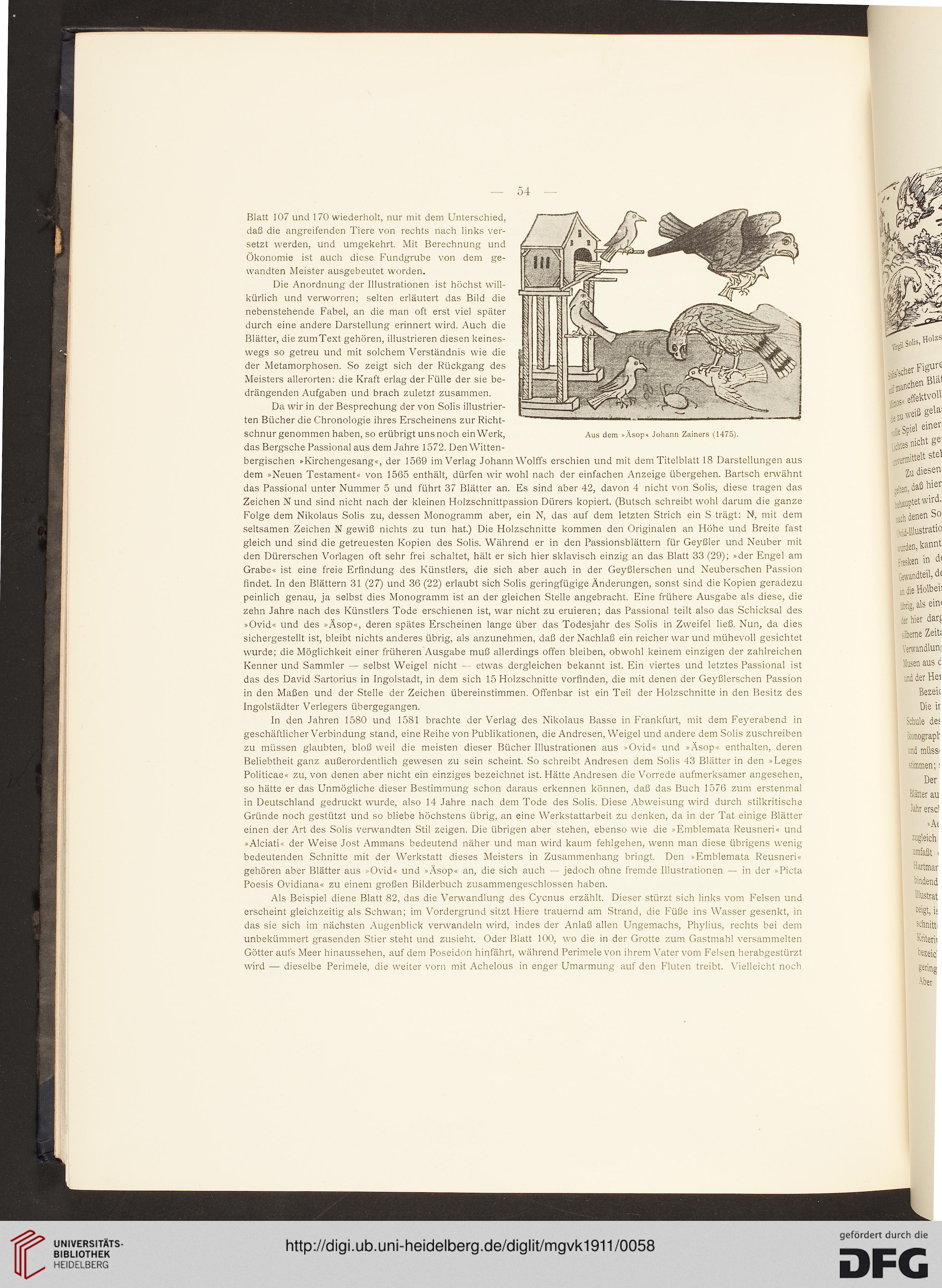Blatt 107 und 170 wiederholt, nur mit dem Unterschied,
daß die angreifenden Tiere von rechts nach links ver-
setzt werden, und umgekehrt. Mit Berechnung und
Ökonomie ist auch diese Fundgrube von dem ge-
wandten Meister ausgebeutet worden.
Die Anordnung der Illustrationen ist höchst will-
kürlich und verworren; selten erläutert das Bild die
nebenstehende Fabel, an die man oft erst viel später
durch eine andere Darstellung erinnert wird. Auch die
Blätter, die zumText gehören, illustrieren diesen keines-
wegs so getreu und mit solchem Verständnis wie die
der Metamorphosen. So zeigt sich der Rückgang des
Meisters allerorten: die Kraft erlag der Fülle der sie be-
drängenden Aufgaben und brach zuletzt zusammen.
Da wir in der Besprechung der von Solis illustrier-
ten Bücher die Chronologie ihres Erscheinens zur Richt-
schnur genommen haben, so erübrigt uns noch ein Werk,
das Bergsche Passional aus dem Jahre 1572. Den Witten-
bergischen »Kirchengesang«, der 1569 im Verlag Johann Wolffs erschien und mit dem Titelblatt 18 Darstellungen aus
dem »Neuen Testament« von 1565 enthält, dürfen wir wohl nach der einfachen Anzeige übergehen. Bartsch erwähnt
das Passional unter Nummer 5 und führt 37 Blätter an. Es sind aber 42, davon 4 nicht von Solis, diese tragen das
Zeichen N und sind nicht nach der kleinen Holzschnittpassion Dürers kopiert. (Butsch schreibt wohl darum die ganze
Folge dem Nikolaus Solis zu, dessen Monogramm aber, ein N, das auf dem letzten Strich ein S trägt: N, mit dem
seltsamen Zeichen N gewiß nichts zu tun hat.) Die Holzschnitte kommen den Originalen an Höhe und Breite fast
gleich und sind die getreuesten Kopien des Solis. Während er in den Passionsblättern für Geyßler und Neuber mit
den Dürerschen Vorlagen oft sehr frei schaltet, hält er sich hier sklavisch einzig an das Blatt 33 (29); »der Engel am
Grabe« ist eine freie Erfindung des Künstlers, die sich aber auch in der Geyßlerschen und Neuberschen Passion
findet. In den Blättern 31 (27) und 36 (22) erlaubt sich Solis geringfügige Änderungen, sonst sind die Kopien geradezu
peinlich genau, ja selbst dies Monogramm ist an der gleichen Stelle angebracht. Eine frühere Ausgabe als diese, die
zehn Jahre nach des Künstlers Tode erschienen ist, war nicht zu eruieren; das Passional teilt also das Schicksal des
»Ovid« und des »Äsop«, deren spätes Erscheinen lange über das Todesjahr des Solis in Zweifel ließ. Nun, da dies
sichergestellt ist, bleibt nichts anderes übrig, als anzunehmen, daß der Nachlaß ein reicher war und mühevoll gesichtet
wurde; die Möglichkeit einer früheren Ausgabe muß allerdings offen bleiben, obwohl keinem einzigen der zahlreichen
Kenner und Sammler — selbst Weigel nicht — etwas dergleichen bekannt ist. Ein viertes und letztes Passional ist
das des David Sartorius in Ingolstadt, in dem sich 15 Holzschnitte vorfinden, die mit denen der Geyßlerschen Passion
in den Maßen und der Stelle der Zeichen übereinstimmen. Offenbar ist ein Teil der Holzschnitte in den Besitz des
Ingolstädter Verlegers übergegangen.
In den Jahren 1580 und 1581 brachte der Verlag des Nikolaus Basse in Frankfurt, mit dem Feyerabend in
geschäftlicher Verbindung stand, eine Reihe von Publikationen, die Andresen, Weigel und andere dem Solis zuschreiben
zu müssen glaubten, bloß weil die meisten dieser Bücher Illustrationen aus »Ovid« und »Äsop« enthalten, deren
Beliebtheit ganz außerordentlich gewesen zu sein scheint. So schreibt Andresen dem Solis 43 Blätter in den »Leges
Politicae« zu, von denen aber nicht ein einziges bezeichnet ist. Hätte Andresen die Vorrede aufmerksamer angesehen,
so hätte er das Unmögliche dieser Bestimmung schon daraus erkennen können, daß das Buch 1576 zum erstenmal
in Deutschland gedruckt wurde, also 14 Jahre nach dem Tode des Solis. Diese Abweisung wird durch stilkritische
Gründe noch gestützt und so bliebe höchstens übrig, an eine Werkstattarbeit zu denken, da in der Tat einige Blätter
einen der Art des Solis verwandten Stil zeigen. Die übrigen aber stehen, ebenso wie die »Emblemata Reusneri« und
»Alciati« der Weise Jost Ammans bedeutend näher und man wird kaum fehlgehen, wenn man diese übrigens wenig
bedeutenden Schnitte mit der Werkstatt dieses Meisters in Zusammenhang bringt. Den »Emblemata Reusneri«
gehören aber Blätter aus »Ovid« und »Äsop« an, die sich auch — jedoch ohne fremde Illustrationen — in der »Picta
Poesis Ovidiana« zu einem großen Bilderbuch zusammengeschlossen haben.
Als Beispiel diene Blatt 82, das die Verwandlung des Cycnus erzählt. Dieser stürzt sich links vom Felsen und
erscheint gleichzeitig als Schwan; im Vordergrund sitzt Hiere trauernd am Strand, die Füße ins Wasser gesenkt, in
das sie sich im nächsten Augenblick verwandeln wird, indes der Anlaß allen Ungemachs, Phylius, rechts bei dem
unbekümmert grasenden Stier steht und zusieht. Oder Blatt 100, wo die in der Grotte zum Gastmahl versammelten
Götter aufs Meer hinaussehen, auf dem Poseidon hinfährt, während Perimele von ihrem Vater vom Felsen herabgestürzt
wird — dieselbe Perimele, die weiter vorn mit Achelous in enger Umarmung auf den Fluten treibt. Vielleicht noch
daß die angreifenden Tiere von rechts nach links ver-
setzt werden, und umgekehrt. Mit Berechnung und
Ökonomie ist auch diese Fundgrube von dem ge-
wandten Meister ausgebeutet worden.
Die Anordnung der Illustrationen ist höchst will-
kürlich und verworren; selten erläutert das Bild die
nebenstehende Fabel, an die man oft erst viel später
durch eine andere Darstellung erinnert wird. Auch die
Blätter, die zumText gehören, illustrieren diesen keines-
wegs so getreu und mit solchem Verständnis wie die
der Metamorphosen. So zeigt sich der Rückgang des
Meisters allerorten: die Kraft erlag der Fülle der sie be-
drängenden Aufgaben und brach zuletzt zusammen.
Da wir in der Besprechung der von Solis illustrier-
ten Bücher die Chronologie ihres Erscheinens zur Richt-
schnur genommen haben, so erübrigt uns noch ein Werk,
das Bergsche Passional aus dem Jahre 1572. Den Witten-
bergischen »Kirchengesang«, der 1569 im Verlag Johann Wolffs erschien und mit dem Titelblatt 18 Darstellungen aus
dem »Neuen Testament« von 1565 enthält, dürfen wir wohl nach der einfachen Anzeige übergehen. Bartsch erwähnt
das Passional unter Nummer 5 und führt 37 Blätter an. Es sind aber 42, davon 4 nicht von Solis, diese tragen das
Zeichen N und sind nicht nach der kleinen Holzschnittpassion Dürers kopiert. (Butsch schreibt wohl darum die ganze
Folge dem Nikolaus Solis zu, dessen Monogramm aber, ein N, das auf dem letzten Strich ein S trägt: N, mit dem
seltsamen Zeichen N gewiß nichts zu tun hat.) Die Holzschnitte kommen den Originalen an Höhe und Breite fast
gleich und sind die getreuesten Kopien des Solis. Während er in den Passionsblättern für Geyßler und Neuber mit
den Dürerschen Vorlagen oft sehr frei schaltet, hält er sich hier sklavisch einzig an das Blatt 33 (29); »der Engel am
Grabe« ist eine freie Erfindung des Künstlers, die sich aber auch in der Geyßlerschen und Neuberschen Passion
findet. In den Blättern 31 (27) und 36 (22) erlaubt sich Solis geringfügige Änderungen, sonst sind die Kopien geradezu
peinlich genau, ja selbst dies Monogramm ist an der gleichen Stelle angebracht. Eine frühere Ausgabe als diese, die
zehn Jahre nach des Künstlers Tode erschienen ist, war nicht zu eruieren; das Passional teilt also das Schicksal des
»Ovid« und des »Äsop«, deren spätes Erscheinen lange über das Todesjahr des Solis in Zweifel ließ. Nun, da dies
sichergestellt ist, bleibt nichts anderes übrig, als anzunehmen, daß der Nachlaß ein reicher war und mühevoll gesichtet
wurde; die Möglichkeit einer früheren Ausgabe muß allerdings offen bleiben, obwohl keinem einzigen der zahlreichen
Kenner und Sammler — selbst Weigel nicht — etwas dergleichen bekannt ist. Ein viertes und letztes Passional ist
das des David Sartorius in Ingolstadt, in dem sich 15 Holzschnitte vorfinden, die mit denen der Geyßlerschen Passion
in den Maßen und der Stelle der Zeichen übereinstimmen. Offenbar ist ein Teil der Holzschnitte in den Besitz des
Ingolstädter Verlegers übergegangen.
In den Jahren 1580 und 1581 brachte der Verlag des Nikolaus Basse in Frankfurt, mit dem Feyerabend in
geschäftlicher Verbindung stand, eine Reihe von Publikationen, die Andresen, Weigel und andere dem Solis zuschreiben
zu müssen glaubten, bloß weil die meisten dieser Bücher Illustrationen aus »Ovid« und »Äsop« enthalten, deren
Beliebtheit ganz außerordentlich gewesen zu sein scheint. So schreibt Andresen dem Solis 43 Blätter in den »Leges
Politicae« zu, von denen aber nicht ein einziges bezeichnet ist. Hätte Andresen die Vorrede aufmerksamer angesehen,
so hätte er das Unmögliche dieser Bestimmung schon daraus erkennen können, daß das Buch 1576 zum erstenmal
in Deutschland gedruckt wurde, also 14 Jahre nach dem Tode des Solis. Diese Abweisung wird durch stilkritische
Gründe noch gestützt und so bliebe höchstens übrig, an eine Werkstattarbeit zu denken, da in der Tat einige Blätter
einen der Art des Solis verwandten Stil zeigen. Die übrigen aber stehen, ebenso wie die »Emblemata Reusneri« und
»Alciati« der Weise Jost Ammans bedeutend näher und man wird kaum fehlgehen, wenn man diese übrigens wenig
bedeutenden Schnitte mit der Werkstatt dieses Meisters in Zusammenhang bringt. Den »Emblemata Reusneri«
gehören aber Blätter aus »Ovid« und »Äsop« an, die sich auch — jedoch ohne fremde Illustrationen — in der »Picta
Poesis Ovidiana« zu einem großen Bilderbuch zusammengeschlossen haben.
Als Beispiel diene Blatt 82, das die Verwandlung des Cycnus erzählt. Dieser stürzt sich links vom Felsen und
erscheint gleichzeitig als Schwan; im Vordergrund sitzt Hiere trauernd am Strand, die Füße ins Wasser gesenkt, in
das sie sich im nächsten Augenblick verwandeln wird, indes der Anlaß allen Ungemachs, Phylius, rechts bei dem
unbekümmert grasenden Stier steht und zusieht. Oder Blatt 100, wo die in der Grotte zum Gastmahl versammelten
Götter aufs Meer hinaussehen, auf dem Poseidon hinfährt, während Perimele von ihrem Vater vom Felsen herabgestürzt
wird — dieselbe Perimele, die weiter vorn mit Achelous in enger Umarmung auf den Fluten treibt. Vielleicht noch