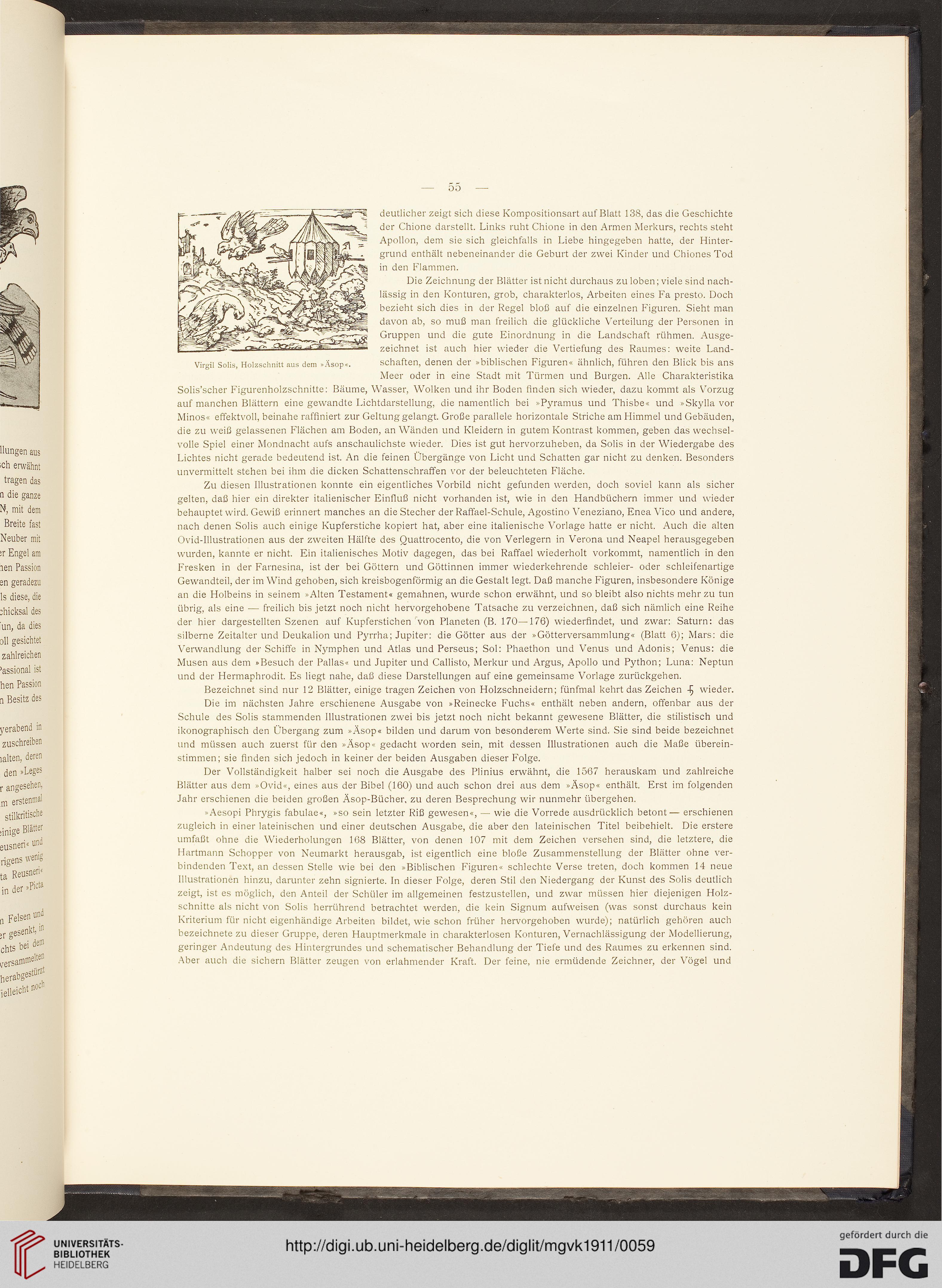00
, und
senkt, in
dem
Virgil Solis, Holzschnitt aus dem »Asop«
nmelten
gestürzt
nocli
deutlicher zeigt sich diese Kompositionsart auf Blatt 138, das die Geschichte
der Chione darstellt. Links ruht Chione in den Armen Merkurs, rechts steht
Apollon, dem sie sich gleichfalls in Liebe hingegeben hatte, der Hinter-
grund enthält nebeneinander die Geburt der zwei Kinder und Chiones Tod
in den Flammen.
Die Zeichnung der Blätter ist nicht durchaus zu loben; viele sind nach-
lässig in den Konturen, grob, charakterlos, Arbeiten eines Fa presto. Doch
bezieht sich dies in der Regel bloß auf die einzelnen Figuren. Sieht man
davon ab, so muß man freilich die glückliche Verteilung der Personen in
Gruppen und die gute Einordnung in die Landschaft rühmen. Ausge-
zeichnet ist auch hier wieder die Vertiefung des Raumes: weite Land-
schaften, denen der »biblischen Figuren« ähnlich, führen den Blick bis ans
Meer oder in eine Stadt mit Türmen und Burgen. Alle Charakteristika
Solis'scher Figurenholzschnitte: Bäume, Wasser, Wolken und ihr Boden finden sich wieder, dazu kommt als Vorzug
auf manchen Blättern eine gewandte Lichtdarstellung, die namentlich bei »Pyramus und Thisbe« und »Skylla vor
Minos« effektvoll, beinahe raffiniert zur Geltung gelangt. Große parallele horizontale Striche am Himmel und Gebäuden,
die zu weiß gelassenen Flächen am Boden, an Wänden und Kleidern in gutem Kontrast kommen, geben das wechsel-
volle Spiel einer Mondnacht aufs anschaulichste wieder. Dies ist gut hervorzuheben, da Solis in der Wiedergabe des
Lichtes nicht gerade bedeutend ist. An die feinen Übergänge von Licht und Schatten gar nicht zu denken. Besonders
unvermittelt stehen bei ihm die dicken Schattenschraffen vor der beleuchteten Fläche.
Zu diesen Illustrationen konnte ein eigentliches Vorbild nicht gefunden werden, doch soviel kann als sicher
gelten, daß hier ein direkter italienischer Einfluß nicht vorhanden ist, wie in den Handbüchern immer und wieder
behauptet wird. Gewiß erinnert manches an die Stecher der Raffael-Schule, Agostino Veneziano, Enea Vico und andere,
nach denen Solis auch einige Kupferstiche kopiert hat, aber eine italienische Vorlage hatte er nicht. Auch die alten
Ovid-Illustrationen aus der zweiten Hälfte des Quattrocento, die von Verlegern in Verona und Neapel herausgegeben
wurden, kannte er nicht. Ein italienisches Motiv dagegen, das bei Raffael wiederholt vorkommt, namentlich in den
Fresken in der Farnesina, ist der bei Göttern und Göttinnen immer wiederkehrende schleier- oder schleifenartige
Gewandteil, der im Wind gehoben, sich kreisbogenförmig an die Gestalt legt. Daß manche Figuren, insbesondere Könige
an die Holbeins in seinem »Alten Testament« gemahnen, wurde schon erwähnt, und so bleibt also nichts mehr zu tun
übrig, als eine — freilich bis jetzt noch nicht hervorgehobene Tatsache zu verzeichnen, daß sich nämlich eine Reihe
der hier dargestellten Szenen auf Kupferstichen Von Planeten (B. 170—176) wiederfindet, und zwar: Saturn: das
silberne Zeitalter und Deukalion und Pyrrha; Jupiter: die Götter aus der »Götterversammlung« (Blatt 6); Mars: die
Verwandlung der Schiffe in Nymphen und Atlas und Perseus; Sol: Phaethon und Venus und Adonis; Venus: die
Musen aus dem »Besuch der Pallas« und Jupiter und Callisto, Merkur und Argus, Apollo und Python; Luna: Neptun
und der Hermaphrodit. Es liegt nahe, daß diese Darstellungen auf eine gemeinsame Vorlage zurückgehen.
Bezeichnet sind nur 12 Blätter, einige tragen Zeichen von Holzschneidern; fünfmal kehrt das Zeichen -T, wieder.
Die im nächsten Jahre erschienene Ausgabe von »Reinecke Fuchs« enthält neben andern, offenbar aus der
Schule des Solis stammenden Illustrationen zwei bis jetzt noch nicht bekannt gewesene Blätter, die stilistisch und
ikonographisch den Übergang zum »Asop« bilden und darum von besonderem Werte sind. Sie sind beide bezeichnet
und müssen auch zuerst für den »Asop« gedacht worden sein, mit dessen Illustrationen auch die Maße überein-
stimmen; sie finden sich jedoch in keiner der beiden Ausgaben dieser Folge.
Der Vollständigkeit halber sei noch die Ausgabe des Plinius erwähnt, die 1567 herauskam und zahlreiche
Blätter aus dem »Ovid«, eines aus der Bibel (160) und auch schon drei aus dem »Äsop« enthält. Erst im folgenden
Jahr erschienen die beiden großen Äsop-Bücher, zu deren Besprechung wir nunmehr übergehen.
»Aesopi Phrygis fabulae«, »so sein letzter Riß gewesen«, — wie die Vorrede ausdrücklich betont— erschienen
zugleich in einer lateinischen und einer deutschen Ausgabe, die aber den lateinischen Titel beibehielt. Die erstere
umfaßt ohne die Wiederholungen 168 Blätter, von denen 107 mit dem Zeichen versehen sind, die letztere, die
Hartmann Schopper von Neumarkt herausgab, ist eigentlich eine bloße Zusammenstellung der Blätter ohne ver-
bindenden Text, an dessen Stelle wie bei den »Biblischen Figuren« schlechte Verse treten, doch kommen 14 neue
Illustrationen hinzu, darunter zehn signierte. In dieser Folge, deren Stil den Niedergang der Kunst des Solis deutlich
zeigt, ist es möglich, den Anteil der Schüler im allgemeinen festzustellen, und zwar müssen hier diejenigen Holz-
schnitte als nicht von Solis herrührend betrachtet werden, die kein Signum aufweisen (was sonst durchaus kein
Kriterium für nicht eigenhändige Arbeiten bildet, wie schon früher hervorgehoben wurde); natürlich gehören auch
bezeichnete zu dieser Gruppe, deren Hauptmerkmale in charakterlosen Konturen, Vernachlässigung der Modellierung,
geringer Andeutung des Hintergrundes und schematischer Behandlung der Tiefe und des Raumes zu erkennen sind.
Aber auch die sichern Blätter zeugen von erlahmender Kraft. Der feine, nie ermüdende Zeichner, der A'ogel und
, und
senkt, in
dem
Virgil Solis, Holzschnitt aus dem »Asop«
nmelten
gestürzt
nocli
deutlicher zeigt sich diese Kompositionsart auf Blatt 138, das die Geschichte
der Chione darstellt. Links ruht Chione in den Armen Merkurs, rechts steht
Apollon, dem sie sich gleichfalls in Liebe hingegeben hatte, der Hinter-
grund enthält nebeneinander die Geburt der zwei Kinder und Chiones Tod
in den Flammen.
Die Zeichnung der Blätter ist nicht durchaus zu loben; viele sind nach-
lässig in den Konturen, grob, charakterlos, Arbeiten eines Fa presto. Doch
bezieht sich dies in der Regel bloß auf die einzelnen Figuren. Sieht man
davon ab, so muß man freilich die glückliche Verteilung der Personen in
Gruppen und die gute Einordnung in die Landschaft rühmen. Ausge-
zeichnet ist auch hier wieder die Vertiefung des Raumes: weite Land-
schaften, denen der »biblischen Figuren« ähnlich, führen den Blick bis ans
Meer oder in eine Stadt mit Türmen und Burgen. Alle Charakteristika
Solis'scher Figurenholzschnitte: Bäume, Wasser, Wolken und ihr Boden finden sich wieder, dazu kommt als Vorzug
auf manchen Blättern eine gewandte Lichtdarstellung, die namentlich bei »Pyramus und Thisbe« und »Skylla vor
Minos« effektvoll, beinahe raffiniert zur Geltung gelangt. Große parallele horizontale Striche am Himmel und Gebäuden,
die zu weiß gelassenen Flächen am Boden, an Wänden und Kleidern in gutem Kontrast kommen, geben das wechsel-
volle Spiel einer Mondnacht aufs anschaulichste wieder. Dies ist gut hervorzuheben, da Solis in der Wiedergabe des
Lichtes nicht gerade bedeutend ist. An die feinen Übergänge von Licht und Schatten gar nicht zu denken. Besonders
unvermittelt stehen bei ihm die dicken Schattenschraffen vor der beleuchteten Fläche.
Zu diesen Illustrationen konnte ein eigentliches Vorbild nicht gefunden werden, doch soviel kann als sicher
gelten, daß hier ein direkter italienischer Einfluß nicht vorhanden ist, wie in den Handbüchern immer und wieder
behauptet wird. Gewiß erinnert manches an die Stecher der Raffael-Schule, Agostino Veneziano, Enea Vico und andere,
nach denen Solis auch einige Kupferstiche kopiert hat, aber eine italienische Vorlage hatte er nicht. Auch die alten
Ovid-Illustrationen aus der zweiten Hälfte des Quattrocento, die von Verlegern in Verona und Neapel herausgegeben
wurden, kannte er nicht. Ein italienisches Motiv dagegen, das bei Raffael wiederholt vorkommt, namentlich in den
Fresken in der Farnesina, ist der bei Göttern und Göttinnen immer wiederkehrende schleier- oder schleifenartige
Gewandteil, der im Wind gehoben, sich kreisbogenförmig an die Gestalt legt. Daß manche Figuren, insbesondere Könige
an die Holbeins in seinem »Alten Testament« gemahnen, wurde schon erwähnt, und so bleibt also nichts mehr zu tun
übrig, als eine — freilich bis jetzt noch nicht hervorgehobene Tatsache zu verzeichnen, daß sich nämlich eine Reihe
der hier dargestellten Szenen auf Kupferstichen Von Planeten (B. 170—176) wiederfindet, und zwar: Saturn: das
silberne Zeitalter und Deukalion und Pyrrha; Jupiter: die Götter aus der »Götterversammlung« (Blatt 6); Mars: die
Verwandlung der Schiffe in Nymphen und Atlas und Perseus; Sol: Phaethon und Venus und Adonis; Venus: die
Musen aus dem »Besuch der Pallas« und Jupiter und Callisto, Merkur und Argus, Apollo und Python; Luna: Neptun
und der Hermaphrodit. Es liegt nahe, daß diese Darstellungen auf eine gemeinsame Vorlage zurückgehen.
Bezeichnet sind nur 12 Blätter, einige tragen Zeichen von Holzschneidern; fünfmal kehrt das Zeichen -T, wieder.
Die im nächsten Jahre erschienene Ausgabe von »Reinecke Fuchs« enthält neben andern, offenbar aus der
Schule des Solis stammenden Illustrationen zwei bis jetzt noch nicht bekannt gewesene Blätter, die stilistisch und
ikonographisch den Übergang zum »Asop« bilden und darum von besonderem Werte sind. Sie sind beide bezeichnet
und müssen auch zuerst für den »Asop« gedacht worden sein, mit dessen Illustrationen auch die Maße überein-
stimmen; sie finden sich jedoch in keiner der beiden Ausgaben dieser Folge.
Der Vollständigkeit halber sei noch die Ausgabe des Plinius erwähnt, die 1567 herauskam und zahlreiche
Blätter aus dem »Ovid«, eines aus der Bibel (160) und auch schon drei aus dem »Äsop« enthält. Erst im folgenden
Jahr erschienen die beiden großen Äsop-Bücher, zu deren Besprechung wir nunmehr übergehen.
»Aesopi Phrygis fabulae«, »so sein letzter Riß gewesen«, — wie die Vorrede ausdrücklich betont— erschienen
zugleich in einer lateinischen und einer deutschen Ausgabe, die aber den lateinischen Titel beibehielt. Die erstere
umfaßt ohne die Wiederholungen 168 Blätter, von denen 107 mit dem Zeichen versehen sind, die letztere, die
Hartmann Schopper von Neumarkt herausgab, ist eigentlich eine bloße Zusammenstellung der Blätter ohne ver-
bindenden Text, an dessen Stelle wie bei den »Biblischen Figuren« schlechte Verse treten, doch kommen 14 neue
Illustrationen hinzu, darunter zehn signierte. In dieser Folge, deren Stil den Niedergang der Kunst des Solis deutlich
zeigt, ist es möglich, den Anteil der Schüler im allgemeinen festzustellen, und zwar müssen hier diejenigen Holz-
schnitte als nicht von Solis herrührend betrachtet werden, die kein Signum aufweisen (was sonst durchaus kein
Kriterium für nicht eigenhändige Arbeiten bildet, wie schon früher hervorgehoben wurde); natürlich gehören auch
bezeichnete zu dieser Gruppe, deren Hauptmerkmale in charakterlosen Konturen, Vernachlässigung der Modellierung,
geringer Andeutung des Hintergrundes und schematischer Behandlung der Tiefe und des Raumes zu erkennen sind.
Aber auch die sichern Blätter zeugen von erlahmender Kraft. Der feine, nie ermüdende Zeichner, der A'ogel und