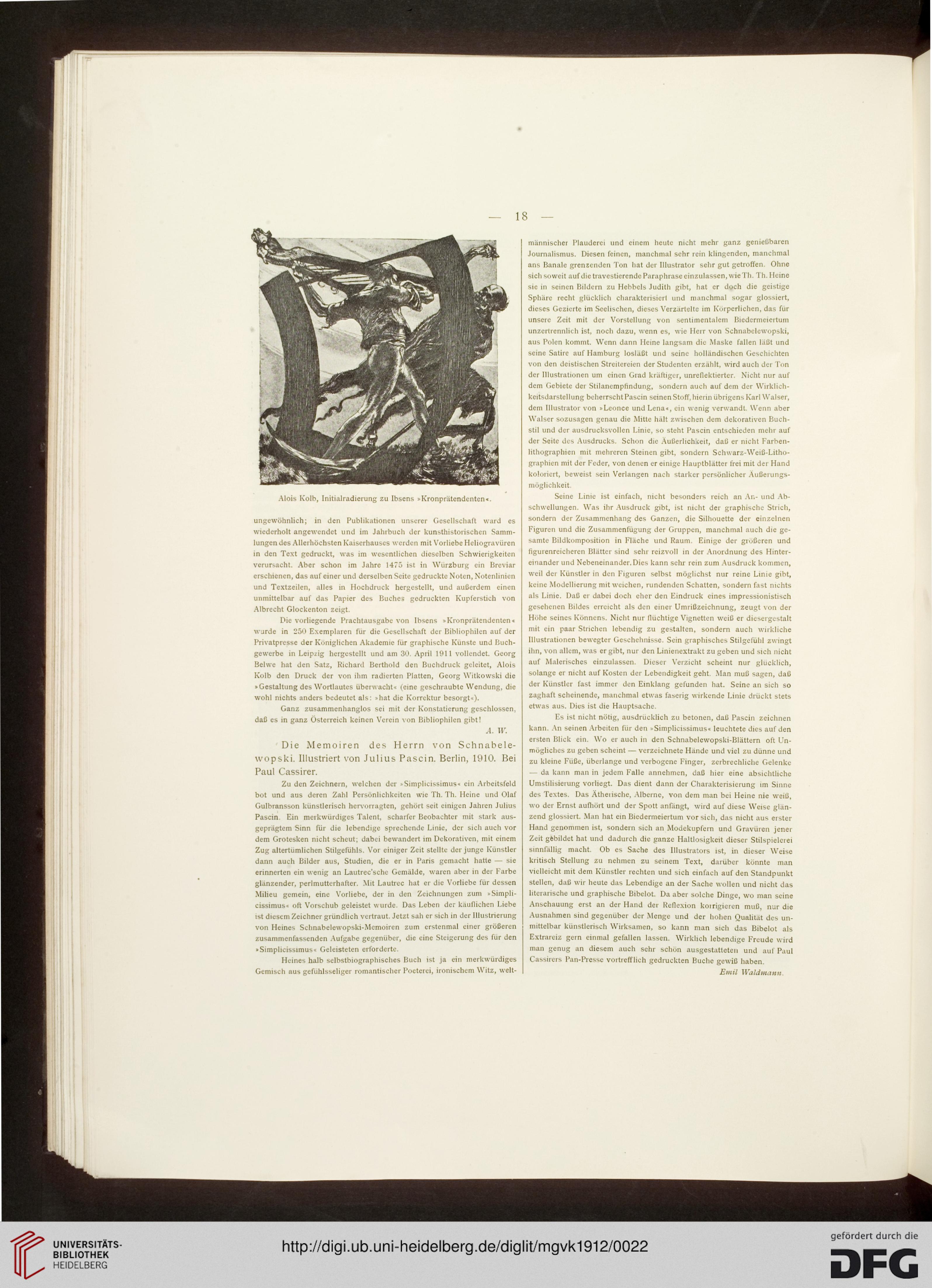— 18 —
Alois Kolb, Initialradierung zu Ibsens »Kronprätendenten«.
ungewöhnlich; in den Publikationen unserer Gesellschalt ward es
wiederholt angewendet und im Jahrbuch der kunsthistorischen Samm-
lungen des Allerhöchsten Kaiserhauses werden mit Vorliebe Heliogravüren
in den Text gedruckt, was im wesentlichen dieselben Schwierigkeiten
verursacht. Aber schon im Jahre 1475 ist in Würzburg ein Breviar
erschienen, das auf einer und derselben Seite gedruckte Noten, Notenlinien
und Textzeilen, alles in Hochdruck hergestellt, und außerdem einen
unmittelbar auf das Papier des Buches gedruckten Kupferstich von
Albrecht Glockenton zeigt.
Die vorliegende Prachtausgabe von Ibsens »Kronprätendenten«
wurde in 25" Exemplaren für die Gesellschaft der Bibliophilen auf der
Privatpresse der Königlichen Akademie für graphische Künste und Buch-
gewerbe in Leipzig hergestellt und am 30. April 1911 vollendet. Georg
Belwe hat den Satz, Richard Berthold den Buchdruck geleitet, Alois
Kolb den Druck der von ihm radierten Platten, Georg Witkowski die
»Gestaltung des Wortlautes überwacht« (eine geschraubte Wendung, die
wohl nichts anders bedeutet als: »hat die Korrektur besorgt«).
Ganz zusammenhanglos sei mit der Konstatierung geschlossen,
daß es in ganz Osterreich keinen Verein von Bibliophilen gibt!
.-1. W.
Die Memoiren des Herrn von Schnabele-
wopski. Illustriert von Julius Pascin. Berlin, 1910. Bei
Paul Cassirer.
Zu den Zeichnern, welchen der -.Simphcissimus« ein Arbeitsfeld
bot und aus deren Zahl Persönlichkeiten wie Th. Th. Heine und Olaf
Gulbransson künstlerisch hervorragten, gehört seit einigen Jahren Julius
Pascin. Ein meikwurdiges Talent, scharfer Beobachter mit stark aus-
geprägtem Sinn für die lebendige sprechende Linie, der sich auch vor
dem Grotesken nicht scheut; dabei bewandert im Dekorativen, mit einem
Zug altertumlichen Stilgefühls. Vor einiger Zeit stellte der junge Künstler
dann auch Bilder aus, Studien, die er in Paris gemacht hatte — sie
erinnerten ein wenig an Lautrec'sche Gemälde, waren aber in der Farbe
glänzender, perlmutterhafter. Mit Lautrec hat er die Vorliebe für dessen
Milieu gemein, eine Vorliebe, der in den Zeichnungen zum »Simpli-
cissimus- oft Vorschub geleistet wurde. Das Leben der kauflichen Liebe
ist diesem Zeichner gründlich vertraut. Jetzt sah er sich in der Illustnerung
von Heines Schnabelewopski-Memoiren zum erstenmal einer größeren
zusammenfassenden Aufgabe gegenüber, die eine Steigerung des für den
»Simplicissimus« Geleisteten erforderte.
Heines halb selbstbiographisches Buch ist ja ein merkwürdiges
Gemisch aus gefühlsseliger romantischer Poeterei, ironischem Witz, welt-
männischer Plauderei und einem heute nicht mehr ganz genießbaren
Journalismus. Diesen feinen, manchmal sehr rein klingenden, manchmal
ans Banale grenzenden Ton hat der Illustrator sehr gut getroffen. Ohne
sich soweit auf die travestierende Paraphrase einzulassen, wie Th. Th. Heine
sie in seinen Bildern zu Hebbels Judith gibt, hat er doch die geistige
Sphäre recht glücklich charakterisiert und manchmal sogar glossiert,
dieses Gezierte im Seelischen, dieses Verzärtelte im Kurperlichen, das für
unsere Zeit mit der Vorstellung von sentimentalem Biedermeiertum
unzertrennlich ist, noch dazu, wenn es, wie Herr von Schnabelewopski,
aus Polen kommt. Wenn dann Heine langsam die Maske fallen läßt und
seine Satire auf Hamburg losläßt und seine holländischen Geschichten
von den deistischen Streitereien der Studenten erzählt, wird auch der Tun
der Illustrationen um einen Grad kräftiger, unreflektierter, Nicht nur auf
dem Gebiete der Stilancmphndung, sondern auch auf dem der Wirklich-
keitsdarstellung beherrscht Pascin seinen Stoff, hierin übrigens Karl Walser,
dem Illustrator von »Leonce und Lena«, ein wenig verwandt. Wenn aber
Walser sozusagen genau die Mitte halt zwischen dem dekorativen Buch-
stil und der ausdrucksvollen Linie, so steht Pascin entschieden mehr auf
der Seite des Ausdrucks. Schon die Äußerlichkeit, daß er nicht Farhen-
lithographien mit mehreren Steinen gibt, sondern Schwarz-Weiß-Litho-
graphien mit der Feder, von denen er einige Hauptblätter frei mit der Hand
koloriert, beweist sein Verlangen nach starker persönlicher Außerungs-
moglichkeit.
Seine Linie ist einfach, nicht besonders reich an An- und Ab-
schwellungen. Was ihr Ausdruck gibt, ist nicht der graphische Strich,
sondern der Zusammenhang des Ganzen, die Silhouette der einzelnen
Figuren und die Zusammenlegung der Gruppen, manchmal auch die ge-
samte Bildkomposition in Fläche und Raum. Einige der größeren und
figuienreichercn Blätter sind sehr reizvoll in der Anordnung des Hinter-
einander und Nebeneinander.Dies kann sehr rein zum Ausdruck kommen,
weil der Künstler in den Figuren selbst möglichst nur reine Linie gibt,
keine Modellierung mit weichen, rundenden Schatten, sondern fast nichts
als Linie. Daß er dabei doch eher den Eindruck eines impressionistisch
gesehenen Bildes erreicht als den einer Umrißzeichnung, zeugt von der
Höhe seines Könnens. Nicht nur fluchtige Vignetten weiß er diesergestalt
mit ein paar Strichen lebendig zu gestalten, sondern auch wirkliche
Illustrationen bewegter Geschehnisse. Sein graphisches Stilgefühl zwingt
ihn, von allem, was er gibt, nur den Linienextrakt zu geben und sich nicht
auf Malerisches einzulassen. Dieser Verzicht scheint nur glücklich,
solange er nicht auf Kosten der Lebendigkeit geht. Man muß sagen, daß
der Kunstler fast immer den Einklang gefunden hat. Seine an sich so
zaghaft scheinende, manchmal etwas faserig wirkende Linie drückt stets
etwas aus. Dies ist die Hauptsache.
Es ist nicht nötig, ausdrucklich zu betonen, daß Pascin zeichnen
kann. An seinen Arbeiten für den »Simplicissimus« leuchtete dies auf den
ersten Blick ein. Wo er auch in den Schnabelewopski-Blättern oft Un-
mögliches zu geben scheint — verzeichnete Hände und viel zu dünne und
zu kleine Füße, überlange und verbogene Finger, zerbrechliche Gelenke
— da kann man in jedem Falle annehmen, daß hier eine absichtliche
Umstilisieiung vorliegt. Das dient dann der Charakterisierung im Sinne
des Textes. Das Ätherische, Alberne, von dem man bei Heine nie weiß,
wo der Ernst aufhört und der Spott anfangt, wird auf diese Weise glän-
zend glossiert. Man hat em Biedermeiertum vor sich, das nicht aus erster
Hand genommen ist, sondern sich an Modekupfern und Gravüren jener
Zeit gebildet hat und dadurch die ganze Haltlosigkeit dieser Stilspielerei
sinnfällig macht. Ob es Sache des Illustrators ist, in dieser Weise
kritisch Stellung zu nehmen zu seinem Text, darüber konnte man
vielleicht mit dem Künstler rechten und sich einfach auf den Standpunkt
stellen, daß wir heute das Lebendige an der Sache wollen und nicht das
literarische und graphische Bibelot. Da aber solche Dinge, wo man seine
Anschauung erst an der Hand der Reflexion koirigieren muß, nur die
Ausnahmen sind gegenüber der Menge und der hohen Qualität des un-
mittelbar künstlerisch Wirksamen, so kann man sich das Bibelot als
Extrareiz gern einmal gefallen lassen. Wirklich lebendige Freude wird
man genug an diesem auch sehr schun ausgestatteten und aul Paul
Cassirers Pan-Presse vortrefflich gedruckten Buche gewiß haben.
Emil Waldmann
Alois Kolb, Initialradierung zu Ibsens »Kronprätendenten«.
ungewöhnlich; in den Publikationen unserer Gesellschalt ward es
wiederholt angewendet und im Jahrbuch der kunsthistorischen Samm-
lungen des Allerhöchsten Kaiserhauses werden mit Vorliebe Heliogravüren
in den Text gedruckt, was im wesentlichen dieselben Schwierigkeiten
verursacht. Aber schon im Jahre 1475 ist in Würzburg ein Breviar
erschienen, das auf einer und derselben Seite gedruckte Noten, Notenlinien
und Textzeilen, alles in Hochdruck hergestellt, und außerdem einen
unmittelbar auf das Papier des Buches gedruckten Kupferstich von
Albrecht Glockenton zeigt.
Die vorliegende Prachtausgabe von Ibsens »Kronprätendenten«
wurde in 25" Exemplaren für die Gesellschaft der Bibliophilen auf der
Privatpresse der Königlichen Akademie für graphische Künste und Buch-
gewerbe in Leipzig hergestellt und am 30. April 1911 vollendet. Georg
Belwe hat den Satz, Richard Berthold den Buchdruck geleitet, Alois
Kolb den Druck der von ihm radierten Platten, Georg Witkowski die
»Gestaltung des Wortlautes überwacht« (eine geschraubte Wendung, die
wohl nichts anders bedeutet als: »hat die Korrektur besorgt«).
Ganz zusammenhanglos sei mit der Konstatierung geschlossen,
daß es in ganz Osterreich keinen Verein von Bibliophilen gibt!
.-1. W.
Die Memoiren des Herrn von Schnabele-
wopski. Illustriert von Julius Pascin. Berlin, 1910. Bei
Paul Cassirer.
Zu den Zeichnern, welchen der -.Simphcissimus« ein Arbeitsfeld
bot und aus deren Zahl Persönlichkeiten wie Th. Th. Heine und Olaf
Gulbransson künstlerisch hervorragten, gehört seit einigen Jahren Julius
Pascin. Ein meikwurdiges Talent, scharfer Beobachter mit stark aus-
geprägtem Sinn für die lebendige sprechende Linie, der sich auch vor
dem Grotesken nicht scheut; dabei bewandert im Dekorativen, mit einem
Zug altertumlichen Stilgefühls. Vor einiger Zeit stellte der junge Künstler
dann auch Bilder aus, Studien, die er in Paris gemacht hatte — sie
erinnerten ein wenig an Lautrec'sche Gemälde, waren aber in der Farbe
glänzender, perlmutterhafter. Mit Lautrec hat er die Vorliebe für dessen
Milieu gemein, eine Vorliebe, der in den Zeichnungen zum »Simpli-
cissimus- oft Vorschub geleistet wurde. Das Leben der kauflichen Liebe
ist diesem Zeichner gründlich vertraut. Jetzt sah er sich in der Illustnerung
von Heines Schnabelewopski-Memoiren zum erstenmal einer größeren
zusammenfassenden Aufgabe gegenüber, die eine Steigerung des für den
»Simplicissimus« Geleisteten erforderte.
Heines halb selbstbiographisches Buch ist ja ein merkwürdiges
Gemisch aus gefühlsseliger romantischer Poeterei, ironischem Witz, welt-
männischer Plauderei und einem heute nicht mehr ganz genießbaren
Journalismus. Diesen feinen, manchmal sehr rein klingenden, manchmal
ans Banale grenzenden Ton hat der Illustrator sehr gut getroffen. Ohne
sich soweit auf die travestierende Paraphrase einzulassen, wie Th. Th. Heine
sie in seinen Bildern zu Hebbels Judith gibt, hat er doch die geistige
Sphäre recht glücklich charakterisiert und manchmal sogar glossiert,
dieses Gezierte im Seelischen, dieses Verzärtelte im Kurperlichen, das für
unsere Zeit mit der Vorstellung von sentimentalem Biedermeiertum
unzertrennlich ist, noch dazu, wenn es, wie Herr von Schnabelewopski,
aus Polen kommt. Wenn dann Heine langsam die Maske fallen läßt und
seine Satire auf Hamburg losläßt und seine holländischen Geschichten
von den deistischen Streitereien der Studenten erzählt, wird auch der Tun
der Illustrationen um einen Grad kräftiger, unreflektierter, Nicht nur auf
dem Gebiete der Stilancmphndung, sondern auch auf dem der Wirklich-
keitsdarstellung beherrscht Pascin seinen Stoff, hierin übrigens Karl Walser,
dem Illustrator von »Leonce und Lena«, ein wenig verwandt. Wenn aber
Walser sozusagen genau die Mitte halt zwischen dem dekorativen Buch-
stil und der ausdrucksvollen Linie, so steht Pascin entschieden mehr auf
der Seite des Ausdrucks. Schon die Äußerlichkeit, daß er nicht Farhen-
lithographien mit mehreren Steinen gibt, sondern Schwarz-Weiß-Litho-
graphien mit der Feder, von denen er einige Hauptblätter frei mit der Hand
koloriert, beweist sein Verlangen nach starker persönlicher Außerungs-
moglichkeit.
Seine Linie ist einfach, nicht besonders reich an An- und Ab-
schwellungen. Was ihr Ausdruck gibt, ist nicht der graphische Strich,
sondern der Zusammenhang des Ganzen, die Silhouette der einzelnen
Figuren und die Zusammenlegung der Gruppen, manchmal auch die ge-
samte Bildkomposition in Fläche und Raum. Einige der größeren und
figuienreichercn Blätter sind sehr reizvoll in der Anordnung des Hinter-
einander und Nebeneinander.Dies kann sehr rein zum Ausdruck kommen,
weil der Künstler in den Figuren selbst möglichst nur reine Linie gibt,
keine Modellierung mit weichen, rundenden Schatten, sondern fast nichts
als Linie. Daß er dabei doch eher den Eindruck eines impressionistisch
gesehenen Bildes erreicht als den einer Umrißzeichnung, zeugt von der
Höhe seines Könnens. Nicht nur fluchtige Vignetten weiß er diesergestalt
mit ein paar Strichen lebendig zu gestalten, sondern auch wirkliche
Illustrationen bewegter Geschehnisse. Sein graphisches Stilgefühl zwingt
ihn, von allem, was er gibt, nur den Linienextrakt zu geben und sich nicht
auf Malerisches einzulassen. Dieser Verzicht scheint nur glücklich,
solange er nicht auf Kosten der Lebendigkeit geht. Man muß sagen, daß
der Kunstler fast immer den Einklang gefunden hat. Seine an sich so
zaghaft scheinende, manchmal etwas faserig wirkende Linie drückt stets
etwas aus. Dies ist die Hauptsache.
Es ist nicht nötig, ausdrucklich zu betonen, daß Pascin zeichnen
kann. An seinen Arbeiten für den »Simplicissimus« leuchtete dies auf den
ersten Blick ein. Wo er auch in den Schnabelewopski-Blättern oft Un-
mögliches zu geben scheint — verzeichnete Hände und viel zu dünne und
zu kleine Füße, überlange und verbogene Finger, zerbrechliche Gelenke
— da kann man in jedem Falle annehmen, daß hier eine absichtliche
Umstilisieiung vorliegt. Das dient dann der Charakterisierung im Sinne
des Textes. Das Ätherische, Alberne, von dem man bei Heine nie weiß,
wo der Ernst aufhört und der Spott anfangt, wird auf diese Weise glän-
zend glossiert. Man hat em Biedermeiertum vor sich, das nicht aus erster
Hand genommen ist, sondern sich an Modekupfern und Gravüren jener
Zeit gebildet hat und dadurch die ganze Haltlosigkeit dieser Stilspielerei
sinnfällig macht. Ob es Sache des Illustrators ist, in dieser Weise
kritisch Stellung zu nehmen zu seinem Text, darüber konnte man
vielleicht mit dem Künstler rechten und sich einfach auf den Standpunkt
stellen, daß wir heute das Lebendige an der Sache wollen und nicht das
literarische und graphische Bibelot. Da aber solche Dinge, wo man seine
Anschauung erst an der Hand der Reflexion koirigieren muß, nur die
Ausnahmen sind gegenüber der Menge und der hohen Qualität des un-
mittelbar künstlerisch Wirksamen, so kann man sich das Bibelot als
Extrareiz gern einmal gefallen lassen. Wirklich lebendige Freude wird
man genug an diesem auch sehr schun ausgestatteten und aul Paul
Cassirers Pan-Presse vortrefflich gedruckten Buche gewiß haben.
Emil Waldmann