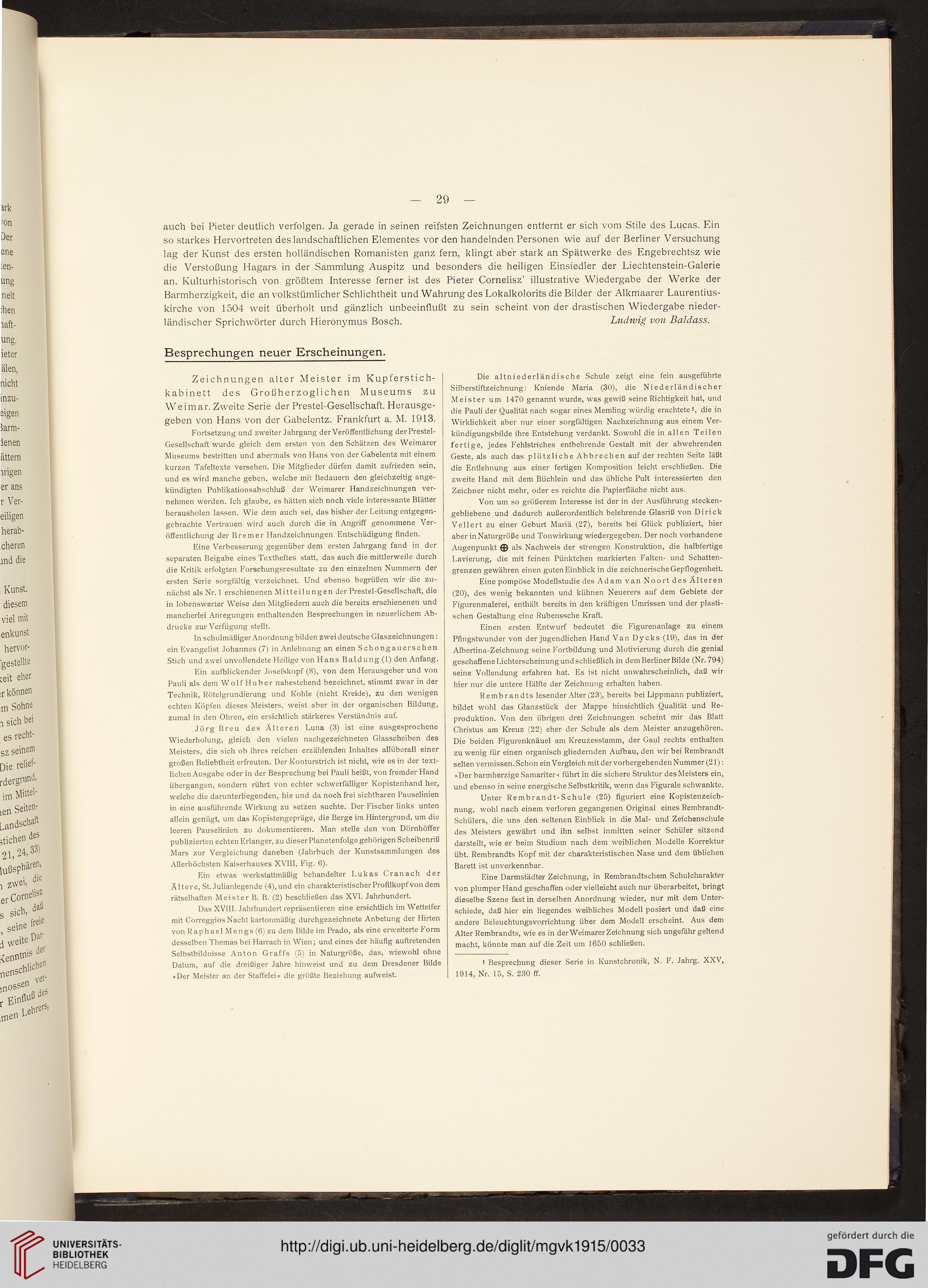— 29 —
auch bei Pieter deutlich verfolgen. Ja gerade in seinen reifsten Zeichnungen entfernt er sich vom Stile des Lucas. Ein
so starkes Hervortreten des landschaftlichen Elementes vor den handelnden Personen wie auf der Berliner Versuchung
lag der Kunst des ersten holländischen Romanisten ganz fern, klingt aber stark an Spätwerke des Engebrechtsz wie
die Verstoßung Hagars in der Sammlung Auspitz und besonders die heiligen Einsiedler der Liechtenstein-Galerie
an. Kulturhistorisch von größtem Interesse ferner ist des Pieter Cornelisz' illustrative Wiedergabe der Werke der
Barmherzigkeit, die an volkstümlicher Schlichtheit und Wahrung des Lokalkolorits die Bilder der Alkmaarer Laurentius-
kirche von 1504 weit überholt und gänzlich unbeeinflußt zu sein scheint von der drastischen Wiedergabe nieder-
ländischer Sprichwörter durch Hieronymus Bosch. Ludwig von Baldass.
Besprechungen neuer Erscheinungen.
des
daß
freie
Zeichnungen alter Meister im Kupferstich-
kabinett des Großherzoglichen Museums zu
Weimar. Zweite Serie der Prestel-Gesellschaft. Herausge-
geben von Hans von der Gabelentz. Frankfurt a. M. 1913.
Fortsetzung und zweiter Jahrgang der Veröffentlichung der Prestel-
Gesellschaft wurde gleich dem ersten von den Schätzen des Weimarer
Museums bestritten und abermals von Hans von der Gabelentz mit einem
kurzen Tafeltexte versehen. Die Mitglieder dürfen damit zufrieden sein,
und es wird manche geben, welche mit Bedauern den gleichzeitig ange-
kündigten Publikationsabschluß der Weimarer Handzeichnungen ver-
nehmen werden. Ich glaube, es hätten sich noch viele interessante Blätter
herausholen lassen. Wie dem auch sei, das bisher der Leitung entgegen-
gebrachte Vertrauen wird auch durch die in Angriff genommene Ver-
öffentlichung der Bremer Handzeichnungen Entschädigung finden.
Eine Verbesserung gegenüber dem ersten Jahrgang fand in der
separaten Beigabe eines Textheftes statt, das auch die mittlerweile durch
die Kritik erfolgten Forschungsresultate zu den einzelnen Nummern der
ersten Serie sorgfältig verzeichnet. Und ebenso begrüßen wir die zu-
nächst als Nr. 1 erschienenen Mitteilungen der Prestel-Gesellschaft, die
in lobenswerter Weise den Mitgliedern auch die bereits erschienenen und
mancherlei Anregungen enthaltenden Besprechungen in neuerlichem Ab-
drucke zur Verfügung stellt.
In schulmäßiger Anordnung bilden zwei deutsche Glaszeichnungen:
ein Evangelist Johannes (7) in Anlehnung an einen Schongauerschen
Stich und zwei unvollendete Heilige von Hans Baidung (1) den Anfang.
Ein aufblickender Josefskopf (8), von dem Herausgeber und von
Pauli als dem Wolf Huber nahestehend bezeichnet, stimmt zwar in der
Technik, Rötelgrundierung und Kohle (nicht Kreide), zu den wenigen
echten Köpfen dieses Meisters, weist aber in der organischen Bildung,
zumal in den Ohren, ein ersichtlich stärkeres Verständnis auf.
Jörg Breu des Älteren Luna (3) ist eine ausgesprochene
Wiederholung, gleich den vielen nachgezeichneten Glasscheiben des
Meisters, die sich ob ihres reichen erzählenden Inhaltes allüberall einer
großen Beliebtheit erfreuten. Der Konturstrich ist nicht, wie es in der text-
lichen Ausgabe oder in der Besprechung bei Pauli heißt, von fremder Hand
übergangen, sondern rührt von echter schwerfälliger Kopistenhand her,
welche die darunterliegenden, hie und da noch frei sichtbaren Pauselinien
in eine ausführende Wirkung zu setzen suchte. Der Fischer links unten
allein genügt, um das Kopistengepräge, die Berge im Hintergrund, um die
leeren Pauselinien zu dokumentieren. Man stelle den von Dürnhöffer
publizierten echten Erlanger, zu dieserPlanetenfolge gehörigen Scheibenriß
Mars zur Vergleichung daneben (Jahrbuch der Kunstsammlungen des
Allerhöchsten Kaiserhauses XVIII, Fig. 6).
Ein etwas werkstattmäßig behandelter Lukas Cranach der
Ältere, St. Julianlegende (4), und ein charakteristischer Profilkopf von dem
rätselhaften Meister B. B. (2) beschließen das XVI. Jahrhundert.
Das XVIII. Jahrhundert repräsentieren eine ersichtlich im Wetteifer
mit Correggios Nacht kartonmäßig durchgezeichnete Anbetung der Hirten
von Raphael Mengs (6) zu dem Bilde im Prado, als eine erweiterte Form
desselben Themas bei Harrach in Wien; und eines der häufig auftretenden
Selbstbildnisse Anton Graffs (5) in Naturgröße, das, wiewohl ohne
Datum, auf die dreißiger Jahre hinweist und zu dem Dresdener Bilde
»Der Meister an der Staffelei die größte Beziehung aufweist.
Die altniederländische Schule zeigt eine fein ausgeführte
Silberstiftzeichnung: Kniende Maria (30), die Niederländischer
Meister um 1470 genannt wurde, was gewiß seine Richtigkeil hat, und
die Pauli der Qualität nach sogar eines Memling würdig erachtete *, die in
Wirklichkeit aber nur einer sorgfältigen Nachzeichnung aus einem Ver-
kündigungsbilde ihre Entstehung verdankt. Sowohl die in allen Teilen
fertige, jedes Fehlstriches entbehrende Gestalt mit der abwehrenden
Geste, als auch das plötzliche Abbrechen auf der rechten Seite läßt
die Entlehnung aus einer fertigen Komposition leicht erschließen. Die
zweite Hand mit dem Büchlein und das übliche Pult interessierten den
Zeichner nicht mehr, oder es reichte die Papierfläche nicht aus.
Von um so größerem Interesse ist der in der Ausführung stecken-
gebliebene und dadurch außerordentlich belehrende Glasriß von Dirick
Vellert zu einer Geburt Maria (27), bereits bei Glück publiziert, hier
aber in Naturgrüße und Tonwirkung wiedergegeben. Der noch vorhandene
Augenpunkt © als Nachweis der strengen Konstruktion, die halbfertige
Lavierung, die mit feinen Pünktchen markierten Falten- und Schatten-
grenzen gewähren einen guten Einblick in die zeichnerische Gepflogenheit.
Eine pompöse Modellstudie des Adam van Noort des Älteren
(20), des wenig bekannten und kühnen Neuerers auf dem Gebiete der
Figurenmalerei, enthält bereits in den kräftigen Umrissen und der plasti-
schen Gestaltung eine Rubenssche Kraft.
Einen ersten Entwurf bedeutet die Figurenanlage zu einem
Pfingstwunder von der jugendlichen Hand Van Dycks (19), das in der
Albertina-Zeichnung seine Fortbildung und Motivierung durch die genial
geschaffene Lichterscheinung und schließlich in dem Berliner Bilde (Nr. 794)
seine Vollendung erfahren hat. Es ist nicht unwahrscheinlich, daß wir
hier nur die untere Hälfte der Zeichnung erhalten haben.
Rembrandts lesender Alter (23), bereits bei Lippmann publiziert,
bildet wohl das Glanzstück der Mappe hinsichtlich Qualität und Re-
produktion. Von den übrigen drei Zeichnungen scheint mir das Blatt
Christus am Kreuz (22) eher der Schule als dem Meister anzugehören.
Die beiden Figurenknäuel am Kreuzesstamm, der Gaul rechts enthalten
zuwenig für einen organisch gliedernden Aufbau, den wir bei Rembrandt
selten vermissen. Schon ein Vergleich mit der vorhergehenden Nummer (21):
»Der barmherzige Samariter« führt in die sichere Struktur desMeisters ein,
und ebenso in seine energische Selbstkritik, wenn das Figurale schwankte.
Unter Rembrandt-Schule (25) figuriert eine Kopistenzeich-
nung, wohl nach einem verloren gegangenen Original eines Rembrandt-
Schülers, die uns den seltenen Einblick in die Mal- und Zeichenschule
des Meisters gewährt und ihn selbst inmitten seiner Schüler sitzend
darstellt, wie er beim Studium nach dem weiblichen Modelle Korrektur
übt. Rembrandts Kopf mit der charakteristischen Nase und dem üblichen
Barett ist unverkennbar.
Eine Darmstädter Zeichnung, in Rembrandtschem Schulcharakter
von plumper Hand geschaffen oder vielleicht auch nur überarbeitet, bringt
dieselbe Szene fast in derselben Anordnung wieder, nur mit dem Unter-
schiede, daß hier ein liegendes weibliches Modell posiert und daß eine
andere Beleuchtungsvorrichtung über dem Modell erscheint. Aus dem
Alter Rembrandts, wie es in der Weimarer Zeichnung sich ungefähr geltend
macht, könnte man auf die Zeit um 1650 schließen.
1 Besprechung dieser Serie in Kunstchronik, N. F. Jahrg. XXV,
1914, Nr. 15, S. 230 ff.
auch bei Pieter deutlich verfolgen. Ja gerade in seinen reifsten Zeichnungen entfernt er sich vom Stile des Lucas. Ein
so starkes Hervortreten des landschaftlichen Elementes vor den handelnden Personen wie auf der Berliner Versuchung
lag der Kunst des ersten holländischen Romanisten ganz fern, klingt aber stark an Spätwerke des Engebrechtsz wie
die Verstoßung Hagars in der Sammlung Auspitz und besonders die heiligen Einsiedler der Liechtenstein-Galerie
an. Kulturhistorisch von größtem Interesse ferner ist des Pieter Cornelisz' illustrative Wiedergabe der Werke der
Barmherzigkeit, die an volkstümlicher Schlichtheit und Wahrung des Lokalkolorits die Bilder der Alkmaarer Laurentius-
kirche von 1504 weit überholt und gänzlich unbeeinflußt zu sein scheint von der drastischen Wiedergabe nieder-
ländischer Sprichwörter durch Hieronymus Bosch. Ludwig von Baldass.
Besprechungen neuer Erscheinungen.
des
daß
freie
Zeichnungen alter Meister im Kupferstich-
kabinett des Großherzoglichen Museums zu
Weimar. Zweite Serie der Prestel-Gesellschaft. Herausge-
geben von Hans von der Gabelentz. Frankfurt a. M. 1913.
Fortsetzung und zweiter Jahrgang der Veröffentlichung der Prestel-
Gesellschaft wurde gleich dem ersten von den Schätzen des Weimarer
Museums bestritten und abermals von Hans von der Gabelentz mit einem
kurzen Tafeltexte versehen. Die Mitglieder dürfen damit zufrieden sein,
und es wird manche geben, welche mit Bedauern den gleichzeitig ange-
kündigten Publikationsabschluß der Weimarer Handzeichnungen ver-
nehmen werden. Ich glaube, es hätten sich noch viele interessante Blätter
herausholen lassen. Wie dem auch sei, das bisher der Leitung entgegen-
gebrachte Vertrauen wird auch durch die in Angriff genommene Ver-
öffentlichung der Bremer Handzeichnungen Entschädigung finden.
Eine Verbesserung gegenüber dem ersten Jahrgang fand in der
separaten Beigabe eines Textheftes statt, das auch die mittlerweile durch
die Kritik erfolgten Forschungsresultate zu den einzelnen Nummern der
ersten Serie sorgfältig verzeichnet. Und ebenso begrüßen wir die zu-
nächst als Nr. 1 erschienenen Mitteilungen der Prestel-Gesellschaft, die
in lobenswerter Weise den Mitgliedern auch die bereits erschienenen und
mancherlei Anregungen enthaltenden Besprechungen in neuerlichem Ab-
drucke zur Verfügung stellt.
In schulmäßiger Anordnung bilden zwei deutsche Glaszeichnungen:
ein Evangelist Johannes (7) in Anlehnung an einen Schongauerschen
Stich und zwei unvollendete Heilige von Hans Baidung (1) den Anfang.
Ein aufblickender Josefskopf (8), von dem Herausgeber und von
Pauli als dem Wolf Huber nahestehend bezeichnet, stimmt zwar in der
Technik, Rötelgrundierung und Kohle (nicht Kreide), zu den wenigen
echten Köpfen dieses Meisters, weist aber in der organischen Bildung,
zumal in den Ohren, ein ersichtlich stärkeres Verständnis auf.
Jörg Breu des Älteren Luna (3) ist eine ausgesprochene
Wiederholung, gleich den vielen nachgezeichneten Glasscheiben des
Meisters, die sich ob ihres reichen erzählenden Inhaltes allüberall einer
großen Beliebtheit erfreuten. Der Konturstrich ist nicht, wie es in der text-
lichen Ausgabe oder in der Besprechung bei Pauli heißt, von fremder Hand
übergangen, sondern rührt von echter schwerfälliger Kopistenhand her,
welche die darunterliegenden, hie und da noch frei sichtbaren Pauselinien
in eine ausführende Wirkung zu setzen suchte. Der Fischer links unten
allein genügt, um das Kopistengepräge, die Berge im Hintergrund, um die
leeren Pauselinien zu dokumentieren. Man stelle den von Dürnhöffer
publizierten echten Erlanger, zu dieserPlanetenfolge gehörigen Scheibenriß
Mars zur Vergleichung daneben (Jahrbuch der Kunstsammlungen des
Allerhöchsten Kaiserhauses XVIII, Fig. 6).
Ein etwas werkstattmäßig behandelter Lukas Cranach der
Ältere, St. Julianlegende (4), und ein charakteristischer Profilkopf von dem
rätselhaften Meister B. B. (2) beschließen das XVI. Jahrhundert.
Das XVIII. Jahrhundert repräsentieren eine ersichtlich im Wetteifer
mit Correggios Nacht kartonmäßig durchgezeichnete Anbetung der Hirten
von Raphael Mengs (6) zu dem Bilde im Prado, als eine erweiterte Form
desselben Themas bei Harrach in Wien; und eines der häufig auftretenden
Selbstbildnisse Anton Graffs (5) in Naturgröße, das, wiewohl ohne
Datum, auf die dreißiger Jahre hinweist und zu dem Dresdener Bilde
»Der Meister an der Staffelei die größte Beziehung aufweist.
Die altniederländische Schule zeigt eine fein ausgeführte
Silberstiftzeichnung: Kniende Maria (30), die Niederländischer
Meister um 1470 genannt wurde, was gewiß seine Richtigkeil hat, und
die Pauli der Qualität nach sogar eines Memling würdig erachtete *, die in
Wirklichkeit aber nur einer sorgfältigen Nachzeichnung aus einem Ver-
kündigungsbilde ihre Entstehung verdankt. Sowohl die in allen Teilen
fertige, jedes Fehlstriches entbehrende Gestalt mit der abwehrenden
Geste, als auch das plötzliche Abbrechen auf der rechten Seite läßt
die Entlehnung aus einer fertigen Komposition leicht erschließen. Die
zweite Hand mit dem Büchlein und das übliche Pult interessierten den
Zeichner nicht mehr, oder es reichte die Papierfläche nicht aus.
Von um so größerem Interesse ist der in der Ausführung stecken-
gebliebene und dadurch außerordentlich belehrende Glasriß von Dirick
Vellert zu einer Geburt Maria (27), bereits bei Glück publiziert, hier
aber in Naturgrüße und Tonwirkung wiedergegeben. Der noch vorhandene
Augenpunkt © als Nachweis der strengen Konstruktion, die halbfertige
Lavierung, die mit feinen Pünktchen markierten Falten- und Schatten-
grenzen gewähren einen guten Einblick in die zeichnerische Gepflogenheit.
Eine pompöse Modellstudie des Adam van Noort des Älteren
(20), des wenig bekannten und kühnen Neuerers auf dem Gebiete der
Figurenmalerei, enthält bereits in den kräftigen Umrissen und der plasti-
schen Gestaltung eine Rubenssche Kraft.
Einen ersten Entwurf bedeutet die Figurenanlage zu einem
Pfingstwunder von der jugendlichen Hand Van Dycks (19), das in der
Albertina-Zeichnung seine Fortbildung und Motivierung durch die genial
geschaffene Lichterscheinung und schließlich in dem Berliner Bilde (Nr. 794)
seine Vollendung erfahren hat. Es ist nicht unwahrscheinlich, daß wir
hier nur die untere Hälfte der Zeichnung erhalten haben.
Rembrandts lesender Alter (23), bereits bei Lippmann publiziert,
bildet wohl das Glanzstück der Mappe hinsichtlich Qualität und Re-
produktion. Von den übrigen drei Zeichnungen scheint mir das Blatt
Christus am Kreuz (22) eher der Schule als dem Meister anzugehören.
Die beiden Figurenknäuel am Kreuzesstamm, der Gaul rechts enthalten
zuwenig für einen organisch gliedernden Aufbau, den wir bei Rembrandt
selten vermissen. Schon ein Vergleich mit der vorhergehenden Nummer (21):
»Der barmherzige Samariter« führt in die sichere Struktur desMeisters ein,
und ebenso in seine energische Selbstkritik, wenn das Figurale schwankte.
Unter Rembrandt-Schule (25) figuriert eine Kopistenzeich-
nung, wohl nach einem verloren gegangenen Original eines Rembrandt-
Schülers, die uns den seltenen Einblick in die Mal- und Zeichenschule
des Meisters gewährt und ihn selbst inmitten seiner Schüler sitzend
darstellt, wie er beim Studium nach dem weiblichen Modelle Korrektur
übt. Rembrandts Kopf mit der charakteristischen Nase und dem üblichen
Barett ist unverkennbar.
Eine Darmstädter Zeichnung, in Rembrandtschem Schulcharakter
von plumper Hand geschaffen oder vielleicht auch nur überarbeitet, bringt
dieselbe Szene fast in derselben Anordnung wieder, nur mit dem Unter-
schiede, daß hier ein liegendes weibliches Modell posiert und daß eine
andere Beleuchtungsvorrichtung über dem Modell erscheint. Aus dem
Alter Rembrandts, wie es in der Weimarer Zeichnung sich ungefähr geltend
macht, könnte man auf die Zeit um 1650 schließen.
1 Besprechung dieser Serie in Kunstchronik, N. F. Jahrg. XXV,
1914, Nr. 15, S. 230 ff.