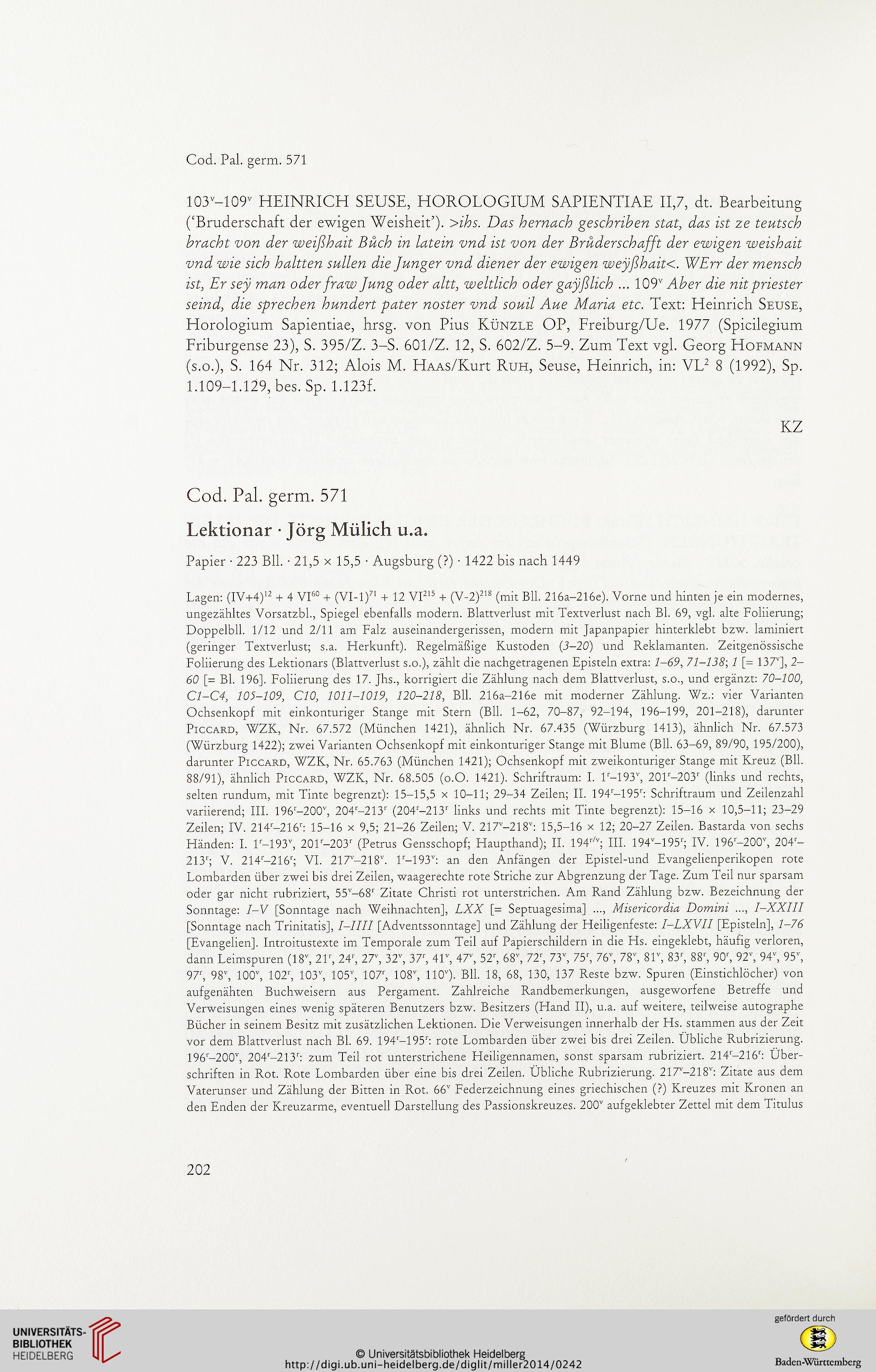Cod. Pal. eerm. 571
103 v—109 v HEINRICH SEUSE, HOROLOGIUM SAPIENTIAE 11,7, dt. Bearbeitung
(‘Bruderschaft der ewigen Weisheit’). >ihs. Das hernach geschnhen stat, das ist ze teutsch
hracht von der weißhait Büch in latein vnd ist von der Brüderschafft der ewigen weishait
vnd wie sich haltten sullen die Junger vnd diener der ewigen weyßhait<. WErr der mensch
ist, Er sey man oderfraw Jung oder altt, weltlich oder gayßlich ... 109 v Aher die nit pnester
seind, die sprechen hundert pater noster vnd souil Aue Maria etc. Text: Heinrich Seuse,
Horologium Sapientiae, hrsg. von Pius Künzle OP, Freiburg/Ue. 1977 (Spicilegium
Friburgense 23), S. 395/Z. 3-S. 601/Z. 12, S. 602/Z. 5-9. Zum Text vgl. Georg Hofmann
(s.o.), S. 164 Nr. 312; Alois M. HAAs/Kurt Ruh, Seuse, Heinrich, in: VL 2 8 (1992), Sp.
1.109-1.129, bes. Sp. 1.123f.
KZ
CocL Pal. germ. 571
Lektionar • Jörg Mülich u.a.
Papier • 223 Bll. ■ 21,5 x 15,5 • Augsburg (?) ■ 1422 bis nach 1449
Lagen: (IV+4) 12 + 4 VI 60 + (VI-1) 71 + 12 VI 215 + (V-2) 21S (mit Bll. 216a-216e). Vorne und hinten je ein modernes,
ungezähltes Vorsatzbl., Spiegel ebenfalls modern. Blattverlust mit Textverlust nach Bl. 69, vgl. alte Foliierung;
Doppelbll. 1/12 und 2/11 am Falz auseinandergerissen, modern mit Japanpapier hinterklebt bzw. laminiert
(geringer Textverlust; s.a. Herkunft). Regelmäßige Kustoden (3—20) und Reklamanten. Zeitgenössische
Foliierung des Lektionars (Blattverlust s.o.), zählt die nachgetragenen Episteln extra: 1-69, 71-138; 1 [= 137 v], 2-
60 [= Bl. 196]. Foliierung des 17. Jhs., korrigiert die Zählung nach dem Blattverlust, s.o., und ergänzt: 70-100,
C1-C4, 105-109, C10, 1011-1019, 120-218, Bll. 216a-216e mit moderner Zählung. Wz.: vier Varianten
Ochsenkopf mit einkonturiger Stange mit Stern (Bll. 1-62, 70-87, 92-194, 196-199, 201-218), darunter
Piccard, WZK, Nr. 67.572 (München 1421), ähnlich Nr. 67.435 (Würzburg 1413), ähnlich Nr. 67.573
(Würzburg 1422); zwei Varianten Ochsenkopf mit einkonturiger Stange mit Blume (Bll. 63-69, 89/90, 195/200),
darunter Piccard, WZK, Nr. 65.763 (München 1421); Ochsenkopf mit zweikonturiger Stange mit Kreuz (Bll.
88/91), ähnlich Piccard, WZK, Nr. 68.505 (o.O. 1421). Schriftraum: I. 1 r—193 v, 201 r-203 r (links und rechts,
selten rundum, mit Tinte begrenzt): 15-15,5 x 10-11; 29-34 Zeilen; II. 194 r—195 r: Schriftraum und Zeilenzahl
variierend; III. 196 r-200 v, 204 r-213 r (204 r-213 r links und rechts mit Tinte begrenzt): 15-16 x 10,5-11; 23-29
Zeilen; IV. 214‘—216 r: 15-16 x 9,5; 21-26 Zeilen; V. 217 V—218 V: 15,5-16 x 12; 20-27 Zeilen. Bastarda von sechs
Händen: I. l r—193 v, 201 r-203 r (Petrus Gensschopf; Haupthand); II. 194 r/v; III. 194 v-195 r; IV. 196 r-200 v, 204 r-
213 r; V. 214 r—216 r; VI. 217 V—218 V. 1 r—193 v: an den Anfängen der Epistel-und Evangelienperikopen rote
Lombarden über zwei bis drei Zeilen, waagerechte rote Striche zur Abgrenzung der Tage. Zum Teil nur sparsam
oder gar nicht rubriziert, 55 v-68 r Zitate Christi rot unterstrichen. Am Rand Zählung bzw. Bezeichnung der
Sonntage: I-V [Sonntage nach Weihnachten], LXX [= Septuagesima] ..., Misericordia Domini ..., I-XXIII
[Sonntage nach Trinitatis], /-//// [Adventssonntage] und Zählung der Heiligenfeste: I-LXVII [Episteln], 1-76
[Evangelien], Introitustexte im Temporale zum Teil auf Papierschildern in die Hs. eingeklebt, häufig verloren,
dann Leimspuren (18 v, 21 r, 24 r, 27 v, 32 v, 37 r, 41 v, 47 v, 52 r, 68 v, 72 r, 73 v, 75 r, 76 v, 78 v, 81 v, 83 r, 88 r, 90 r, 92 v, 94 v, 95 v,
97 r, 98 v, 100 v, 102 r, 103 v, 105 v, 107 r, 108 v, 110 v). Bll. 18, 68, 130, 137 Reste bzw. Spuren (Einstichlöcher) von
aufgenähten Buchweisern aus Pergament. Zahlreiche Randbemerkungen, ausgeworfene Betreffe und
Verweisungen eines wenig späteren Benutzers bzw. Besitzers (Hand II), u.a. auf weitere, teilweise autographe
Bücher in seinem Besitz mit zusätzlichen Lektionen. Die Verweisungen innerhalb der Hs. stammen aus der Zeit
vor dem Blattverlust nach Bl. 69. 194 r—195 r: rote Lombarden über zwei bis drei Zeilen. Übliche Rubrizierung.
196 r-200 v, 204 r-213 r: zum Teil rot unterstrichene Heiligennamen, sonst sparsam rubriziert. 214 r—216 r: Über-
schriften in Rot. Rote Lombarden über eine bis drei Zeilen. Übliche Rubrizierung. 217'—218 v: Zitate aus dem
Vaterunser und Zählung der Bitten in Rot. 66 v Federzeichnung eines griechischen (?) Kreuzes mit Kronen an
den Enden der Kreuzarme, eventuell Darstellung des Passionskreuzes. 200 v aufgeklebter Zettel mit dem Titulus
202
103 v—109 v HEINRICH SEUSE, HOROLOGIUM SAPIENTIAE 11,7, dt. Bearbeitung
(‘Bruderschaft der ewigen Weisheit’). >ihs. Das hernach geschnhen stat, das ist ze teutsch
hracht von der weißhait Büch in latein vnd ist von der Brüderschafft der ewigen weishait
vnd wie sich haltten sullen die Junger vnd diener der ewigen weyßhait<. WErr der mensch
ist, Er sey man oderfraw Jung oder altt, weltlich oder gayßlich ... 109 v Aher die nit pnester
seind, die sprechen hundert pater noster vnd souil Aue Maria etc. Text: Heinrich Seuse,
Horologium Sapientiae, hrsg. von Pius Künzle OP, Freiburg/Ue. 1977 (Spicilegium
Friburgense 23), S. 395/Z. 3-S. 601/Z. 12, S. 602/Z. 5-9. Zum Text vgl. Georg Hofmann
(s.o.), S. 164 Nr. 312; Alois M. HAAs/Kurt Ruh, Seuse, Heinrich, in: VL 2 8 (1992), Sp.
1.109-1.129, bes. Sp. 1.123f.
KZ
CocL Pal. germ. 571
Lektionar • Jörg Mülich u.a.
Papier • 223 Bll. ■ 21,5 x 15,5 • Augsburg (?) ■ 1422 bis nach 1449
Lagen: (IV+4) 12 + 4 VI 60 + (VI-1) 71 + 12 VI 215 + (V-2) 21S (mit Bll. 216a-216e). Vorne und hinten je ein modernes,
ungezähltes Vorsatzbl., Spiegel ebenfalls modern. Blattverlust mit Textverlust nach Bl. 69, vgl. alte Foliierung;
Doppelbll. 1/12 und 2/11 am Falz auseinandergerissen, modern mit Japanpapier hinterklebt bzw. laminiert
(geringer Textverlust; s.a. Herkunft). Regelmäßige Kustoden (3—20) und Reklamanten. Zeitgenössische
Foliierung des Lektionars (Blattverlust s.o.), zählt die nachgetragenen Episteln extra: 1-69, 71-138; 1 [= 137 v], 2-
60 [= Bl. 196]. Foliierung des 17. Jhs., korrigiert die Zählung nach dem Blattverlust, s.o., und ergänzt: 70-100,
C1-C4, 105-109, C10, 1011-1019, 120-218, Bll. 216a-216e mit moderner Zählung. Wz.: vier Varianten
Ochsenkopf mit einkonturiger Stange mit Stern (Bll. 1-62, 70-87, 92-194, 196-199, 201-218), darunter
Piccard, WZK, Nr. 67.572 (München 1421), ähnlich Nr. 67.435 (Würzburg 1413), ähnlich Nr. 67.573
(Würzburg 1422); zwei Varianten Ochsenkopf mit einkonturiger Stange mit Blume (Bll. 63-69, 89/90, 195/200),
darunter Piccard, WZK, Nr. 65.763 (München 1421); Ochsenkopf mit zweikonturiger Stange mit Kreuz (Bll.
88/91), ähnlich Piccard, WZK, Nr. 68.505 (o.O. 1421). Schriftraum: I. 1 r—193 v, 201 r-203 r (links und rechts,
selten rundum, mit Tinte begrenzt): 15-15,5 x 10-11; 29-34 Zeilen; II. 194 r—195 r: Schriftraum und Zeilenzahl
variierend; III. 196 r-200 v, 204 r-213 r (204 r-213 r links und rechts mit Tinte begrenzt): 15-16 x 10,5-11; 23-29
Zeilen; IV. 214‘—216 r: 15-16 x 9,5; 21-26 Zeilen; V. 217 V—218 V: 15,5-16 x 12; 20-27 Zeilen. Bastarda von sechs
Händen: I. l r—193 v, 201 r-203 r (Petrus Gensschopf; Haupthand); II. 194 r/v; III. 194 v-195 r; IV. 196 r-200 v, 204 r-
213 r; V. 214 r—216 r; VI. 217 V—218 V. 1 r—193 v: an den Anfängen der Epistel-und Evangelienperikopen rote
Lombarden über zwei bis drei Zeilen, waagerechte rote Striche zur Abgrenzung der Tage. Zum Teil nur sparsam
oder gar nicht rubriziert, 55 v-68 r Zitate Christi rot unterstrichen. Am Rand Zählung bzw. Bezeichnung der
Sonntage: I-V [Sonntage nach Weihnachten], LXX [= Septuagesima] ..., Misericordia Domini ..., I-XXIII
[Sonntage nach Trinitatis], /-//// [Adventssonntage] und Zählung der Heiligenfeste: I-LXVII [Episteln], 1-76
[Evangelien], Introitustexte im Temporale zum Teil auf Papierschildern in die Hs. eingeklebt, häufig verloren,
dann Leimspuren (18 v, 21 r, 24 r, 27 v, 32 v, 37 r, 41 v, 47 v, 52 r, 68 v, 72 r, 73 v, 75 r, 76 v, 78 v, 81 v, 83 r, 88 r, 90 r, 92 v, 94 v, 95 v,
97 r, 98 v, 100 v, 102 r, 103 v, 105 v, 107 r, 108 v, 110 v). Bll. 18, 68, 130, 137 Reste bzw. Spuren (Einstichlöcher) von
aufgenähten Buchweisern aus Pergament. Zahlreiche Randbemerkungen, ausgeworfene Betreffe und
Verweisungen eines wenig späteren Benutzers bzw. Besitzers (Hand II), u.a. auf weitere, teilweise autographe
Bücher in seinem Besitz mit zusätzlichen Lektionen. Die Verweisungen innerhalb der Hs. stammen aus der Zeit
vor dem Blattverlust nach Bl. 69. 194 r—195 r: rote Lombarden über zwei bis drei Zeilen. Übliche Rubrizierung.
196 r-200 v, 204 r-213 r: zum Teil rot unterstrichene Heiligennamen, sonst sparsam rubriziert. 214 r—216 r: Über-
schriften in Rot. Rote Lombarden über eine bis drei Zeilen. Übliche Rubrizierung. 217'—218 v: Zitate aus dem
Vaterunser und Zählung der Bitten in Rot. 66 v Federzeichnung eines griechischen (?) Kreuzes mit Kronen an
den Enden der Kreuzarme, eventuell Darstellung des Passionskreuzes. 200 v aufgeklebter Zettel mit dem Titulus
202