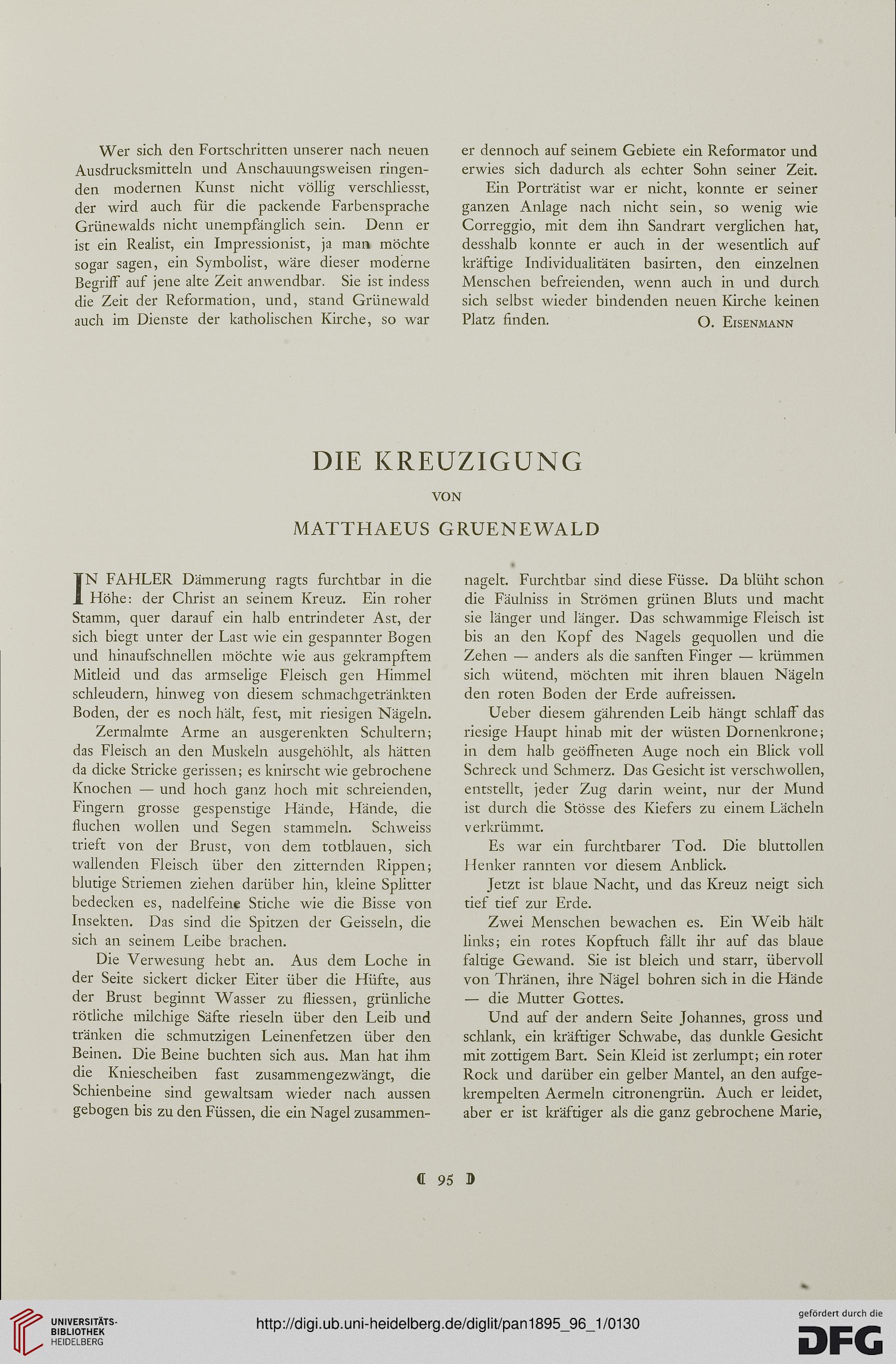Wer sich den Fortschritten unserer nach neuen
Ausdrucksmitteln und Anschauungsweisen ringen-
den modernen Kunst nicht völlig verschliesst,
der wird auch für die packende Farbensprache
Grünewalds nicht unempfänglich sein. Denn er
ist ein Realist, ein Impressionist, ja man möchte
sogar sagen, ein Symbolist, wäre dieser moderne
Begriff auf jene alte Zeit anwendbar. Sie ist indess
die Zeit der Reformation, und, stand Grünewald
auch im Dienste der katholischen Kirche, so war
er dennoch auf seinem Gebiete ein Reformator und
erwies sich dadurch als echter Sohn seiner Zeit.
Ein Porträtist war er nicht, konnte er seiner
ganzen Anlage nach nicht sein, so wenig wie
Correggio, mit dem ihn Sandrart verglichen hat,
desshalb konnte er auch in der wesentlich auf
kräftige Individualitäten basirten, den einzelnen
Menschen befreienden, wenn auch in und durch
sich selbst wieder bindenden neuen Kirche keinen
Platz finden. Q. Eisenmann
DIE KREUZIGUNG
VON
MATTHAEUS GRUENEWALD
IN FAHLER Dämmerung ragts furchtbar in die
Höhe: der Christ an seinem Kreuz. Ein roher
Stamm, quer darauf ein halb entrindeter Ast, der
sich biegt unter der Last wie ein gespannter Bogen
und hinaufschnellen möchte wie aus gekrampftem
Mitleid und das armselige Fleisch gen Himmel
schleudern, hinweg von diesem schmachgetränkten
Boden, der es noch hält, fest, mit riesigen Nägeln.
Zermalmte Arme an ausgerenkten Schultern;
das Fleisch an den Muskeln ausgehöhlt, als hätten
da dicke Stricke gerissen; es knirscht wie gebrochene
Knochen — und hoch ganz hoch mit schreienden,
Fingern grosse gespenstige Hände, Hände, die
fluchen wollen und Segen stammeln. Schweiss
trieft von der Brust, von dem totblauen, sich
wallenden Fleisch über den zitternden Rippen;
blutige Striemen ziehen darüber hin, kleine Splitter
bedecken es, nadelfeine Stiche wie die Bisse von
Insekten. Das sind die Spitzen der Geissein, die
sich an seinem Leibe brachen.
Die Verwesung hebt an. Aus dem Loche in
der Seite sickert dicker Eiter über die Hüfte, aus
der Brust beginnt Wasser zu fliessen, grünliche
rötliche milchige Säfte rieseln über den Leib und
tränken die schmutzigen Leinenfetzen über den
Beinen. Die Beine buchten sich aus. Man hat ihm
die Kniescheiben fast zusammengezwängt, die
Schienbeine sind gewaltsam wieder nach aussen
gebogen bis zu den Füssen, die ein Nagel zusammen-
nagelt. Furchtbar sind diese Füsse. Da blüht schon
die Fäulniss in Strömen grünen Bluts und macht
sie länger und länger. Das schwammige Fleisch ist
bis an den Kopf des Nagels gequollen und die
Zehen — anders als die sanften Finger — krümmen
sich wütend, möchten mit ihren blauen Nägeln
den roten Boden der Erde aufreissen.
Ueber diesem gährenden Leib hängt schlaff das
riesige Haupt hinab mit der wüsten Dornenkrone;
in dem halb geöffneten Auge noch ein Blick voll
Schreck und Schmerz. Das Gesicht ist verschwollen,
entstellt, jeder Zug darin weint, nur der Mund
ist durch die Stösse des Kiefers zu einem Lächeln
verkrümmt.
Es war ein furchtbarer Tod. Die bluttollen
Henker rannten vor diesem Anblick.
Jetzt ist blaue Nacht, und das Kreuz neigt sich
tief tief zur Erde.
Zwei Menschen bewachen es. Ein Weib hält
links; ein rotes Kopftuch fällt ihr auf das blaue
faltige Gewand. Sie ist bleich und starr, übervoll
von Thränen, ihre Nägel bohren sich in die Hände
— die Mutter Gottes.
Und auf der andern Seite Johannes, gross und
schlank, ein kräftiger Schwabe, das dunkle Gesicht
mit zottigem Bart. Sein Kleid ist zerlumpt; ein roter
Rock und darüber ein gelber Mantel, an den aufge-
krempelten Aermeln citronengrün. Auch er leidet,
aber er ist kräftiger als die ganz gebrochene Marie,
C 95 D
Ausdrucksmitteln und Anschauungsweisen ringen-
den modernen Kunst nicht völlig verschliesst,
der wird auch für die packende Farbensprache
Grünewalds nicht unempfänglich sein. Denn er
ist ein Realist, ein Impressionist, ja man möchte
sogar sagen, ein Symbolist, wäre dieser moderne
Begriff auf jene alte Zeit anwendbar. Sie ist indess
die Zeit der Reformation, und, stand Grünewald
auch im Dienste der katholischen Kirche, so war
er dennoch auf seinem Gebiete ein Reformator und
erwies sich dadurch als echter Sohn seiner Zeit.
Ein Porträtist war er nicht, konnte er seiner
ganzen Anlage nach nicht sein, so wenig wie
Correggio, mit dem ihn Sandrart verglichen hat,
desshalb konnte er auch in der wesentlich auf
kräftige Individualitäten basirten, den einzelnen
Menschen befreienden, wenn auch in und durch
sich selbst wieder bindenden neuen Kirche keinen
Platz finden. Q. Eisenmann
DIE KREUZIGUNG
VON
MATTHAEUS GRUENEWALD
IN FAHLER Dämmerung ragts furchtbar in die
Höhe: der Christ an seinem Kreuz. Ein roher
Stamm, quer darauf ein halb entrindeter Ast, der
sich biegt unter der Last wie ein gespannter Bogen
und hinaufschnellen möchte wie aus gekrampftem
Mitleid und das armselige Fleisch gen Himmel
schleudern, hinweg von diesem schmachgetränkten
Boden, der es noch hält, fest, mit riesigen Nägeln.
Zermalmte Arme an ausgerenkten Schultern;
das Fleisch an den Muskeln ausgehöhlt, als hätten
da dicke Stricke gerissen; es knirscht wie gebrochene
Knochen — und hoch ganz hoch mit schreienden,
Fingern grosse gespenstige Hände, Hände, die
fluchen wollen und Segen stammeln. Schweiss
trieft von der Brust, von dem totblauen, sich
wallenden Fleisch über den zitternden Rippen;
blutige Striemen ziehen darüber hin, kleine Splitter
bedecken es, nadelfeine Stiche wie die Bisse von
Insekten. Das sind die Spitzen der Geissein, die
sich an seinem Leibe brachen.
Die Verwesung hebt an. Aus dem Loche in
der Seite sickert dicker Eiter über die Hüfte, aus
der Brust beginnt Wasser zu fliessen, grünliche
rötliche milchige Säfte rieseln über den Leib und
tränken die schmutzigen Leinenfetzen über den
Beinen. Die Beine buchten sich aus. Man hat ihm
die Kniescheiben fast zusammengezwängt, die
Schienbeine sind gewaltsam wieder nach aussen
gebogen bis zu den Füssen, die ein Nagel zusammen-
nagelt. Furchtbar sind diese Füsse. Da blüht schon
die Fäulniss in Strömen grünen Bluts und macht
sie länger und länger. Das schwammige Fleisch ist
bis an den Kopf des Nagels gequollen und die
Zehen — anders als die sanften Finger — krümmen
sich wütend, möchten mit ihren blauen Nägeln
den roten Boden der Erde aufreissen.
Ueber diesem gährenden Leib hängt schlaff das
riesige Haupt hinab mit der wüsten Dornenkrone;
in dem halb geöffneten Auge noch ein Blick voll
Schreck und Schmerz. Das Gesicht ist verschwollen,
entstellt, jeder Zug darin weint, nur der Mund
ist durch die Stösse des Kiefers zu einem Lächeln
verkrümmt.
Es war ein furchtbarer Tod. Die bluttollen
Henker rannten vor diesem Anblick.
Jetzt ist blaue Nacht, und das Kreuz neigt sich
tief tief zur Erde.
Zwei Menschen bewachen es. Ein Weib hält
links; ein rotes Kopftuch fällt ihr auf das blaue
faltige Gewand. Sie ist bleich und starr, übervoll
von Thränen, ihre Nägel bohren sich in die Hände
— die Mutter Gottes.
Und auf der andern Seite Johannes, gross und
schlank, ein kräftiger Schwabe, das dunkle Gesicht
mit zottigem Bart. Sein Kleid ist zerlumpt; ein roter
Rock und darüber ein gelber Mantel, an den aufge-
krempelten Aermeln citronengrün. Auch er leidet,
aber er ist kräftiger als die ganz gebrochene Marie,
C 95 D