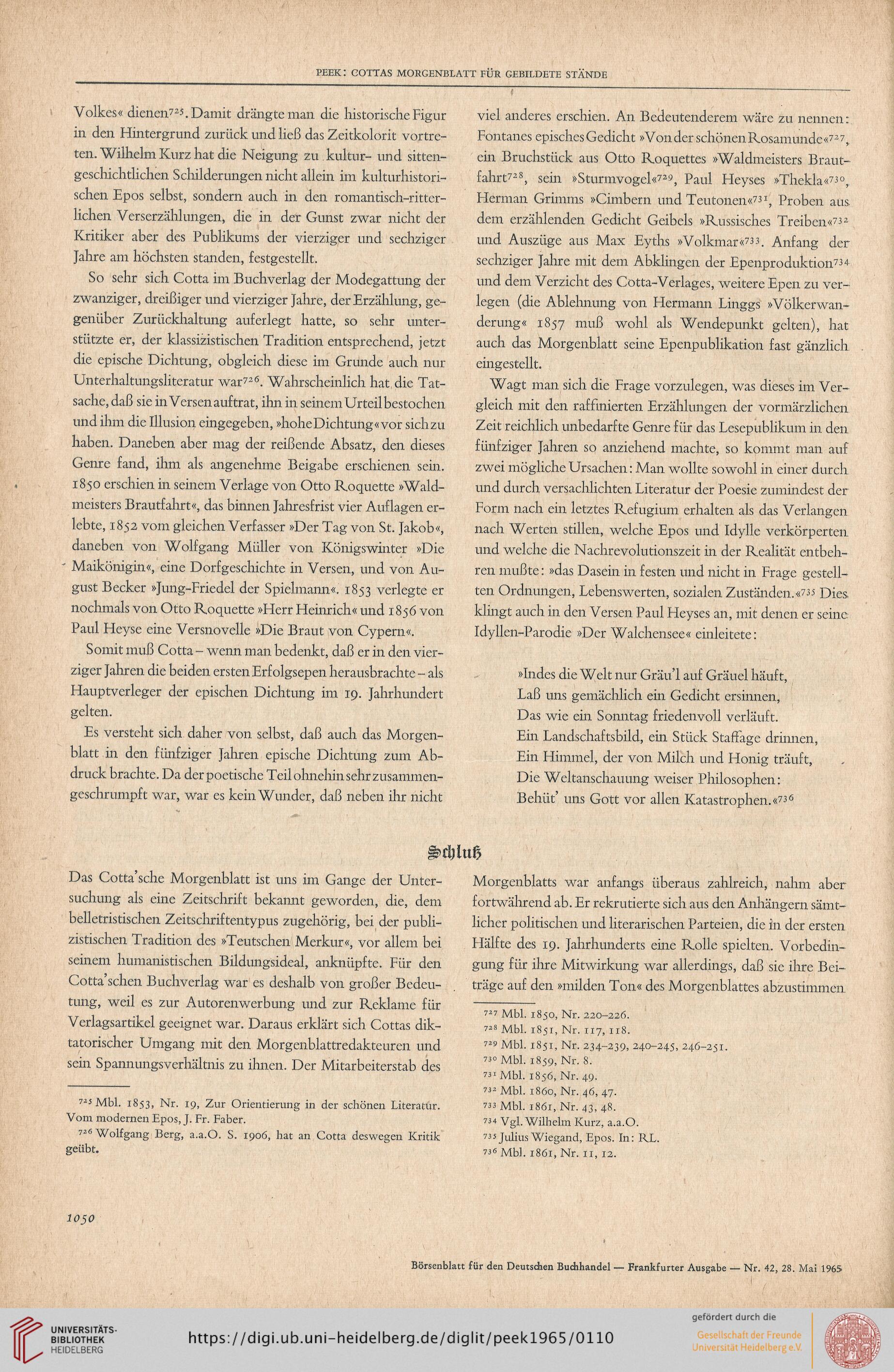PEEK: COTTAS MORGENBLATT FÜR GEBILDETE STÄNDE
Volkes« dienen* 725. Damit drängte man die historische Figur
in den Hintergrund zurück und ließ das Zeitkolörit vortre-
ten. Wilhelm Kurz hat die Neigung zu kultur- und sitten-
geschichtlichen Schilderungen nicht allein im kulturhistori-
schen Epos selbst, sondern auch in den romantisch-ritter-
lichen Verserzählungen, die in der Gunst zwar nicht der
Kritiker aber des Publikums der vierziger und sechziger
Jahre am höchsten standen, festgestellt.
So sehr sich Cotta im Buchverlag der Modegattung der
zwanziger, dreißiger und vierziger Jahre, der Erzählung, ge-
genüber Zurückhaltung auferlegt hatte, so sehr unter-
stützte er, der klassizistischen Tradition entsprechend, jetzt
die epische Dichtung, obgleich diese im Grunde auch nur
Unterhaltungsliteratur war72®. Wahrscheinlich hat die Tat-
sache, daß sie in Versen auftrat, ihn in seinemUrteilbestochen
und ihm die Illusion eingegeben, »hoheDichtung«vor sich zu
haben. Daneben aber mag der reißende Absatz, den dieses
Genre fand, ihm als angenehme Beigabe erschienen sein.
1850 erschien in seinem Verlage von Otto Roquette »Wald-
meisters Brautfahrt«, das binnen Jahresfrist vier Auflagen er-
lebte, 1852 vom gleichen Verfasser »Der Tag von St. Jakob«,
daneben von Wolfgang Müller von Königswinter »Die
' Maikönigin«, eine Dorfgeschichte in Versen, und von Au-
gust Becker »Jung-Friedel der Spielmann«. 1853 verlegte er
nochmals von Otto Roquette »Herr Heinrich« und 1856 von
Paul Heyse eine Versnovelle »Die Braut von Cypern«.
Somit muß Cotta - wenn man bedenkt, daß er in den vier-
ziger Jahren die beiden ersten Erfolgsepen herausbrachte - als
Hauptverleger der epischen Dichtung im 19. Jahrhundert
gelten.
Es versteht sich daher von selbst, daß auch das Morgen-
blatt in den fünfziger Jahren epische Dichtung zum Ab-
druck brachte. Da der poetische Teil ohnehin sehr zusammen-
geschrumpft war, war es kein Wunder, daß neben ihr nicht
viel anderes erschien. An Bedeutenderem wäre zu nennen:
Fontanes episches Gedicht »VonderschönenRosamunde«727,
ein Bruchstück aus Otto Roquettes »Waldmeisters Braut-
fahrt728, sein »Sturmvogel«729, Paul Heyses »Thekla«730,
Herman Grimms »Cimbern und Teutonen«731, Proben aus
dem erzählenden Gedicht Geibels »Russisches Treiben«732
und Auszüge aus Max Eyths »Volkmar«733. Anfang der
sechziger Jahre mit dem Abklingen der Epcnproduktion73“*
und dem Verzicht des Cotta-Verlages, weitere Epen zu ver-
legen (die Ablehnung von Hermann Linggs »Völkerwan-
derung« 1857 muß wohl als Wendepunkt gelten), hat
auch das Morgenblatt seine Epenpublikation fast gänzlich
eingestellt.
Wagt man sich die Frage vorzulegen, was dieses im Ver-
gleich mit den raffinierten Erzählungen der vormärzlichen
Zeit reichlich unbedarfte Genre für das Lesepublikum in den
fünfziger Jahren so anziehend machte, so kommt man auf
zwei mögliche Ursachen: Man wollte sowohl in einer durch
und durch versachlichten Literatur der Poesie zumindest der
Form nach ein letztes Refugium erhalten als das Verlangen
nach Werten stillen, welche Epos und Idylle verkörperten
und welche die Nachrevolutionszeit in der Realität entbeh-
ren mußte: »das Dasein in festen und nicht in Frage gestell-
ten Ordnungen, Lebenswerten, sozialen Zuständen.«735 Dies
klingt auch in den Versen Paul Heyses an, mit denen er seine
Idyllen-Parodic »Der Walchensee« einleitete:
»Indes die Welt nur Gräu’l auf Gräuel häuft,
Laß uns gemächlich ein Gedicht ersinnen,
Das wie ein Sonntag friedenvoll verläuft.
Ein Landschaftsbild, ein Stück Staffage drinnen,
Ein Himmel, der von Milch und Honig träuft,
Die Weltanschauung weiser Philosophen:
Behüt’ uns Gott vor allen Katastrophen.«736
g’fljluß
Das Cotta’sche Morgenblatt ist uns im Gange der Unter-
suchung als eine Zeitschrift bekannt geworden, die, dem
belletristischen Zeitschriftentypus zugehörig, bei der publi-
zistischen Tradition des »Teutschen Merkur«, vor allem bei
seinem humanistischen Bildungsideal, anknüpfte. Für den
Cotta’schen Buchverlag war es deshalb von großer Bedeu-
tung, weil es zur Autorenwerbung und zur Reklame für
Verlagsartikel geeignet war. Daraus erklärt sich Cottas dik-
tatorischer Umgang mit den Morgenblattredakteuren und
sein Spannungsverhältnis zu ihnen. Der Mitarbeiterstab des
723 Mbl. 1853, Nr. 19, Zur Orientierung in der schönen Literatur.
Vom modernen Epos, J. Fr. Faber.
726 Wolfgang Berg, a.a.O. S. 1906, hat an Cotta deswegen Kritik
geübt.
Morgenblatts war anfangs überaus zahlreich, nahm aber
fortwährend ab. Er rekrutierte sich aus den Anhängern sämt-
licher politischen und literarischen Parteien, die in der ersten
Hälfte des 19. Jahrhunderts eine Rolle spielten. Vorbedin-
gung für ihre Mitwirkung war allerdings, daß sie ihre Bei-
träge auf den »milden Ton« des Morgcnblattes abzustimmen.
727 Mbl. 1850, Nr. 220-226.
728 Mbl. 1851, Nr. 117, 118.
729 Mbl. 1851, Nr. 234-239, 240-245, 246-251.
73° Mbl. 1859, Nr. 8.
731 Mbl. 1856, Nr. 49.
732 Mbl. 1860, Nr. 46, 47.
733 Mbl. 1861, Nr. 43, 48.
734 Vgl. Wilhelm Kurz, a.a.O.
735 Julius Wiegand, Epos. In: KL.
736 Mbl. 1861, Nr. 11, 12.
W50
Börsenblatt für den Deutschen Buchhandel — Frankfurter Ausgabe — Nr. 42, 28. Mai 1965
Volkes« dienen* 725. Damit drängte man die historische Figur
in den Hintergrund zurück und ließ das Zeitkolörit vortre-
ten. Wilhelm Kurz hat die Neigung zu kultur- und sitten-
geschichtlichen Schilderungen nicht allein im kulturhistori-
schen Epos selbst, sondern auch in den romantisch-ritter-
lichen Verserzählungen, die in der Gunst zwar nicht der
Kritiker aber des Publikums der vierziger und sechziger
Jahre am höchsten standen, festgestellt.
So sehr sich Cotta im Buchverlag der Modegattung der
zwanziger, dreißiger und vierziger Jahre, der Erzählung, ge-
genüber Zurückhaltung auferlegt hatte, so sehr unter-
stützte er, der klassizistischen Tradition entsprechend, jetzt
die epische Dichtung, obgleich diese im Grunde auch nur
Unterhaltungsliteratur war72®. Wahrscheinlich hat die Tat-
sache, daß sie in Versen auftrat, ihn in seinemUrteilbestochen
und ihm die Illusion eingegeben, »hoheDichtung«vor sich zu
haben. Daneben aber mag der reißende Absatz, den dieses
Genre fand, ihm als angenehme Beigabe erschienen sein.
1850 erschien in seinem Verlage von Otto Roquette »Wald-
meisters Brautfahrt«, das binnen Jahresfrist vier Auflagen er-
lebte, 1852 vom gleichen Verfasser »Der Tag von St. Jakob«,
daneben von Wolfgang Müller von Königswinter »Die
' Maikönigin«, eine Dorfgeschichte in Versen, und von Au-
gust Becker »Jung-Friedel der Spielmann«. 1853 verlegte er
nochmals von Otto Roquette »Herr Heinrich« und 1856 von
Paul Heyse eine Versnovelle »Die Braut von Cypern«.
Somit muß Cotta - wenn man bedenkt, daß er in den vier-
ziger Jahren die beiden ersten Erfolgsepen herausbrachte - als
Hauptverleger der epischen Dichtung im 19. Jahrhundert
gelten.
Es versteht sich daher von selbst, daß auch das Morgen-
blatt in den fünfziger Jahren epische Dichtung zum Ab-
druck brachte. Da der poetische Teil ohnehin sehr zusammen-
geschrumpft war, war es kein Wunder, daß neben ihr nicht
viel anderes erschien. An Bedeutenderem wäre zu nennen:
Fontanes episches Gedicht »VonderschönenRosamunde«727,
ein Bruchstück aus Otto Roquettes »Waldmeisters Braut-
fahrt728, sein »Sturmvogel«729, Paul Heyses »Thekla«730,
Herman Grimms »Cimbern und Teutonen«731, Proben aus
dem erzählenden Gedicht Geibels »Russisches Treiben«732
und Auszüge aus Max Eyths »Volkmar«733. Anfang der
sechziger Jahre mit dem Abklingen der Epcnproduktion73“*
und dem Verzicht des Cotta-Verlages, weitere Epen zu ver-
legen (die Ablehnung von Hermann Linggs »Völkerwan-
derung« 1857 muß wohl als Wendepunkt gelten), hat
auch das Morgenblatt seine Epenpublikation fast gänzlich
eingestellt.
Wagt man sich die Frage vorzulegen, was dieses im Ver-
gleich mit den raffinierten Erzählungen der vormärzlichen
Zeit reichlich unbedarfte Genre für das Lesepublikum in den
fünfziger Jahren so anziehend machte, so kommt man auf
zwei mögliche Ursachen: Man wollte sowohl in einer durch
und durch versachlichten Literatur der Poesie zumindest der
Form nach ein letztes Refugium erhalten als das Verlangen
nach Werten stillen, welche Epos und Idylle verkörperten
und welche die Nachrevolutionszeit in der Realität entbeh-
ren mußte: »das Dasein in festen und nicht in Frage gestell-
ten Ordnungen, Lebenswerten, sozialen Zuständen.«735 Dies
klingt auch in den Versen Paul Heyses an, mit denen er seine
Idyllen-Parodic »Der Walchensee« einleitete:
»Indes die Welt nur Gräu’l auf Gräuel häuft,
Laß uns gemächlich ein Gedicht ersinnen,
Das wie ein Sonntag friedenvoll verläuft.
Ein Landschaftsbild, ein Stück Staffage drinnen,
Ein Himmel, der von Milch und Honig träuft,
Die Weltanschauung weiser Philosophen:
Behüt’ uns Gott vor allen Katastrophen.«736
g’fljluß
Das Cotta’sche Morgenblatt ist uns im Gange der Unter-
suchung als eine Zeitschrift bekannt geworden, die, dem
belletristischen Zeitschriftentypus zugehörig, bei der publi-
zistischen Tradition des »Teutschen Merkur«, vor allem bei
seinem humanistischen Bildungsideal, anknüpfte. Für den
Cotta’schen Buchverlag war es deshalb von großer Bedeu-
tung, weil es zur Autorenwerbung und zur Reklame für
Verlagsartikel geeignet war. Daraus erklärt sich Cottas dik-
tatorischer Umgang mit den Morgenblattredakteuren und
sein Spannungsverhältnis zu ihnen. Der Mitarbeiterstab des
723 Mbl. 1853, Nr. 19, Zur Orientierung in der schönen Literatur.
Vom modernen Epos, J. Fr. Faber.
726 Wolfgang Berg, a.a.O. S. 1906, hat an Cotta deswegen Kritik
geübt.
Morgenblatts war anfangs überaus zahlreich, nahm aber
fortwährend ab. Er rekrutierte sich aus den Anhängern sämt-
licher politischen und literarischen Parteien, die in der ersten
Hälfte des 19. Jahrhunderts eine Rolle spielten. Vorbedin-
gung für ihre Mitwirkung war allerdings, daß sie ihre Bei-
träge auf den »milden Ton« des Morgcnblattes abzustimmen.
727 Mbl. 1850, Nr. 220-226.
728 Mbl. 1851, Nr. 117, 118.
729 Mbl. 1851, Nr. 234-239, 240-245, 246-251.
73° Mbl. 1859, Nr. 8.
731 Mbl. 1856, Nr. 49.
732 Mbl. 1860, Nr. 46, 47.
733 Mbl. 1861, Nr. 43, 48.
734 Vgl. Wilhelm Kurz, a.a.O.
735 Julius Wiegand, Epos. In: KL.
736 Mbl. 1861, Nr. 11, 12.
W50
Börsenblatt für den Deutschen Buchhandel — Frankfurter Ausgabe — Nr. 42, 28. Mai 1965