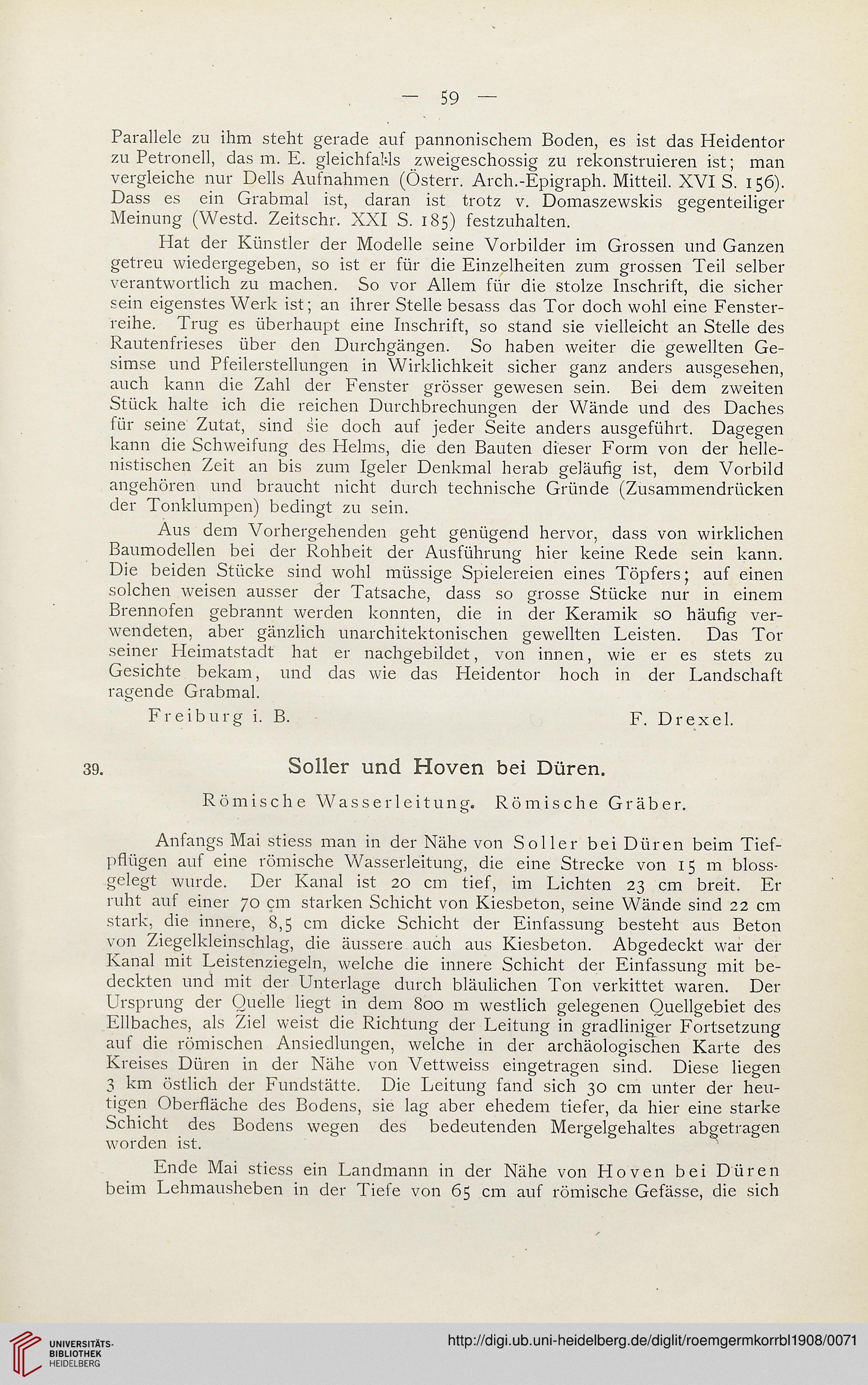59
Parallele zu ihm steht gerade auf pannonischem Boden, es ist das Heidentor
zu Petronell, das m. E. gleichfalls zweigeschossig zu rekonstruieren ist; man
vergleiche nur Dells Aufnahmen (Österr. Arch.-Epigraph. Mitteil. XVI S. 156).
Dass es ein Grabmal ist, daran ist trotz v. Domaszewskis gegenteiliger
Meinung (Westd. Zeitschr. XXI S. 185) festzuhalten.
Hat der Künstler der Modelle seine Vorbilder im Grossen und Ganzen
getreu wiedergegeben, so ist er für die Einzelheiten zum grossen Teil selber
verantwortlich zu machen. So vor Allem für die Stolze Inschrift, die sicher
sein eigenstes Werk ist; an ihrer Stelle besass das Tor doch wohl eine Fenster-
reihe. Trug es überhaupt eine Inschrift, so stand sie vielleicht an Stelle des
Rautenfrieses über den Durchgängen. So haben weiter die gewellten Ge-
simse und Pfeilerstellungen in Wirklichkeit sicher ganz anders ausgesehen,
auch kann die Zahl der Fenster grösser gewesen sein. Bei dem zweiten
Stück halte ich die reichen Durchbrechungen der Wände und des Daches
für seine Zutat, sind sie doch auf jeder Seite anders ausgeführt. Dagegen
kann die Schweifung des Helms, die den Bauten dieser Form von der helle-
nistischen Zeit an bis zum Igeler Denkmal herab geläufig ist, dem Vorbild
angehören und braucht nicht durch technische Gründe (Zusammendrücken
der Tonklumpen) bedingt zu sein.
Aus dem Vorhergehenden geht genügend hervor, dass von wirklichen
Baumodellen bei der Rohheit der Ausführung hier keine Rede sein kann.
Die beiden Stücke sind wohl müssige Spielereien eines Töpfers; auf einen
solchen weisen ausser der Tatsache, dass so grosse Stücke nur in einem
Brennofen gebrannt werden konnten, die in der Keramik so häufig ver-
wendeten, aber gänzlich unarchitektonischen gewellten Leisten. Das Tor
seiner Heimatstadt hat er nachgebildet, von innen, wie er es stets zu
Gesichte bekam, und das wie das Heidentor hoch in der Landschaft
ragende Grabmal.
Freiburg i. B. F. Drexel.
39. Söller und Hoven bei Düren.
Römische Wasserleitung. Römische Gräber.
Anfangs Mai stiess man in der Nähe von Söller bei Düren beim Tief-
pflügen auf eine römische Wasserleitung, die eine Strecke von 15 m bloss-
gelegt wurde. Der Kanal ist 20 cm tief, im Lichten 23 cm breit. Er
ruht auf einer 70 cm starken Schicht von Kiesbeton, seine Wände sind 22 cm
stark, die innere, 8,5 cm dicke Schicht der Einfassung besteht aus Beton
von Ziegelkleinschlag, die äussere auch aus Kiesbeton. Abgedeckt war der
Kanal mit Leistenziegeln, welche die innere Schicht der Einfassung mit be-
deckten und mit der Unterlage durch bläulichen Ton verkittet waren. Der
Ursprung der Quelle liegt in dem 800 m westlich gelegenen Quellgebiet des
Ellbaches, als Ziel weist die Richtung der Leitung in gradliniger Fortsetzung
auf die römischen Ansiedlungen, welche in der archäologischen Karte des
Kreises Düren in der Nähe von Vettweiss eingetragen sind. Diese liegen
3 km östlich der Fundstätte. Die Leitung fand sich 30 cm unter der heu-
tigen Oberfläche des Bodens, sie lag aber ehedem tiefer, da hier eine starke
Schicht des Bodens wegen des bedeutenden Mergelgehaltes abgetragen
worden ist.
Ende Mai stiess ein Landmann in der Nähe von Hoven bei Düren
beim Lehmausheben in der Tiefe von 65 cm auf römische Gefässe, die sich
Parallele zu ihm steht gerade auf pannonischem Boden, es ist das Heidentor
zu Petronell, das m. E. gleichfalls zweigeschossig zu rekonstruieren ist; man
vergleiche nur Dells Aufnahmen (Österr. Arch.-Epigraph. Mitteil. XVI S. 156).
Dass es ein Grabmal ist, daran ist trotz v. Domaszewskis gegenteiliger
Meinung (Westd. Zeitschr. XXI S. 185) festzuhalten.
Hat der Künstler der Modelle seine Vorbilder im Grossen und Ganzen
getreu wiedergegeben, so ist er für die Einzelheiten zum grossen Teil selber
verantwortlich zu machen. So vor Allem für die Stolze Inschrift, die sicher
sein eigenstes Werk ist; an ihrer Stelle besass das Tor doch wohl eine Fenster-
reihe. Trug es überhaupt eine Inschrift, so stand sie vielleicht an Stelle des
Rautenfrieses über den Durchgängen. So haben weiter die gewellten Ge-
simse und Pfeilerstellungen in Wirklichkeit sicher ganz anders ausgesehen,
auch kann die Zahl der Fenster grösser gewesen sein. Bei dem zweiten
Stück halte ich die reichen Durchbrechungen der Wände und des Daches
für seine Zutat, sind sie doch auf jeder Seite anders ausgeführt. Dagegen
kann die Schweifung des Helms, die den Bauten dieser Form von der helle-
nistischen Zeit an bis zum Igeler Denkmal herab geläufig ist, dem Vorbild
angehören und braucht nicht durch technische Gründe (Zusammendrücken
der Tonklumpen) bedingt zu sein.
Aus dem Vorhergehenden geht genügend hervor, dass von wirklichen
Baumodellen bei der Rohheit der Ausführung hier keine Rede sein kann.
Die beiden Stücke sind wohl müssige Spielereien eines Töpfers; auf einen
solchen weisen ausser der Tatsache, dass so grosse Stücke nur in einem
Brennofen gebrannt werden konnten, die in der Keramik so häufig ver-
wendeten, aber gänzlich unarchitektonischen gewellten Leisten. Das Tor
seiner Heimatstadt hat er nachgebildet, von innen, wie er es stets zu
Gesichte bekam, und das wie das Heidentor hoch in der Landschaft
ragende Grabmal.
Freiburg i. B. F. Drexel.
39. Söller und Hoven bei Düren.
Römische Wasserleitung. Römische Gräber.
Anfangs Mai stiess man in der Nähe von Söller bei Düren beim Tief-
pflügen auf eine römische Wasserleitung, die eine Strecke von 15 m bloss-
gelegt wurde. Der Kanal ist 20 cm tief, im Lichten 23 cm breit. Er
ruht auf einer 70 cm starken Schicht von Kiesbeton, seine Wände sind 22 cm
stark, die innere, 8,5 cm dicke Schicht der Einfassung besteht aus Beton
von Ziegelkleinschlag, die äussere auch aus Kiesbeton. Abgedeckt war der
Kanal mit Leistenziegeln, welche die innere Schicht der Einfassung mit be-
deckten und mit der Unterlage durch bläulichen Ton verkittet waren. Der
Ursprung der Quelle liegt in dem 800 m westlich gelegenen Quellgebiet des
Ellbaches, als Ziel weist die Richtung der Leitung in gradliniger Fortsetzung
auf die römischen Ansiedlungen, welche in der archäologischen Karte des
Kreises Düren in der Nähe von Vettweiss eingetragen sind. Diese liegen
3 km östlich der Fundstätte. Die Leitung fand sich 30 cm unter der heu-
tigen Oberfläche des Bodens, sie lag aber ehedem tiefer, da hier eine starke
Schicht des Bodens wegen des bedeutenden Mergelgehaltes abgetragen
worden ist.
Ende Mai stiess ein Landmann in der Nähe von Hoven bei Düren
beim Lehmausheben in der Tiefe von 65 cm auf römische Gefässe, die sich