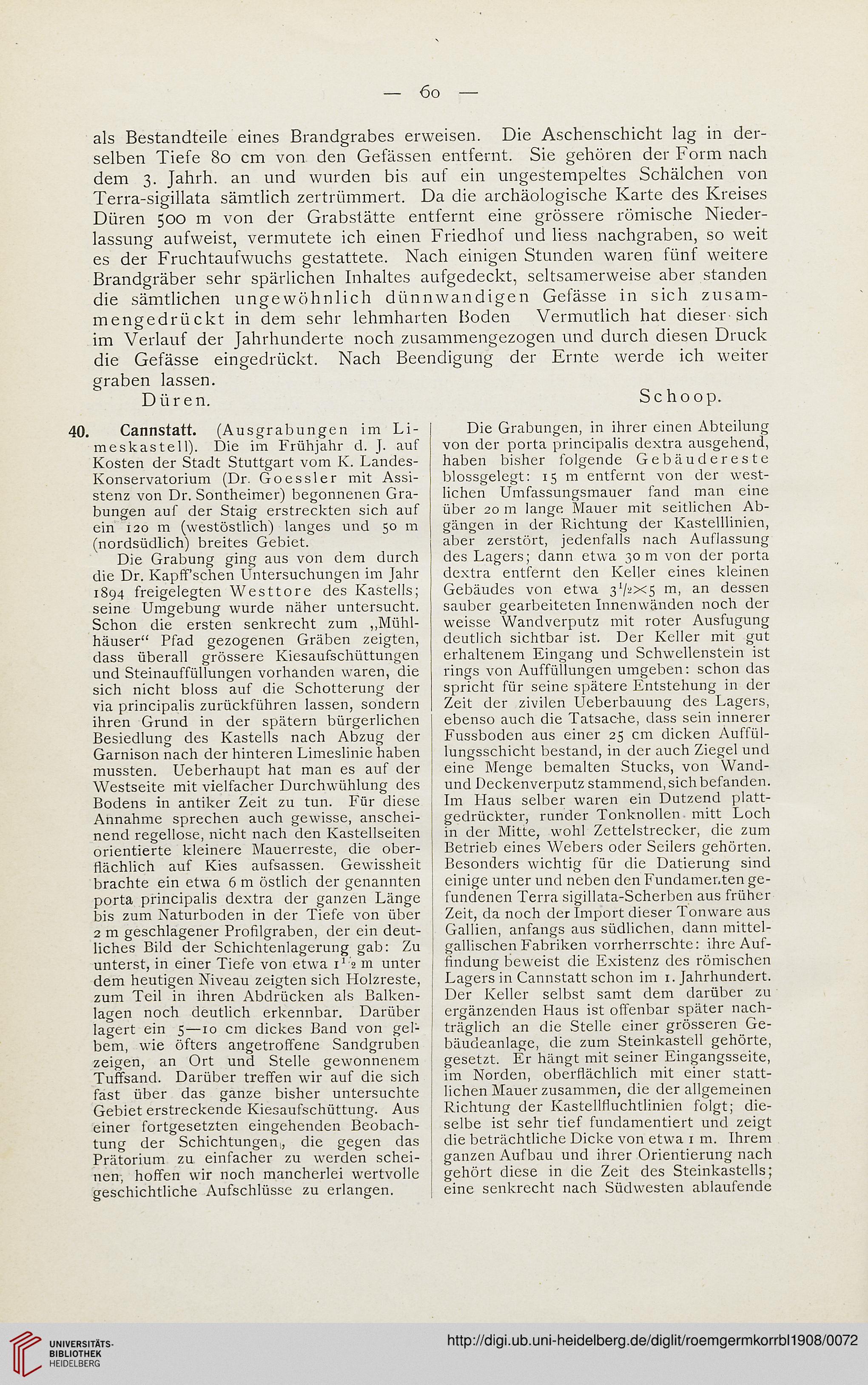6o
als Bestandteile eines Brandgrabes erweisen. Die Aschenschicht lag in der-
selben Tiefe 80 cm von den Gefässen entfernt. Sie gehören der Form nach
dem 3. Jahrh. an und wurden bis auf ein ungestempeltes Schälchen von
Terra-sigillata sämtlich zertrümmert. Da die archäologische Karte des Kreises
Düren 500 m von der Grabstätte entfernt eine grössere römische Nieder-
lassung aufweist, vermutete ich einen Friedhof und liess nachgraben, so weit
es der Fruchtaufwuchs gestattete. Nach einigen Stunden waren fünf weitere
Brandgräber sehr spärlichen Inhaltes aufgedeckt, seltsamerweise aber standen
die sämtlichen ungewöhnlich dünnwandigen Gefässe in sich zusam-
mengedrückt in dem sehr lehmharten Boden Vermutlich hat dieser-sich
im Verlauf der Jahrhunderte noch zusammengezogen und durch diesen Druck
die Gefässe eingedrückt. Nach Beendigung der Ernte werde ich weiter
graben lassen.
Düren.
40. Cannstatt. (Ausgrabungen im Li-
meskastell). Die im Frühjahr d. J. auf
Kosten der Stadt Stuttgart vom K. Landes-
Konservatorium (Dr. Goessler mit Assi-
stenz von Dr. Sontheimer) begonnenen Gra-
bungen auf der Staig erstreckten sich auf
ein 120 m (westöstlich) langes und 50 m
(nordsüdlich) breites Gebiet.
Die Grabung ging aus von dem durch
die Dr. Kapff’schen Untersuchungen im Jahr
1894 freigelegten Westtore des Kastells;
seine Umgebung wurde näher untersucht.
Schon die ersten senkrecht zum „Mühl-
häuser“ Pfad gezogenen Gräben zeigten,
dass überall grössere Kiesaufschüttungen
und Steinauffüllungen vorhanden waren, die
sich nicht bloss auf die Schotterung der
via principalis zurückführen lassen, sondern
ihren Grund in der spätem bürgerlichen
Besiedlung des Kastells nach Abzug der
Garnison nach der hinteren Limeslinie haben
mussten. Ueberhaupt hat man es auf der
Westseite mit vielfacher Durchwühlung des
Bodens in antiker Zeit zu tun. Für diese
Annahme sprechen auch gewisse, anschei-
nend regellose, nicht nach den Kastellseiten
orientierte kleinere Mauerreste, die ober-
flächlich auf Kies aufsassen. Gewissheit
brachte ein etwa 6 m östlich der genannten
porta principalis dextra der ganzen Länge
bis zum Naturboden in der Tiefe von über
2 m geschlagener Profilgraben, der ein deut-
liches Bild der Schichtenlagerung gab: Zu
unterst, in einer Tiefe von etwa i‘ i m unter
dem heutigen Niveau zeigten sich Holzreste,
zum Teil in ihren Abdrücken als Balken-
lagen noch deutlich erkennbar. Darüber
lagert ein 5—10 cm dickes Band von gel-
bem, wie öfters angetroffene Sandgruben
zeigen, an Ort und Stelle gewonnenem
Tuffsand. Darüber treffen wir auf die sich
fast über das ganze bisher untersuchte
Gebiet erstreckende Kiesaufschüttung. Aus
einer fortgesetzten eingehenden Beobach-
tung der Schichtungen!, die gegen das
Prätorium zu einfacher zu werden schei-
nen; hoffen wir noch mancherlei wertvolle
geschichtliche Aufschlüsse zu erlangen.
Sc hoop.
Die Grabungen, in ihrer einen Abteilung
von der porta principalis dextra ausgehend,
haben bisher folgende Gebäudereste
blossgelegt: 15 m entfernt von der west-
lichen Umfassungsmauer fand man eine
über 20 m lange Mauer mit seitlichen Ab-
gängen in der Richtung der Kastelllinien,
aber zerstört, jedenfalls nach Auflassung
des Lagers; dann etwa 30 m von der porta
dextra entfernt den Keller eines kleinen
Gebäudes von etwa 31/*X5 m, an dessen
sauber gearbeiteten Innenwänden noch der
weisse Wandverputz mit roter Ausfugung
deutlich sichtbar ist. Der Keller mit gut
erhaltenem Eingang und Schwellenstein ist
rings von Auffüllungen umgeben: schon das
spricht für seine spätere Entstehung in der
Zeit der zivilen Ueberbauung des Lagers,
ebenso auch die Tatsache, dass sein innerer
Fussboden aus einer 25 cm dicken Auffül-
lungsschicht bestand, in der auch Ziegel und
eine Menge bemalten Stucks, von Wand-
und Deckenverputz stammend, sich befanden.
Im Haus selber waren ein Dutzend platt-
gedrückter, runder Tonknollen, mitt Loch
in der Mitte, wohl Zettelstrecker, die zum
Betrieb eines Webers oder Seilers gehörten.
Besonders wichtig für die Datierung sind
einige unter und neben den Fundamenten ge-
fundenen Terra sigillata-Scherben aus früher
Zeit, da noch der Import dieser Tonware aus
Gallien, anfangs aus südlichen, dann mittel-
gallischen Fabriken vorrherrschte: ihre Auf-
findung beweist die Existenz des römischen
Lagers in Cannstatt schon im 1. Jahrhundert.
Der Keller selbst samt dem darüber zu
ergänzenden Haus ist offenbar später nach-
träglich an die Stelle einer grösseren Ge-
bäudeanlage, die zum Steinkastell gehörte,
gesetzt. Er hängt mit seiner Eingangsseite,
im Norden, oberflächlich mit einer statt-
lichen Mauer zusammen, die der allgemeinen
Richtung der Kastellfluchtlinien folgt; die-
selbe ist sehr tief fundamentiert und zeigt
die beträchtliche Dicke von etwa 1 m. Ihrem
ganzen Aufbau und ihrer Orientierung nach
gehört diese in die Zeit des Steinkastells;
eine senkrecht nach Südwesten ablaufende
als Bestandteile eines Brandgrabes erweisen. Die Aschenschicht lag in der-
selben Tiefe 80 cm von den Gefässen entfernt. Sie gehören der Form nach
dem 3. Jahrh. an und wurden bis auf ein ungestempeltes Schälchen von
Terra-sigillata sämtlich zertrümmert. Da die archäologische Karte des Kreises
Düren 500 m von der Grabstätte entfernt eine grössere römische Nieder-
lassung aufweist, vermutete ich einen Friedhof und liess nachgraben, so weit
es der Fruchtaufwuchs gestattete. Nach einigen Stunden waren fünf weitere
Brandgräber sehr spärlichen Inhaltes aufgedeckt, seltsamerweise aber standen
die sämtlichen ungewöhnlich dünnwandigen Gefässe in sich zusam-
mengedrückt in dem sehr lehmharten Boden Vermutlich hat dieser-sich
im Verlauf der Jahrhunderte noch zusammengezogen und durch diesen Druck
die Gefässe eingedrückt. Nach Beendigung der Ernte werde ich weiter
graben lassen.
Düren.
40. Cannstatt. (Ausgrabungen im Li-
meskastell). Die im Frühjahr d. J. auf
Kosten der Stadt Stuttgart vom K. Landes-
Konservatorium (Dr. Goessler mit Assi-
stenz von Dr. Sontheimer) begonnenen Gra-
bungen auf der Staig erstreckten sich auf
ein 120 m (westöstlich) langes und 50 m
(nordsüdlich) breites Gebiet.
Die Grabung ging aus von dem durch
die Dr. Kapff’schen Untersuchungen im Jahr
1894 freigelegten Westtore des Kastells;
seine Umgebung wurde näher untersucht.
Schon die ersten senkrecht zum „Mühl-
häuser“ Pfad gezogenen Gräben zeigten,
dass überall grössere Kiesaufschüttungen
und Steinauffüllungen vorhanden waren, die
sich nicht bloss auf die Schotterung der
via principalis zurückführen lassen, sondern
ihren Grund in der spätem bürgerlichen
Besiedlung des Kastells nach Abzug der
Garnison nach der hinteren Limeslinie haben
mussten. Ueberhaupt hat man es auf der
Westseite mit vielfacher Durchwühlung des
Bodens in antiker Zeit zu tun. Für diese
Annahme sprechen auch gewisse, anschei-
nend regellose, nicht nach den Kastellseiten
orientierte kleinere Mauerreste, die ober-
flächlich auf Kies aufsassen. Gewissheit
brachte ein etwa 6 m östlich der genannten
porta principalis dextra der ganzen Länge
bis zum Naturboden in der Tiefe von über
2 m geschlagener Profilgraben, der ein deut-
liches Bild der Schichtenlagerung gab: Zu
unterst, in einer Tiefe von etwa i‘ i m unter
dem heutigen Niveau zeigten sich Holzreste,
zum Teil in ihren Abdrücken als Balken-
lagen noch deutlich erkennbar. Darüber
lagert ein 5—10 cm dickes Band von gel-
bem, wie öfters angetroffene Sandgruben
zeigen, an Ort und Stelle gewonnenem
Tuffsand. Darüber treffen wir auf die sich
fast über das ganze bisher untersuchte
Gebiet erstreckende Kiesaufschüttung. Aus
einer fortgesetzten eingehenden Beobach-
tung der Schichtungen!, die gegen das
Prätorium zu einfacher zu werden schei-
nen; hoffen wir noch mancherlei wertvolle
geschichtliche Aufschlüsse zu erlangen.
Sc hoop.
Die Grabungen, in ihrer einen Abteilung
von der porta principalis dextra ausgehend,
haben bisher folgende Gebäudereste
blossgelegt: 15 m entfernt von der west-
lichen Umfassungsmauer fand man eine
über 20 m lange Mauer mit seitlichen Ab-
gängen in der Richtung der Kastelllinien,
aber zerstört, jedenfalls nach Auflassung
des Lagers; dann etwa 30 m von der porta
dextra entfernt den Keller eines kleinen
Gebäudes von etwa 31/*X5 m, an dessen
sauber gearbeiteten Innenwänden noch der
weisse Wandverputz mit roter Ausfugung
deutlich sichtbar ist. Der Keller mit gut
erhaltenem Eingang und Schwellenstein ist
rings von Auffüllungen umgeben: schon das
spricht für seine spätere Entstehung in der
Zeit der zivilen Ueberbauung des Lagers,
ebenso auch die Tatsache, dass sein innerer
Fussboden aus einer 25 cm dicken Auffül-
lungsschicht bestand, in der auch Ziegel und
eine Menge bemalten Stucks, von Wand-
und Deckenverputz stammend, sich befanden.
Im Haus selber waren ein Dutzend platt-
gedrückter, runder Tonknollen, mitt Loch
in der Mitte, wohl Zettelstrecker, die zum
Betrieb eines Webers oder Seilers gehörten.
Besonders wichtig für die Datierung sind
einige unter und neben den Fundamenten ge-
fundenen Terra sigillata-Scherben aus früher
Zeit, da noch der Import dieser Tonware aus
Gallien, anfangs aus südlichen, dann mittel-
gallischen Fabriken vorrherrschte: ihre Auf-
findung beweist die Existenz des römischen
Lagers in Cannstatt schon im 1. Jahrhundert.
Der Keller selbst samt dem darüber zu
ergänzenden Haus ist offenbar später nach-
träglich an die Stelle einer grösseren Ge-
bäudeanlage, die zum Steinkastell gehörte,
gesetzt. Er hängt mit seiner Eingangsseite,
im Norden, oberflächlich mit einer statt-
lichen Mauer zusammen, die der allgemeinen
Richtung der Kastellfluchtlinien folgt; die-
selbe ist sehr tief fundamentiert und zeigt
die beträchtliche Dicke von etwa 1 m. Ihrem
ganzen Aufbau und ihrer Orientierung nach
gehört diese in die Zeit des Steinkastells;
eine senkrecht nach Südwesten ablaufende