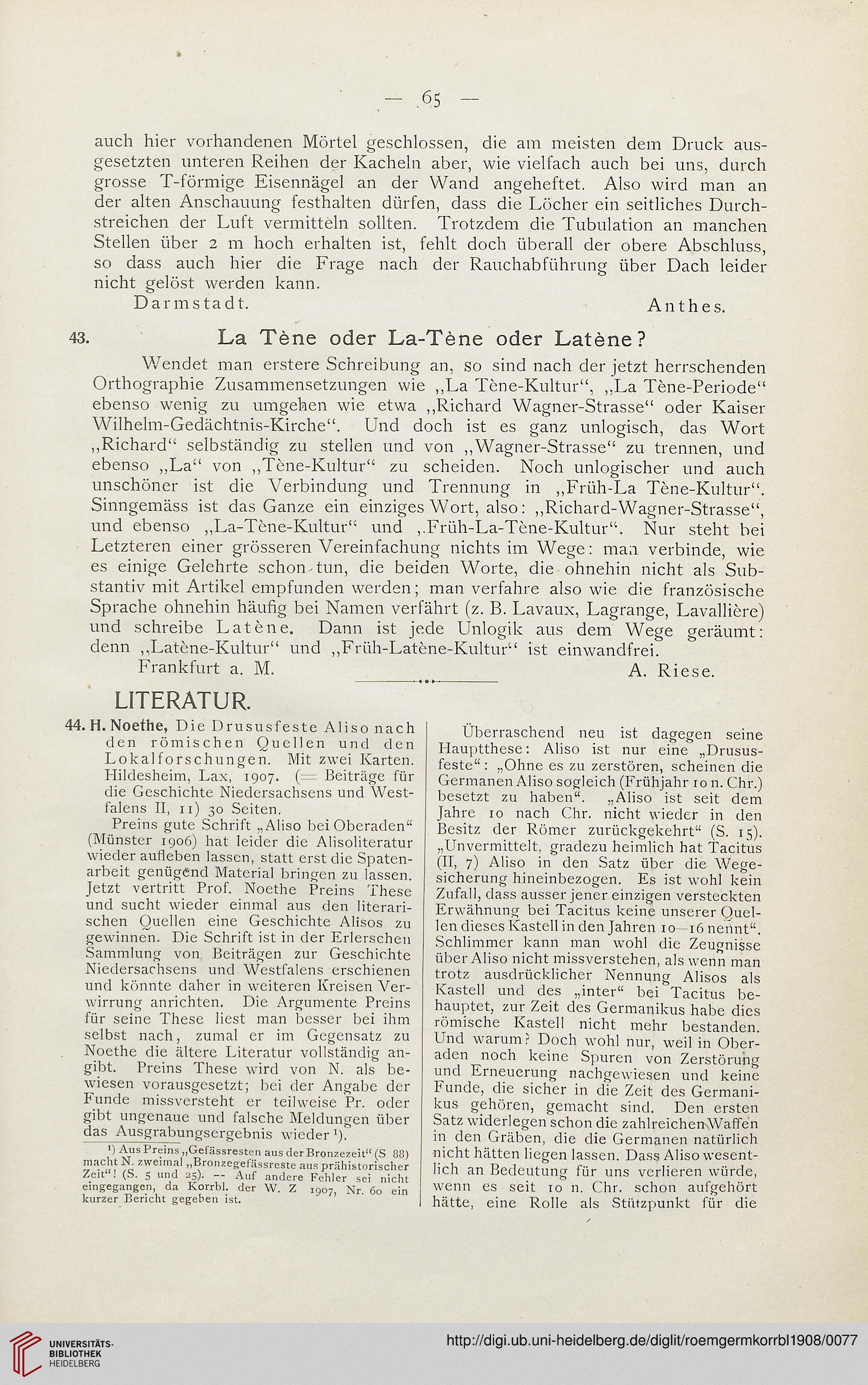65
auch hier vorhandenen Mörtel geschlossen, die am meisten dem Druck aus-
gesetzten unteren Reihen der Kacheln aber, wie vielfach auch bei uns, durch
grosse T-förmige Eisennägel an der Wand angeheftet. Also wird man an
der alten Anschauung festhalten dürfen, dass die Löcher ein seitliches Durch-
streichen der Luft vermitteln sollten. Trotzdem die Tubulation an manchen
Stellen über 2 m hoch erhalten ist, fehlt doch überall der obere Abschluss,
so dass auch hier die Frage nach der Rauchabführung über Dach leider
nicht gelöst werden kann.
Darm stadt. Anthes.
43.
La Tene oder La-Tene oder Latene?
Wendet man erstere Schreibung an, so sind nach der jetzt herrschenden
Orthographie Zusammensetzungen wie „La Tene-Kultur“, „La Tene-Periode“
ebenso wenig zu umgehen wie etwa „Richard Wagner-Strasse“ oder Kaiser
Wilhelm-Gedächtnis-Kirche“. Und doch ist es ganz unlogisch, das Wort
„Richard“ selbständig zu stellen und von „Wagner-Strasse“ zu trennen, und
ebenso „La“ von „Tene-Kultur“ zu scheiden. Noch unlogischer und auch
unschöner ist die Verbindung und Trennung in „Früh-La Tene-Kultur“.
Sinngemäss ist das Ganze ein einziges Wort, also: „Richard-Wagner-Strasse“,
und ebenso „La-Tene-Kultur“ und „Früh-La-Tene-Kultur“. Nur steht bei
Letzteren einer grösseren Vereinfachung nichts im Wege: man verbinde, wie
es einige Gelehrte schon-tun, die beiden Worte, die ohnehin nicht als Sub-
stantiv mit Artikel empfunden werden; man verfahre also wie die französische
Sprache ohnehin häufig bei Namen verfährt (z. B. Lavaux, Lagrange, Lavaliiere)
und schreibe Latene. Dann ist jede Unlogik aus dem Wege geräumt:
denn „Latene-Kultur“ und „Früh-Latene-Kultur“ ist einwandfrei.
Frankfurt a. M. A. Riese.
LITERATUR.
44. H. Noethe, Die Drususfeste Aliso nach
den römischen Quellen und den
Lokalforschungen. Mit zwei Karten.
Hildesheim, Lax, 1907. (= Beiträge für
die Geschichte Niedersachsens und West-
falens II, 11) 30 Seiten.
Preins gute Schrift „Aliso bei Oberaden“
(Münster 1906) hat leider die Alisoliteratur
wieder aufleben lassen, statt erst die Spaten-
arbeit genügend Material bringen zu lassen,
jetzt vertritt Prof. Noethe Preins These
und sucht wieder einmal aus den literari-
schen Quellen eine Geschichte Alisos zu
gewinnen. Die Schrift ist in der Erlerschen
Sammlung von Beiträgen zur Geschichte
Niedersachsens und Westfalens erschienen
und könnte daher in weiteren Kreisen Ver-
wirrung anrichten. Die Argumente Preins
für seine These liest man besser bei ihm
selbst nach, zumal er im Gegensatz zu
Noethe die ältere Literatur vollständig an-
gibt. Preins These wird von N. als be-
wiesen vorausgesetzt; bei der Angabe der
Funde missversteht er teilweise Pr. oder
gibt ungenaue und falsche Meldungen über
das Ausgrabungsergebnis wieder ')•
’) Aus Preins „Gefässresten aus der Bronzezeit“ (S 88)
macht N. zweimal „Bronzegefässreste aus prähistorischer
Zeit“! (S. 5 und 25). — Auf andere Fehler sei nicht
eingegangen, da Korrbl. der W. Z 1907, Nr. 60 ein
kurzer Bericht gegeben ist.
Überraschend neu ist dagegen seine
Hauptthese: Aliso ist nur eine „Drusus-
feste“ : „Ohne es zu zerstören, scheinen die
Germanen Aliso sogleich (Frühjahr io n. Chr.)
besetzt zu haben“. „Aliso ist seit dem
Jahre io nach Chr. nicht wieder in den
Besitz der Römer zurückgekehrt“ (S. 15).
„Unvermittelt, gradezu heimlich hat Tacitus
(II, 7) Aliso in den Satz über die Wege-
sicherung hineinbezogen. Es ist wohl kein
Zufall, dass ausser jener einzigen versteckten
Erwähnung bei Tacitus keine unserer Quel-
len dieses Kastell in den Jahren 10 16 nennt“.
Schlimmer kann man wohl die Zeugnisse
über Aliso nicht missverstehen, als wenn man
trotz ausdrücklicher Nennung Alisos als
Kastell und des „inter“ bei Tacitus be-
hauptet, zur Zeit des Germanikus habe dies
römische Kastell nicht mehr bestanden.
Und warum? Doch wohl nur, weil in Ober-
aden noch keine Spuren von Zerstörung
und Erneuerung nachgewiesen und keine
Funde, die sicher in die Zeit des Germani-
kus gehören, gemacht sind. Den ersten
Satz widerlegen schon die zahlreichenWaffen
in den Gräben, die die Germanen natürlich
nicht hätten liegen lassen. Dass Aliso wesent-
lich an Bedeutung für uns verlieren würde,
wenn es seit 10 n. Chr. schon aufgehört
hätte, eine Rolle als Stützpunkt für die
auch hier vorhandenen Mörtel geschlossen, die am meisten dem Druck aus-
gesetzten unteren Reihen der Kacheln aber, wie vielfach auch bei uns, durch
grosse T-förmige Eisennägel an der Wand angeheftet. Also wird man an
der alten Anschauung festhalten dürfen, dass die Löcher ein seitliches Durch-
streichen der Luft vermitteln sollten. Trotzdem die Tubulation an manchen
Stellen über 2 m hoch erhalten ist, fehlt doch überall der obere Abschluss,
so dass auch hier die Frage nach der Rauchabführung über Dach leider
nicht gelöst werden kann.
Darm stadt. Anthes.
43.
La Tene oder La-Tene oder Latene?
Wendet man erstere Schreibung an, so sind nach der jetzt herrschenden
Orthographie Zusammensetzungen wie „La Tene-Kultur“, „La Tene-Periode“
ebenso wenig zu umgehen wie etwa „Richard Wagner-Strasse“ oder Kaiser
Wilhelm-Gedächtnis-Kirche“. Und doch ist es ganz unlogisch, das Wort
„Richard“ selbständig zu stellen und von „Wagner-Strasse“ zu trennen, und
ebenso „La“ von „Tene-Kultur“ zu scheiden. Noch unlogischer und auch
unschöner ist die Verbindung und Trennung in „Früh-La Tene-Kultur“.
Sinngemäss ist das Ganze ein einziges Wort, also: „Richard-Wagner-Strasse“,
und ebenso „La-Tene-Kultur“ und „Früh-La-Tene-Kultur“. Nur steht bei
Letzteren einer grösseren Vereinfachung nichts im Wege: man verbinde, wie
es einige Gelehrte schon-tun, die beiden Worte, die ohnehin nicht als Sub-
stantiv mit Artikel empfunden werden; man verfahre also wie die französische
Sprache ohnehin häufig bei Namen verfährt (z. B. Lavaux, Lagrange, Lavaliiere)
und schreibe Latene. Dann ist jede Unlogik aus dem Wege geräumt:
denn „Latene-Kultur“ und „Früh-Latene-Kultur“ ist einwandfrei.
Frankfurt a. M. A. Riese.
LITERATUR.
44. H. Noethe, Die Drususfeste Aliso nach
den römischen Quellen und den
Lokalforschungen. Mit zwei Karten.
Hildesheim, Lax, 1907. (= Beiträge für
die Geschichte Niedersachsens und West-
falens II, 11) 30 Seiten.
Preins gute Schrift „Aliso bei Oberaden“
(Münster 1906) hat leider die Alisoliteratur
wieder aufleben lassen, statt erst die Spaten-
arbeit genügend Material bringen zu lassen,
jetzt vertritt Prof. Noethe Preins These
und sucht wieder einmal aus den literari-
schen Quellen eine Geschichte Alisos zu
gewinnen. Die Schrift ist in der Erlerschen
Sammlung von Beiträgen zur Geschichte
Niedersachsens und Westfalens erschienen
und könnte daher in weiteren Kreisen Ver-
wirrung anrichten. Die Argumente Preins
für seine These liest man besser bei ihm
selbst nach, zumal er im Gegensatz zu
Noethe die ältere Literatur vollständig an-
gibt. Preins These wird von N. als be-
wiesen vorausgesetzt; bei der Angabe der
Funde missversteht er teilweise Pr. oder
gibt ungenaue und falsche Meldungen über
das Ausgrabungsergebnis wieder ')•
’) Aus Preins „Gefässresten aus der Bronzezeit“ (S 88)
macht N. zweimal „Bronzegefässreste aus prähistorischer
Zeit“! (S. 5 und 25). — Auf andere Fehler sei nicht
eingegangen, da Korrbl. der W. Z 1907, Nr. 60 ein
kurzer Bericht gegeben ist.
Überraschend neu ist dagegen seine
Hauptthese: Aliso ist nur eine „Drusus-
feste“ : „Ohne es zu zerstören, scheinen die
Germanen Aliso sogleich (Frühjahr io n. Chr.)
besetzt zu haben“. „Aliso ist seit dem
Jahre io nach Chr. nicht wieder in den
Besitz der Römer zurückgekehrt“ (S. 15).
„Unvermittelt, gradezu heimlich hat Tacitus
(II, 7) Aliso in den Satz über die Wege-
sicherung hineinbezogen. Es ist wohl kein
Zufall, dass ausser jener einzigen versteckten
Erwähnung bei Tacitus keine unserer Quel-
len dieses Kastell in den Jahren 10 16 nennt“.
Schlimmer kann man wohl die Zeugnisse
über Aliso nicht missverstehen, als wenn man
trotz ausdrücklicher Nennung Alisos als
Kastell und des „inter“ bei Tacitus be-
hauptet, zur Zeit des Germanikus habe dies
römische Kastell nicht mehr bestanden.
Und warum? Doch wohl nur, weil in Ober-
aden noch keine Spuren von Zerstörung
und Erneuerung nachgewiesen und keine
Funde, die sicher in die Zeit des Germani-
kus gehören, gemacht sind. Den ersten
Satz widerlegen schon die zahlreichenWaffen
in den Gräben, die die Germanen natürlich
nicht hätten liegen lassen. Dass Aliso wesent-
lich an Bedeutung für uns verlieren würde,
wenn es seit 10 n. Chr. schon aufgehört
hätte, eine Rolle als Stützpunkt für die