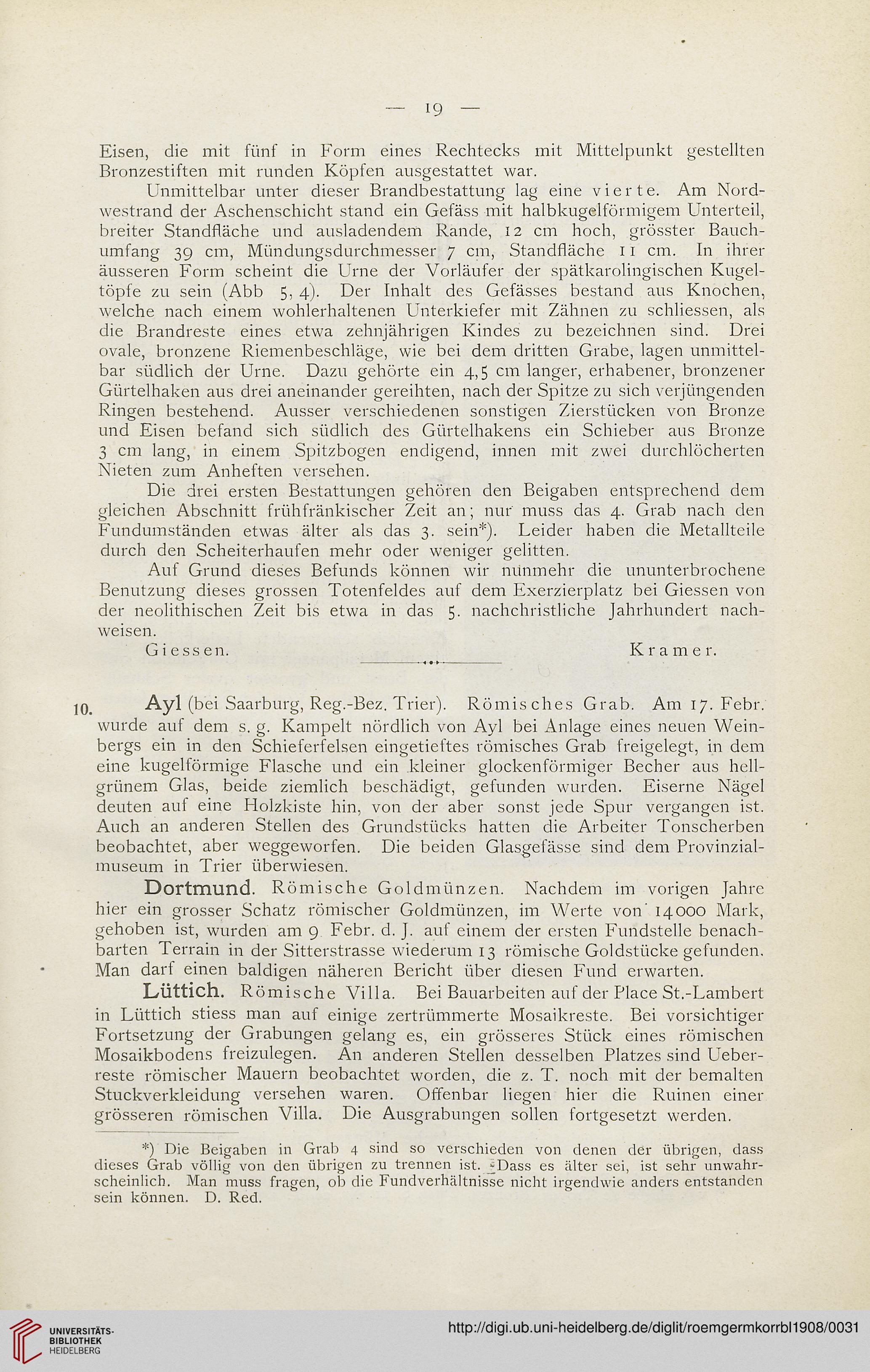19
Eisen, die mit fünf in Form eines Rechtecks mit Mittelpunkt gestellten
Bronzestiften mit runden Köpfen ausgestattet war.
Unmittelbar unter dieser Brandbestattung lag eine vierte. Am Nord-
westrand der Aschenschicht stand ein Gefäss mit halbkugelförmigem Unterteil,
breiter Standfläche und ausladendem Rande, 12 cm hoch, grösster Bauch-
umfang 39 cm, Mündungsdurchmesser 7 cm, Standfläche 11 cm. In ihrer
äusseren Form scheint die Urne der Vorläufer der spätkarolingischen Kugel-
töpfe zu sein (Abb 5, 4). Der Inhalt des Gefässes bestand aus Knochen,
welche nach einem wohlerhaltenen Unterkiefer mit Zähnen zu schliessen, als
die Brandreste eines etwa zehnjährigen Kindes zu bezeichnen sind. Drei
ovale, bronzene Riemenbeschläge, wie bei dem dritten Grabe, lagen unmittel-
bar südlich der Urne. Dazu gehörte ein 4,5 cm langer, erhabener, bronzener
Gürtelhaken aus drei aneinander gereihten, nach der Spitze zu sich verjüngenden
Ringen bestehend. Ausser verschiedenen sonstigen Zierstücken von Bronze
und Eisen befand sich südlich des Gürtelhakens ein Schieber aus Bronze
3 cm lang, in einem Spitzbogen endigend, innen mit zwei durchlöcherten
Nieten zum Anheften versehen.
Die drei ersten Bestattungen gehören den Beigaben entsprechend dem
gleichen Abschnitt frühfränkischer Zeit an; nur muss das 4. Grab nach den
Fundumständen etwas älter als das 3. sein*). Leider haben die Metallteile
durch den Scheiterhaufen mehr oder weniger gelitten.
Auf Grund dieses Befunds können wir niinmehr die ununterbrochene
Benutzung dieses grossen Totenfeldes auf dem Exerzierplatz bei Giessen von
der neolithischen Zeit bis etwa in das 5. nachchristliche Jahrhundert nach-
weisen.
Giessen. Kramer.
Ayl (bei Saarburg, Reg.-Bez. Trier). Römisches Grab. Am 17. Febr.
wurde auf dem s. g. Kampelt nördlich von Ayl bei Anlage eines neuen Wein-
bergs ein in den Schieferfelsen eingetieftes römisches Grab freigelegt, in dem
eine kugelförmige Flasche und ein kleiner glockenförmiger Becher aus hell-
grünem Glas, beide ziemlich beschädigt, gefunden wurden. Eiserne Nägel
deuten auf eine Holzkiste hin, von der aber sonst jede Spur vergangen ist.
Auch an anderen Stellen des Grundstücks hatten die Arbeiter Tonscherben
beobachtet, aber weggeworfen. Die beiden Glasgefässe sind dem Provinzial-
museum in Trier überwiesen.
Dortmund. Römische Goldmünzen. Nachdem im vorigen Jahre
hier ein grosser Schatz römischer Goldmünzen, im Werte von' 14000 Mark,
gehoben ist, wurden am 9 Febr. d. J. auf einem der ersten Fundstelle benach-
barten Terrain in der Sitterstrasse wiederum 13 römische Goldstücke gefunden.
Man darf einen baldigen näheren Bericht über diesen Fund erwarten.
Lüttich. Römische Villa. Bei Bauarbeiten auf der Place St.-Lambert
in Lüttich stiess man auf einige zertrümmerte Mosaikreste. Bei vorsichtiger
Fortsetzung der Grabungen gelang es, ein grösseres Stück eines römischen
Mosaikbodens freizulegen. An anderen Stellen desselben Platzes sind Ueber-
reste römischer Mauern beobachtet worden, die z. T. noch mit der bemalten
Stuckverkleidung versehen waren. Offenbar liegen hier die Ruinen einer
grösseren römischen Villa. Die Ausgrabungen sollen fortgesetzt werden.
*) Die Beigaben in Grab 4 sind so verschieden von denen der übrigen, dass
dieses Grab völlig von den übrigen zu trennen ist. JDass es älter sei, ist sehr unwahr-
scheinlich. Man muss fragen, ob die Fundverhältnisse nicht irgendwie anders entstanden
sein können. D. Red.
Eisen, die mit fünf in Form eines Rechtecks mit Mittelpunkt gestellten
Bronzestiften mit runden Köpfen ausgestattet war.
Unmittelbar unter dieser Brandbestattung lag eine vierte. Am Nord-
westrand der Aschenschicht stand ein Gefäss mit halbkugelförmigem Unterteil,
breiter Standfläche und ausladendem Rande, 12 cm hoch, grösster Bauch-
umfang 39 cm, Mündungsdurchmesser 7 cm, Standfläche 11 cm. In ihrer
äusseren Form scheint die Urne der Vorläufer der spätkarolingischen Kugel-
töpfe zu sein (Abb 5, 4). Der Inhalt des Gefässes bestand aus Knochen,
welche nach einem wohlerhaltenen Unterkiefer mit Zähnen zu schliessen, als
die Brandreste eines etwa zehnjährigen Kindes zu bezeichnen sind. Drei
ovale, bronzene Riemenbeschläge, wie bei dem dritten Grabe, lagen unmittel-
bar südlich der Urne. Dazu gehörte ein 4,5 cm langer, erhabener, bronzener
Gürtelhaken aus drei aneinander gereihten, nach der Spitze zu sich verjüngenden
Ringen bestehend. Ausser verschiedenen sonstigen Zierstücken von Bronze
und Eisen befand sich südlich des Gürtelhakens ein Schieber aus Bronze
3 cm lang, in einem Spitzbogen endigend, innen mit zwei durchlöcherten
Nieten zum Anheften versehen.
Die drei ersten Bestattungen gehören den Beigaben entsprechend dem
gleichen Abschnitt frühfränkischer Zeit an; nur muss das 4. Grab nach den
Fundumständen etwas älter als das 3. sein*). Leider haben die Metallteile
durch den Scheiterhaufen mehr oder weniger gelitten.
Auf Grund dieses Befunds können wir niinmehr die ununterbrochene
Benutzung dieses grossen Totenfeldes auf dem Exerzierplatz bei Giessen von
der neolithischen Zeit bis etwa in das 5. nachchristliche Jahrhundert nach-
weisen.
Giessen. Kramer.
Ayl (bei Saarburg, Reg.-Bez. Trier). Römisches Grab. Am 17. Febr.
wurde auf dem s. g. Kampelt nördlich von Ayl bei Anlage eines neuen Wein-
bergs ein in den Schieferfelsen eingetieftes römisches Grab freigelegt, in dem
eine kugelförmige Flasche und ein kleiner glockenförmiger Becher aus hell-
grünem Glas, beide ziemlich beschädigt, gefunden wurden. Eiserne Nägel
deuten auf eine Holzkiste hin, von der aber sonst jede Spur vergangen ist.
Auch an anderen Stellen des Grundstücks hatten die Arbeiter Tonscherben
beobachtet, aber weggeworfen. Die beiden Glasgefässe sind dem Provinzial-
museum in Trier überwiesen.
Dortmund. Römische Goldmünzen. Nachdem im vorigen Jahre
hier ein grosser Schatz römischer Goldmünzen, im Werte von' 14000 Mark,
gehoben ist, wurden am 9 Febr. d. J. auf einem der ersten Fundstelle benach-
barten Terrain in der Sitterstrasse wiederum 13 römische Goldstücke gefunden.
Man darf einen baldigen näheren Bericht über diesen Fund erwarten.
Lüttich. Römische Villa. Bei Bauarbeiten auf der Place St.-Lambert
in Lüttich stiess man auf einige zertrümmerte Mosaikreste. Bei vorsichtiger
Fortsetzung der Grabungen gelang es, ein grösseres Stück eines römischen
Mosaikbodens freizulegen. An anderen Stellen desselben Platzes sind Ueber-
reste römischer Mauern beobachtet worden, die z. T. noch mit der bemalten
Stuckverkleidung versehen waren. Offenbar liegen hier die Ruinen einer
grösseren römischen Villa. Die Ausgrabungen sollen fortgesetzt werden.
*) Die Beigaben in Grab 4 sind so verschieden von denen der übrigen, dass
dieses Grab völlig von den übrigen zu trennen ist. JDass es älter sei, ist sehr unwahr-
scheinlich. Man muss fragen, ob die Fundverhältnisse nicht irgendwie anders entstanden
sein können. D. Red.