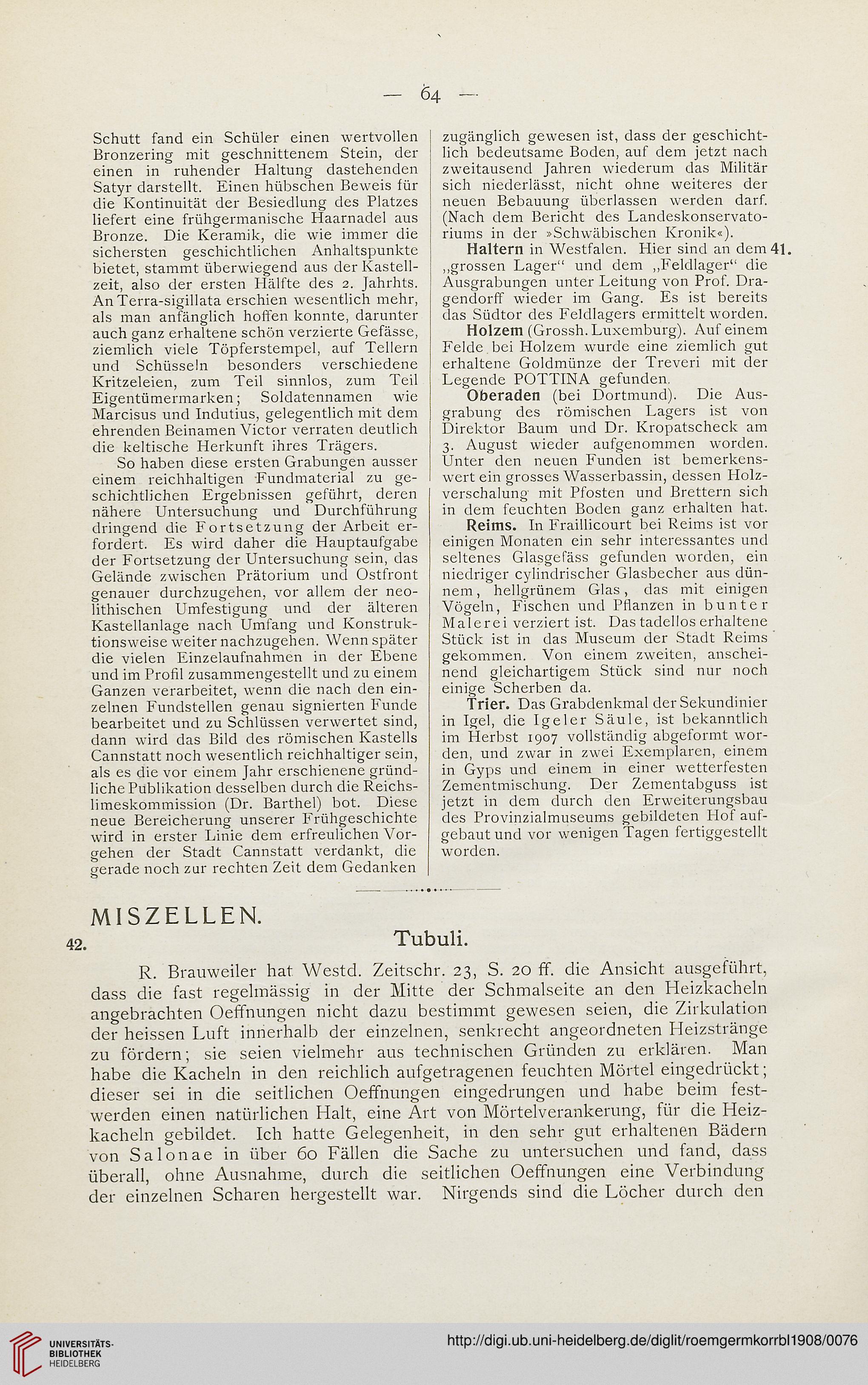64
Schutt fand ein Schüler einen wertvollen
Bronzering mit geschnittenem Stein, der
einen in ruhender Haltung dastehenden
Satyr darstellt. Einen hübschen Beweis für
die Kontinuität der Besiedlung des Platzes
liefert eine frühgermanische Haarnadel aus
Bronze. Die Keramik, die wie immer die
sichersten geschichtlichen Anhaltspunkte
bietet, stammt überwiegend aus der Kastell-
zeit, also der ersten Hälfte des 2. Jahrhts.
An Terra-sigillata erschien wesentlich mehr,
als man anfänglich hoffen konnte, darunter
auch ganz erhaltene schön verzierte Gefässe,
ziemlich viele Töpferstempel, auf Tellern
und Schüsseln besonders verschiedene
Kritzeleien, zum Teil sinnlos, zum Teil
Eigentümermarken; Soldatennamen wie
Marcisus und Indutius, gelegentlich mit dem
ehrenden Beinamen Victor verraten deutlich
die keltische Herkunft ihres Trägers.
So haben diese ersten Grabungen ausser
einem reichhaltigen 'Fundmaterial zu ge-
schichtlichen Ergebnissen geführt, deren
nähere Untersuchung und Durchführung
dringend die Fortsetzung der Arbeit er-
fordert. Es wird daher die Hauptaufgabe
der Fortsetzung der Untersuchung sein, das
Gelände zwischen Prätorium und Ostfront
genauer durchzugehen, vor allem der neo-
lithischen Umfestigung und der älteren
Kastellanlage nach Umfang und Konstruk-
tionsweise weiter nachzugehen. Wenn später
die vielen Einzelaufnahmen in der Ebene
und im Profil zusammengestellt und zu einem
Ganzen verarbeitet, wenn die nach den ein-
zelnen Fundstellen genau signierten Funde
bearbeitet und zu Schlüssen verwertet sind,
dann wird das Bild des römischen Kastells
Cannstatt noch wesentlich reichhaltiger sein,
als es die vor einem Jahr erschienene gründ-
liche Publikation desselben durch die Reichs-
limeskommission (Dr. Barthel) bot. Diese
neue Bereicherung unserer Frühgeschichte
wird in erster Linie dem erfreulichen Vor-
gehen der Stadt Cannstatt verdankt, die
gerade noch zur rechten Zeit dem Gedanken
zugänglich gewesen ist, dass der geschicht-
lich bedeutsame Boden, auf dem jetzt nach
zweitausend Jahren wiederum das Militär
sich niederlässt, nicht ohne weiteres der
neuen Bebauung überlassen werden darf.
(Nach dem Bericht des Landeskonservato-
riums in der »Schwäbischen Kronik«).
Haltern in Westfalen. Hier sind an dem 4L
„grossen Lager“ und dem „Feldlager“ die
Ausgrabungen unter Leitung von Prof. Dra-
gendorff wieder im Gang. Es ist bereits
das Südtor des Feldlagers ermittelt worden.
Holzem (Grossh. Luxemburg). Auf einem
Felde , bei Holzem wurde eine ziemlich gut
erhaltene Goldmünze der Treveri mit der
Legende POTTINA gefunden.
Oberaden (bei Dortmund). Die Aus-
grabung des römischen Lagers ist von
Direktor Baum und Dr. Kropatscheck am
3. August wieder aufgenommen worden.
Unter den neuen Funden ist bemerkens-
wert ein grosses Wasserbassin, dessen Holz-
verschalung mit Pfosten und Brettern sich
in dem feuchten Boden ganz erhalten hat.
Reims. In Fraillicourt bei Reims ist vor
einigen Monaten ein sehr interessantes und
seltenes Glasgefäss gefunden worden, ein
niedriger cylindrischer Glasbecher aus dün-
nem , hellgrünem Glas, das mit einigen
Vögeln, Fischen und Pflanzen in bunter
Malerei verziert ist. Das tadellos erhaltene
Stück ist in das Museum der Stadt Reims ’
gekommen. Von einem zweiten, anschei-
nend gleichartigem Stück sind nur noch
einige Scherben da.
Trier. Das Grabdenkmal derSekundinier
in Igel, die Igeler Säule, ist bekanntlich
im Herbst 1907 vollständig abgeformt wor-
den, und zwar in zwei Exemplaren, einem
in Gyps und einem in einer wetterfesten
Zementmischung. Der Zementabguss ist
jetzt in dem durch den Erweiterungsbau
des Provinzialmuseums gebildeten Plof auf-
gebaut und vor wenigen Tagen fertiggestellt
worden.
MISZELLEN.
42. Tubuli.
R. Brauweiler hat Westd. Zeitschr. 23, S. 20 ff. die Ansicht ausgeführt,
dass die fast regelmässig in der Mitte der Schmalseite an den Heizkacheln
angebrachten Oeffnungen nicht dazu bestimmt gewesen seien, die Zirkulation
der heissen Luft innerhalb der einzelnen, senkrecht angeordneten Heizstränge
zu fördern; sie seien vielmehr aus technischen Gründen zu erklären. Man
habe die Kacheln in den reichlich aufgetragenen feuchten Mörtel eingedrückt;
dieser sei in die seitlichen Oeffnungen eingedrungen und habe beim fest-
werden einen natürlichen Halt, eine Art von Mörtelverankerung, für die Heiz-
kacheln gebildet. Ich hatte Gelegenheit, in den sehr gut erhaltenen Bädern
von Salonae in über 60 Fällen die Sache zu untersuchen und fand, dass
überall, ohne Ausnahme, durch die seitlichen Oeffnungen eine Verbindung
der einzelnen Scharen hergestellt war. Nirgends sind die Löcher durch den
Schutt fand ein Schüler einen wertvollen
Bronzering mit geschnittenem Stein, der
einen in ruhender Haltung dastehenden
Satyr darstellt. Einen hübschen Beweis für
die Kontinuität der Besiedlung des Platzes
liefert eine frühgermanische Haarnadel aus
Bronze. Die Keramik, die wie immer die
sichersten geschichtlichen Anhaltspunkte
bietet, stammt überwiegend aus der Kastell-
zeit, also der ersten Hälfte des 2. Jahrhts.
An Terra-sigillata erschien wesentlich mehr,
als man anfänglich hoffen konnte, darunter
auch ganz erhaltene schön verzierte Gefässe,
ziemlich viele Töpferstempel, auf Tellern
und Schüsseln besonders verschiedene
Kritzeleien, zum Teil sinnlos, zum Teil
Eigentümermarken; Soldatennamen wie
Marcisus und Indutius, gelegentlich mit dem
ehrenden Beinamen Victor verraten deutlich
die keltische Herkunft ihres Trägers.
So haben diese ersten Grabungen ausser
einem reichhaltigen 'Fundmaterial zu ge-
schichtlichen Ergebnissen geführt, deren
nähere Untersuchung und Durchführung
dringend die Fortsetzung der Arbeit er-
fordert. Es wird daher die Hauptaufgabe
der Fortsetzung der Untersuchung sein, das
Gelände zwischen Prätorium und Ostfront
genauer durchzugehen, vor allem der neo-
lithischen Umfestigung und der älteren
Kastellanlage nach Umfang und Konstruk-
tionsweise weiter nachzugehen. Wenn später
die vielen Einzelaufnahmen in der Ebene
und im Profil zusammengestellt und zu einem
Ganzen verarbeitet, wenn die nach den ein-
zelnen Fundstellen genau signierten Funde
bearbeitet und zu Schlüssen verwertet sind,
dann wird das Bild des römischen Kastells
Cannstatt noch wesentlich reichhaltiger sein,
als es die vor einem Jahr erschienene gründ-
liche Publikation desselben durch die Reichs-
limeskommission (Dr. Barthel) bot. Diese
neue Bereicherung unserer Frühgeschichte
wird in erster Linie dem erfreulichen Vor-
gehen der Stadt Cannstatt verdankt, die
gerade noch zur rechten Zeit dem Gedanken
zugänglich gewesen ist, dass der geschicht-
lich bedeutsame Boden, auf dem jetzt nach
zweitausend Jahren wiederum das Militär
sich niederlässt, nicht ohne weiteres der
neuen Bebauung überlassen werden darf.
(Nach dem Bericht des Landeskonservato-
riums in der »Schwäbischen Kronik«).
Haltern in Westfalen. Hier sind an dem 4L
„grossen Lager“ und dem „Feldlager“ die
Ausgrabungen unter Leitung von Prof. Dra-
gendorff wieder im Gang. Es ist bereits
das Südtor des Feldlagers ermittelt worden.
Holzem (Grossh. Luxemburg). Auf einem
Felde , bei Holzem wurde eine ziemlich gut
erhaltene Goldmünze der Treveri mit der
Legende POTTINA gefunden.
Oberaden (bei Dortmund). Die Aus-
grabung des römischen Lagers ist von
Direktor Baum und Dr. Kropatscheck am
3. August wieder aufgenommen worden.
Unter den neuen Funden ist bemerkens-
wert ein grosses Wasserbassin, dessen Holz-
verschalung mit Pfosten und Brettern sich
in dem feuchten Boden ganz erhalten hat.
Reims. In Fraillicourt bei Reims ist vor
einigen Monaten ein sehr interessantes und
seltenes Glasgefäss gefunden worden, ein
niedriger cylindrischer Glasbecher aus dün-
nem , hellgrünem Glas, das mit einigen
Vögeln, Fischen und Pflanzen in bunter
Malerei verziert ist. Das tadellos erhaltene
Stück ist in das Museum der Stadt Reims ’
gekommen. Von einem zweiten, anschei-
nend gleichartigem Stück sind nur noch
einige Scherben da.
Trier. Das Grabdenkmal derSekundinier
in Igel, die Igeler Säule, ist bekanntlich
im Herbst 1907 vollständig abgeformt wor-
den, und zwar in zwei Exemplaren, einem
in Gyps und einem in einer wetterfesten
Zementmischung. Der Zementabguss ist
jetzt in dem durch den Erweiterungsbau
des Provinzialmuseums gebildeten Plof auf-
gebaut und vor wenigen Tagen fertiggestellt
worden.
MISZELLEN.
42. Tubuli.
R. Brauweiler hat Westd. Zeitschr. 23, S. 20 ff. die Ansicht ausgeführt,
dass die fast regelmässig in der Mitte der Schmalseite an den Heizkacheln
angebrachten Oeffnungen nicht dazu bestimmt gewesen seien, die Zirkulation
der heissen Luft innerhalb der einzelnen, senkrecht angeordneten Heizstränge
zu fördern; sie seien vielmehr aus technischen Gründen zu erklären. Man
habe die Kacheln in den reichlich aufgetragenen feuchten Mörtel eingedrückt;
dieser sei in die seitlichen Oeffnungen eingedrungen und habe beim fest-
werden einen natürlichen Halt, eine Art von Mörtelverankerung, für die Heiz-
kacheln gebildet. Ich hatte Gelegenheit, in den sehr gut erhaltenen Bädern
von Salonae in über 60 Fällen die Sache zu untersuchen und fand, dass
überall, ohne Ausnahme, durch die seitlichen Oeffnungen eine Verbindung
der einzelnen Scharen hergestellt war. Nirgends sind die Löcher durch den