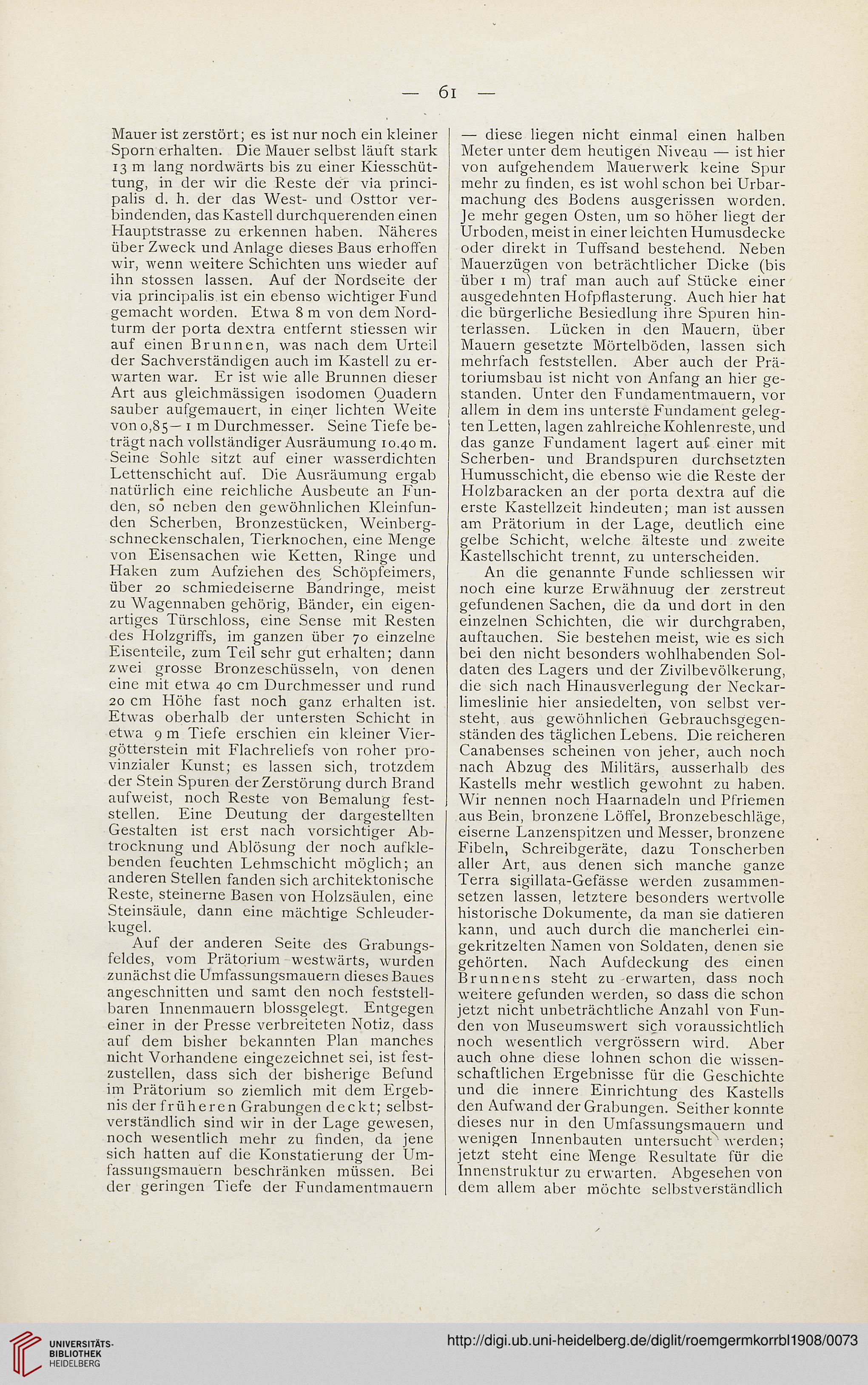6i
Mauer ist zerstört; es ist nur noch ein kleiner
Sporn erhalten. Die Mauer selbst läuft stark
13 m lang nordwärts bis zu einer Kiesschüt-
tung, in der wir die Reste der via princi-
palis d. h. der das West- und Osttor ver-
bindenden, das Kastell durchquerenden einen
Hauptstrasse zu erkennen haben. Näheres
über Zweck und Anlage dieses Baus erhoffen
wir, wenn weitere Schichten uns wieder auf
ihn stossen lassen. Auf der Nordseite der
via principalis ist ein ebenso wichtiger Fund
gemacht worden. Etwa 8 m von dem Nord-
turm der porta dextra entfernt stiessen w'ir
auf einen Brunnen, was nach dem Urteil
der Sachverständigen auch im Kastell zu er-
warten war. Er ist wie alle Brunnen dieser
Art aus gleichmässigen isodomen Quadern
sauber aufgemauert, in ein,er lichten Weite
von 0,85— 1 m Durchmesser. Seine Tiefe be-
trägt nach vollständiger Ausräumung 10.40 m.
Seine Sohle sitzt auf einer wasserdichten
Lettenschicht auf. Die Ausräumung ergab
natürlich eine reichliche Ausbeute an Fun-
den, so neben den gewöhnlichen Kleinfun-
den Scherben, Bronzestücken, Weinberg-
schneckenschalen, Tierknochen, eine Menge
von Eisensachen wie Ketten, Ringe und
Haken zum Aufziehen des Schöpfeimers,
über 20 schmiedeiserne Bandringe, meist
zu Wagennaben gehörig, Bänder, ein eigen-
artiges Türschloss, eine Sense mit Resten
des Holzgriffs, im ganzen über 70 einzelne
Eisenteile, zum Teil sehr gut erhalten; dann
zwei grosse Bronzeschüsseln, von denen
eine mit etwa 40 cm Durchmesser und rund
20 cm Höhe fast noch ganz erhalten ist.
Etwas oberhalb der untersten Schicht in
etwa 9 m Tiefe erschien ein kleiner Vier-
götterstein mit Flachreliefs von roher pro-
vinzialer Kunst; es lassen sich, trotzdem
der Stein Spuren der Zerstörung durch Brand
aufweist, noch Reste von Bemalung fest-
stellen. Eine Deutung der dargestellten
Gestalten ist erst nach vorsichtiger Ab-
trocknung und Ablösung der noch aufkle-
benden feuchten Lehmschicht möglich; an
anderen Stellen fanden sich architektonische
Reste, steinerne Basen von Holzsäulen, eine
Steinsäule, dann eine mächtige Schleuder-
kugel.
Auf der anderen Seite des Grabungs-
feldes, vom Prätorium westwärts, wurden
zunächst die Umfassungsmauern dieses Baues
angeschnitten und samt den noch feststell-
baren Innenmauern blossgelegt. Entgegen
einer in der Presse verbreiteten Notiz, dass
auf dem bisher bekannten Plan manches
nicht Vorhandene eingezeichnet sei, ist fest-
zustellen, dass sich der bisherige Befund
im Prätorium so ziemlich mit dem Ergeb-
nis der früheren Grabungen deckt; selbst-
verständlich sind wir in der Lage gewesen,
noch wesentlich mehr zu finden, da jene
sich hatten auf die Konstatierung der Um-
fassungsmauern beschränken müssen. Bei
der geringen Tiefe der Fundamentmauern
— diese liegen nicht einmal einen halben
Meter unter dem heutigen Niveau — ist hier
von aufgehendem Mauerwerk keine Spur
mehr zu finden, es ist wohl schon bei Urbar-
machung des Bodens ausgerissen worden.
Je mehr gegen Osten, um so höher liegt der
Urboden, meist in einer leichten Humusdecke
oder direkt in Tuffsand bestehend. Neben
Mauerzügen von beträchtlicher Dicke (bis
über 1 m) traf man auch auf Stücke einer
ausgedehnten Hofpflasterung. Auch hier hat
die bürgerliche Besiedlung ihre Spuren hin-
terlassen. Lücken in den Mauern, über
Mauern gesetzte Mörtelböden, lassen sich
mehrfach feststellen. Aber auch der Prä-
toriumsbau ist nicht von Anfang an hier ge-
standen. Unter den Fundamentmauern, vor
allem in dem ins unterste Fundament geleg-
ten Letten, lagen zahlreiche Kohlenreste, und
das ganze Fundament lagert auf einer mit
Scherben- und Brandspuren durchsetzten
Humusschicht, die ebenso wie die Reste der
Holzbaracken an der porta dextra auf die
erste Kastellzeit hindeuten; man ist aussen
am Prätorium in der Lage, deutlich eine
gelbe Schicht, welche älteste und zweite
Kastellschicht trennt, zu unterscheiden.
An die genannte Funde schliessen wir
noch eine kurze Erwähnuug der zerstreut
gefundenen Sachen, die da und dort in den
einzelnen Schichten, die wir durchgraben,
auftauchen. Sie bestehen meist, wie es sich
bei den nicht besonders wohlhabenden Sol-
daten des Lagers und der Zivilbevölkerung,
die sich nach Hinausverlegung der Neckar-
limeslinie hier ansiedelten, von selbst ver-
steht, aus gewöhnlichen Gebrauchsgegen-
ständen des täglichen Lebens. Die reicheren
Canabenses scheinen von jeher, auch noch
nach Abzug des Militärs, ausserhalb des
Kastells mehr westlich gewohnt zu haben.
Wir nennen noch Haarnadeln und Pfriemen
aus Bein, bronzene Löffel, Bronzebeschläge,
eiserne Lanzenspitzen und Messer, bronzene
Fibeln, Schreibgeräte, dazu Tonscherben
aller Art, aus denen sich manche ganze
Terra sigillata-Gefässe werden zusammen-
setzen lassen, letztere besonders wertvolle
historische Dokumente, da man sie datieren
kann, und auch durch die mancherlei ein-
gekritzelten Namen von Soldaten, denen sie
gehörten. Nach Aufdeckung des einen
Brunnens steht zu erwarten, dass noch
weitere gefunden werden, so dass die schon
jetzt nicht unbeträchtliche Anzahl von Fun-
den von Museumswert sich voraussichtlich
noch wesentlich vergrössern wird. Aber
auch ohne diese lohnen schon die wissen-
schaftlichen Ergebnisse für die Geschichte
und die innere Einrichtung des Kastells
den Aufwand der Grabungen. Seither konnte
dieses nur in den Umfassungsmauern und
wenigen Innenbauten untersucht^ werden;
jetzt steht eine Menge Resultate für die
Innenstruktur zu erwarten. Abgesehen von
dem allem aber möchte selbstverständlich
Mauer ist zerstört; es ist nur noch ein kleiner
Sporn erhalten. Die Mauer selbst läuft stark
13 m lang nordwärts bis zu einer Kiesschüt-
tung, in der wir die Reste der via princi-
palis d. h. der das West- und Osttor ver-
bindenden, das Kastell durchquerenden einen
Hauptstrasse zu erkennen haben. Näheres
über Zweck und Anlage dieses Baus erhoffen
wir, wenn weitere Schichten uns wieder auf
ihn stossen lassen. Auf der Nordseite der
via principalis ist ein ebenso wichtiger Fund
gemacht worden. Etwa 8 m von dem Nord-
turm der porta dextra entfernt stiessen w'ir
auf einen Brunnen, was nach dem Urteil
der Sachverständigen auch im Kastell zu er-
warten war. Er ist wie alle Brunnen dieser
Art aus gleichmässigen isodomen Quadern
sauber aufgemauert, in ein,er lichten Weite
von 0,85— 1 m Durchmesser. Seine Tiefe be-
trägt nach vollständiger Ausräumung 10.40 m.
Seine Sohle sitzt auf einer wasserdichten
Lettenschicht auf. Die Ausräumung ergab
natürlich eine reichliche Ausbeute an Fun-
den, so neben den gewöhnlichen Kleinfun-
den Scherben, Bronzestücken, Weinberg-
schneckenschalen, Tierknochen, eine Menge
von Eisensachen wie Ketten, Ringe und
Haken zum Aufziehen des Schöpfeimers,
über 20 schmiedeiserne Bandringe, meist
zu Wagennaben gehörig, Bänder, ein eigen-
artiges Türschloss, eine Sense mit Resten
des Holzgriffs, im ganzen über 70 einzelne
Eisenteile, zum Teil sehr gut erhalten; dann
zwei grosse Bronzeschüsseln, von denen
eine mit etwa 40 cm Durchmesser und rund
20 cm Höhe fast noch ganz erhalten ist.
Etwas oberhalb der untersten Schicht in
etwa 9 m Tiefe erschien ein kleiner Vier-
götterstein mit Flachreliefs von roher pro-
vinzialer Kunst; es lassen sich, trotzdem
der Stein Spuren der Zerstörung durch Brand
aufweist, noch Reste von Bemalung fest-
stellen. Eine Deutung der dargestellten
Gestalten ist erst nach vorsichtiger Ab-
trocknung und Ablösung der noch aufkle-
benden feuchten Lehmschicht möglich; an
anderen Stellen fanden sich architektonische
Reste, steinerne Basen von Holzsäulen, eine
Steinsäule, dann eine mächtige Schleuder-
kugel.
Auf der anderen Seite des Grabungs-
feldes, vom Prätorium westwärts, wurden
zunächst die Umfassungsmauern dieses Baues
angeschnitten und samt den noch feststell-
baren Innenmauern blossgelegt. Entgegen
einer in der Presse verbreiteten Notiz, dass
auf dem bisher bekannten Plan manches
nicht Vorhandene eingezeichnet sei, ist fest-
zustellen, dass sich der bisherige Befund
im Prätorium so ziemlich mit dem Ergeb-
nis der früheren Grabungen deckt; selbst-
verständlich sind wir in der Lage gewesen,
noch wesentlich mehr zu finden, da jene
sich hatten auf die Konstatierung der Um-
fassungsmauern beschränken müssen. Bei
der geringen Tiefe der Fundamentmauern
— diese liegen nicht einmal einen halben
Meter unter dem heutigen Niveau — ist hier
von aufgehendem Mauerwerk keine Spur
mehr zu finden, es ist wohl schon bei Urbar-
machung des Bodens ausgerissen worden.
Je mehr gegen Osten, um so höher liegt der
Urboden, meist in einer leichten Humusdecke
oder direkt in Tuffsand bestehend. Neben
Mauerzügen von beträchtlicher Dicke (bis
über 1 m) traf man auch auf Stücke einer
ausgedehnten Hofpflasterung. Auch hier hat
die bürgerliche Besiedlung ihre Spuren hin-
terlassen. Lücken in den Mauern, über
Mauern gesetzte Mörtelböden, lassen sich
mehrfach feststellen. Aber auch der Prä-
toriumsbau ist nicht von Anfang an hier ge-
standen. Unter den Fundamentmauern, vor
allem in dem ins unterste Fundament geleg-
ten Letten, lagen zahlreiche Kohlenreste, und
das ganze Fundament lagert auf einer mit
Scherben- und Brandspuren durchsetzten
Humusschicht, die ebenso wie die Reste der
Holzbaracken an der porta dextra auf die
erste Kastellzeit hindeuten; man ist aussen
am Prätorium in der Lage, deutlich eine
gelbe Schicht, welche älteste und zweite
Kastellschicht trennt, zu unterscheiden.
An die genannte Funde schliessen wir
noch eine kurze Erwähnuug der zerstreut
gefundenen Sachen, die da und dort in den
einzelnen Schichten, die wir durchgraben,
auftauchen. Sie bestehen meist, wie es sich
bei den nicht besonders wohlhabenden Sol-
daten des Lagers und der Zivilbevölkerung,
die sich nach Hinausverlegung der Neckar-
limeslinie hier ansiedelten, von selbst ver-
steht, aus gewöhnlichen Gebrauchsgegen-
ständen des täglichen Lebens. Die reicheren
Canabenses scheinen von jeher, auch noch
nach Abzug des Militärs, ausserhalb des
Kastells mehr westlich gewohnt zu haben.
Wir nennen noch Haarnadeln und Pfriemen
aus Bein, bronzene Löffel, Bronzebeschläge,
eiserne Lanzenspitzen und Messer, bronzene
Fibeln, Schreibgeräte, dazu Tonscherben
aller Art, aus denen sich manche ganze
Terra sigillata-Gefässe werden zusammen-
setzen lassen, letztere besonders wertvolle
historische Dokumente, da man sie datieren
kann, und auch durch die mancherlei ein-
gekritzelten Namen von Soldaten, denen sie
gehörten. Nach Aufdeckung des einen
Brunnens steht zu erwarten, dass noch
weitere gefunden werden, so dass die schon
jetzt nicht unbeträchtliche Anzahl von Fun-
den von Museumswert sich voraussichtlich
noch wesentlich vergrössern wird. Aber
auch ohne diese lohnen schon die wissen-
schaftlichen Ergebnisse für die Geschichte
und die innere Einrichtung des Kastells
den Aufwand der Grabungen. Seither konnte
dieses nur in den Umfassungsmauern und
wenigen Innenbauten untersucht^ werden;
jetzt steht eine Menge Resultate für die
Innenstruktur zu erwarten. Abgesehen von
dem allem aber möchte selbstverständlich