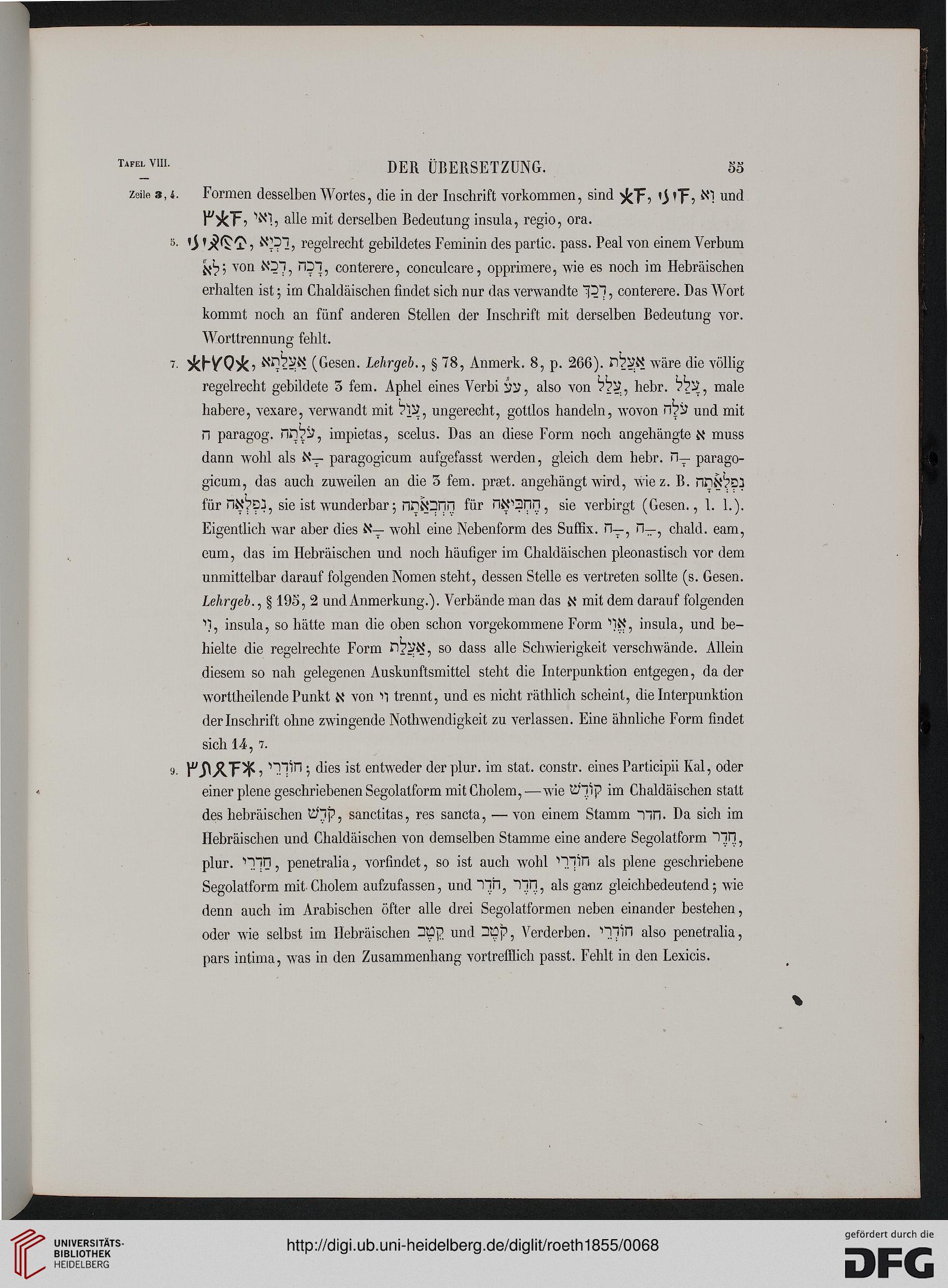™m DER ÜBERSETZUNG. 55
zeiie 3,4. Formen desselben Wortes, die in der Inschrift vorkommen, sind ^"p, ij i"p, und
F^T*? ^1, alle mit derselben Bedeutung insula, regio, ora.
5- 'i 7 regelrecht gebildetes Feminin des partic. pass. Peal von einem Verbum
j^>; von fcO"?, nDT, conterere, conculcare, opprimere, wie es noch im Hebräischen
erhalten ist ; im Chaldäischen findet sich nur das verwandte ^TJ, conterere. Das Wort
kommt noch an fünf anderen Stellen der Inschrift mit derselben Bedeutung vor.
Worttrennung fehlt.
7- j&YQ'k, (Gesen. Lehrgeb., § 78, Anmerk. 8, p. 266). rksX wäre die völlig
regelrecht gebildete 5 fem. Aphel eines Verbi also von , hebr. , male
habere, vexare, verwandt mit ungerecht, gottlos handeln, wovon nbiJ und mit
n paragog. HiH?^, impietas, scelus. Das an diese Form noch angehängte K muss
dann wohl als ü— paragogicum aufgefasst werden, gleich dem hebr. H— parago-
gicum, das auch zuweilen an die 3 fem. prset. angehängt wird, wiez. B. nri&^Di
für HJ<7D3, sie ist wunderbar; TiTih Drin für niOSiin, sie verbirgt (Gesen., I. 1.).
Eigentlich war aber dies ft— wohl eine Nebenform des Suffix. nT, PI—, chald. eam,
eum, das im Hebräischen und noch häufiger im Chaldäischen pleonastisch vor dem
unmittelbar darauf folgenden Nomen steht, dessen Stelle es vertreten sollte (s. Gesen.
Lehrgeb., § 195, 2 und Anmerkung.). Verbände man das K mit dem darauf folgenden
"•l, insula, so hätte man die oben schon vorgekommene Form 'OK, insula, und be-
hielte die regelrechte Form D^K, so dass alle Schwierigkeit verschwände. Allein
diesem so nah gelegenen Auskunftsmittel steht die Interpunktion entgegen, da der
worttheilende Punkt K von ii trennt, und es nicht räthlich scheint, die Interpunktion
der Inschrift ohne zwingende Nothwendigkeit zu verlassen. Eine ähnliche Form findet
sich 14, 7.
9. fj^XT^ ■> ^TflR '■> dies ist entweder der plur. im stat. constr. eines Participii Kai, oder
einer plene geschriebenen Segolatform mit Cholem, —wie ^"ip im Chaldäischen statt
des hebräischen $1p, sanctitas, res sancta, — von einem Stamm Tin. Da sich im
Hebräischen und Chaldäischen von demselben Stamme eine andere Segolatform ~nn,
plur. <H")Ö, penetralia, vorfindet, so ist auch wohl ^TflTi als plene geschriebene
Segolatform mit Cholem aufzufassen, und TJ.il, TJJ1, als ganz gleichbedeutend5 wie
denn auch im Arabischen öfter alle drei Segolatformen neben einander bestehen,
oder wie selbst im Hebräischen 3t0p und Dtpp, Verderben. >T?1n also penetralia,
pars intima, was in den Zusammenhang vortrefflich passt. Fehlt in den Lexicis.
zeiie 3,4. Formen desselben Wortes, die in der Inschrift vorkommen, sind ^"p, ij i"p, und
F^T*? ^1, alle mit derselben Bedeutung insula, regio, ora.
5- 'i 7 regelrecht gebildetes Feminin des partic. pass. Peal von einem Verbum
j^>; von fcO"?, nDT, conterere, conculcare, opprimere, wie es noch im Hebräischen
erhalten ist ; im Chaldäischen findet sich nur das verwandte ^TJ, conterere. Das Wort
kommt noch an fünf anderen Stellen der Inschrift mit derselben Bedeutung vor.
Worttrennung fehlt.
7- j&YQ'k, (Gesen. Lehrgeb., § 78, Anmerk. 8, p. 266). rksX wäre die völlig
regelrecht gebildete 5 fem. Aphel eines Verbi also von , hebr. , male
habere, vexare, verwandt mit ungerecht, gottlos handeln, wovon nbiJ und mit
n paragog. HiH?^, impietas, scelus. Das an diese Form noch angehängte K muss
dann wohl als ü— paragogicum aufgefasst werden, gleich dem hebr. H— parago-
gicum, das auch zuweilen an die 3 fem. prset. angehängt wird, wiez. B. nri&^Di
für HJ<7D3, sie ist wunderbar; TiTih Drin für niOSiin, sie verbirgt (Gesen., I. 1.).
Eigentlich war aber dies ft— wohl eine Nebenform des Suffix. nT, PI—, chald. eam,
eum, das im Hebräischen und noch häufiger im Chaldäischen pleonastisch vor dem
unmittelbar darauf folgenden Nomen steht, dessen Stelle es vertreten sollte (s. Gesen.
Lehrgeb., § 195, 2 und Anmerkung.). Verbände man das K mit dem darauf folgenden
"•l, insula, so hätte man die oben schon vorgekommene Form 'OK, insula, und be-
hielte die regelrechte Form D^K, so dass alle Schwierigkeit verschwände. Allein
diesem so nah gelegenen Auskunftsmittel steht die Interpunktion entgegen, da der
worttheilende Punkt K von ii trennt, und es nicht räthlich scheint, die Interpunktion
der Inschrift ohne zwingende Nothwendigkeit zu verlassen. Eine ähnliche Form findet
sich 14, 7.
9. fj^XT^ ■> ^TflR '■> dies ist entweder der plur. im stat. constr. eines Participii Kai, oder
einer plene geschriebenen Segolatform mit Cholem, —wie ^"ip im Chaldäischen statt
des hebräischen $1p, sanctitas, res sancta, — von einem Stamm Tin. Da sich im
Hebräischen und Chaldäischen von demselben Stamme eine andere Segolatform ~nn,
plur. <H")Ö, penetralia, vorfindet, so ist auch wohl ^TflTi als plene geschriebene
Segolatform mit Cholem aufzufassen, und TJ.il, TJJ1, als ganz gleichbedeutend5 wie
denn auch im Arabischen öfter alle drei Segolatformen neben einander bestehen,
oder wie selbst im Hebräischen 3t0p und Dtpp, Verderben. >T?1n also penetralia,
pars intima, was in den Zusammenhang vortrefflich passt. Fehlt in den Lexicis.