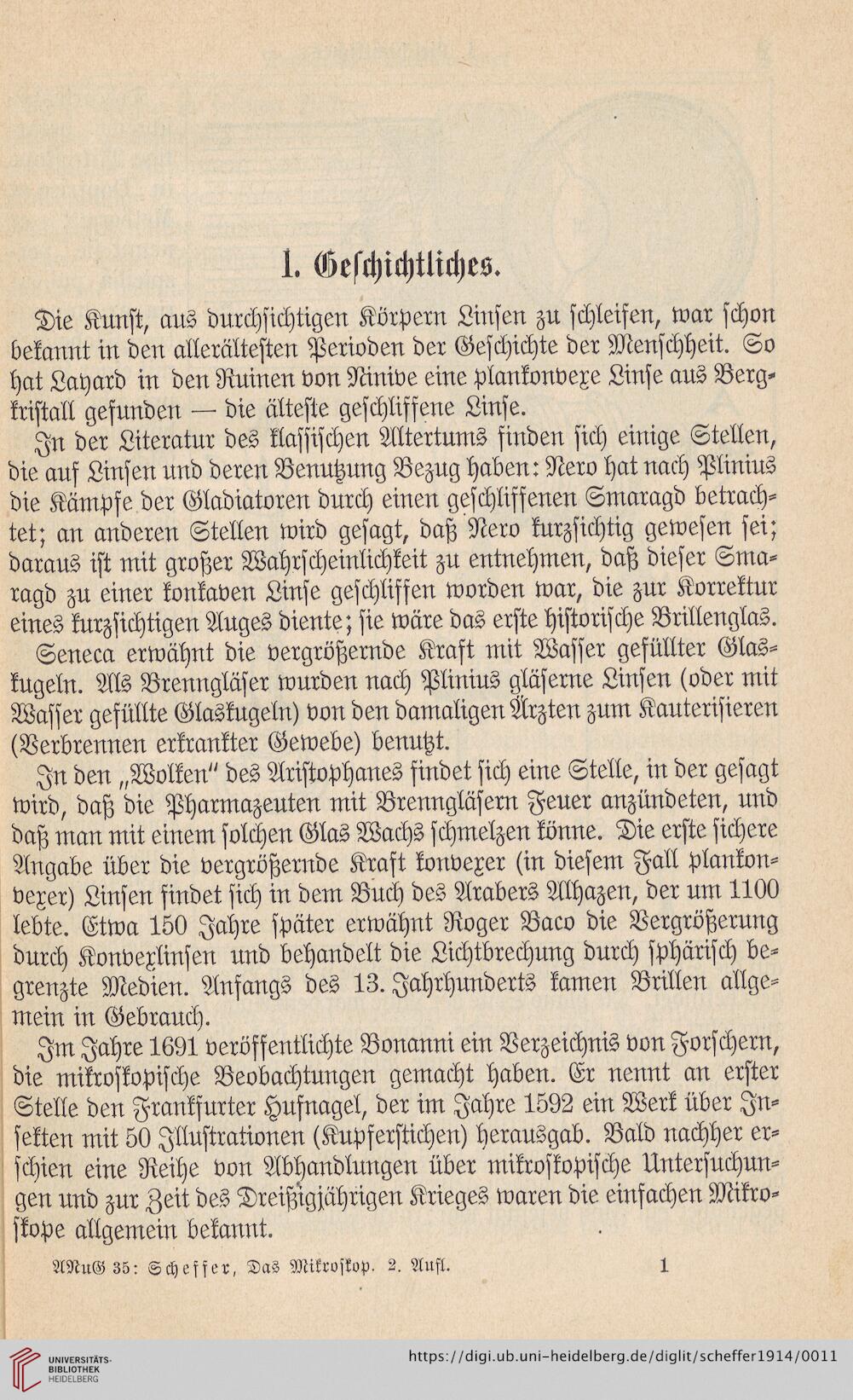I. Geschichtliches.
Die Kunst, aus durchsichtigen Körpern Linsen zu schleifen, war schon
bekannt in den allerältesten Perioden der Geschichte der Menschheit. So
hat Layard in den Ruinen von Ninive eine plankonvexe Linse aus Berg-
kristall gesunden — die älteste geschliffene Linse.
In der Literatur des klassischen Altertums finden sich einige Stellen,
die auf Linsen und deren Benutzung Bezug haben: Nero hat nach Plinius
die Kämpfe der Gladiatoren durch einen geschliffenen Smaragd betrach-
tet; an anderen Stellen wird gesagt, daß Nero kurzsichtig gewesen sei;
daraus ist mit großer Wahrscheinlichkeit zu entnehmen, daß dieser Sma-
ragd zu einer konkaven Linse geschliffen worden war, die zur Korrektur
eines kurzsichtigen Auges diente; sie wäre das erste historische Brillenglas.
Seneca erwähnt die vergrößernde Kraft mit Wasser gefüllter Glas-
kugeln. Als Brenngläser wurden nach Plinius gläserne Linsen (oder mit
Wasser gefüllte Glaskugeln) von den damaligen Ärzten zum Kauterisieren
(Verbrennen erkrankter Gewebe) benutzt.
In den „Wolken" des Aristophanes findet sich eine Stelle, in der gesagt
wird, daß die Pharmazeuten mit Brenngläsern Feuer anzündeten, und
daß man mit einem solchen Glas Wachs schmelzen könne. Die erste sichere
Angabe über die vergrößernde Kraft konvexer (in diesem Fall plankon-
vexer) Linsen findet sich in dem Buch des Arabers Whazen, der um 1100
lebte. Etwa 150 Jahre später erwähnt Roger Baco die Vergrößerung
durch Konvexlinsen und behandelt die Lichtbrechung durch sphärisch be-
grenzte Medien. Anfangs des 13. Jahrhunderts kamen Brillen allge-
mein in Gebrauch.
Im Jahre 1691 veröffentlichte Bonanni ein Verzeichnis von Forschem,
die mikroskopische Beobachtungen gemacht haben. Er nennt an erster
Stelle den Frankfurter Hufnagel, der im Jahre 1592 ein Werk über In-
sekten mit 50 Illustrationen (Kupferstichen) herausgab. Bald nachher er-
schien eine Reihe von Abhandlungen über mikroskopische Untersuchun-
gen und zur Zeit des Dreißigjährigen Krieges waren die einfachen Mikro-
skope allgemein bekannt.
ANuG35: Scheffer, Das Mikroskop. 2. Aufl.
1
Die Kunst, aus durchsichtigen Körpern Linsen zu schleifen, war schon
bekannt in den allerältesten Perioden der Geschichte der Menschheit. So
hat Layard in den Ruinen von Ninive eine plankonvexe Linse aus Berg-
kristall gesunden — die älteste geschliffene Linse.
In der Literatur des klassischen Altertums finden sich einige Stellen,
die auf Linsen und deren Benutzung Bezug haben: Nero hat nach Plinius
die Kämpfe der Gladiatoren durch einen geschliffenen Smaragd betrach-
tet; an anderen Stellen wird gesagt, daß Nero kurzsichtig gewesen sei;
daraus ist mit großer Wahrscheinlichkeit zu entnehmen, daß dieser Sma-
ragd zu einer konkaven Linse geschliffen worden war, die zur Korrektur
eines kurzsichtigen Auges diente; sie wäre das erste historische Brillenglas.
Seneca erwähnt die vergrößernde Kraft mit Wasser gefüllter Glas-
kugeln. Als Brenngläser wurden nach Plinius gläserne Linsen (oder mit
Wasser gefüllte Glaskugeln) von den damaligen Ärzten zum Kauterisieren
(Verbrennen erkrankter Gewebe) benutzt.
In den „Wolken" des Aristophanes findet sich eine Stelle, in der gesagt
wird, daß die Pharmazeuten mit Brenngläsern Feuer anzündeten, und
daß man mit einem solchen Glas Wachs schmelzen könne. Die erste sichere
Angabe über die vergrößernde Kraft konvexer (in diesem Fall plankon-
vexer) Linsen findet sich in dem Buch des Arabers Whazen, der um 1100
lebte. Etwa 150 Jahre später erwähnt Roger Baco die Vergrößerung
durch Konvexlinsen und behandelt die Lichtbrechung durch sphärisch be-
grenzte Medien. Anfangs des 13. Jahrhunderts kamen Brillen allge-
mein in Gebrauch.
Im Jahre 1691 veröffentlichte Bonanni ein Verzeichnis von Forschem,
die mikroskopische Beobachtungen gemacht haben. Er nennt an erster
Stelle den Frankfurter Hufnagel, der im Jahre 1592 ein Werk über In-
sekten mit 50 Illustrationen (Kupferstichen) herausgab. Bald nachher er-
schien eine Reihe von Abhandlungen über mikroskopische Untersuchun-
gen und zur Zeit des Dreißigjährigen Krieges waren die einfachen Mikro-
skope allgemein bekannt.
ANuG35: Scheffer, Das Mikroskop. 2. Aufl.
1