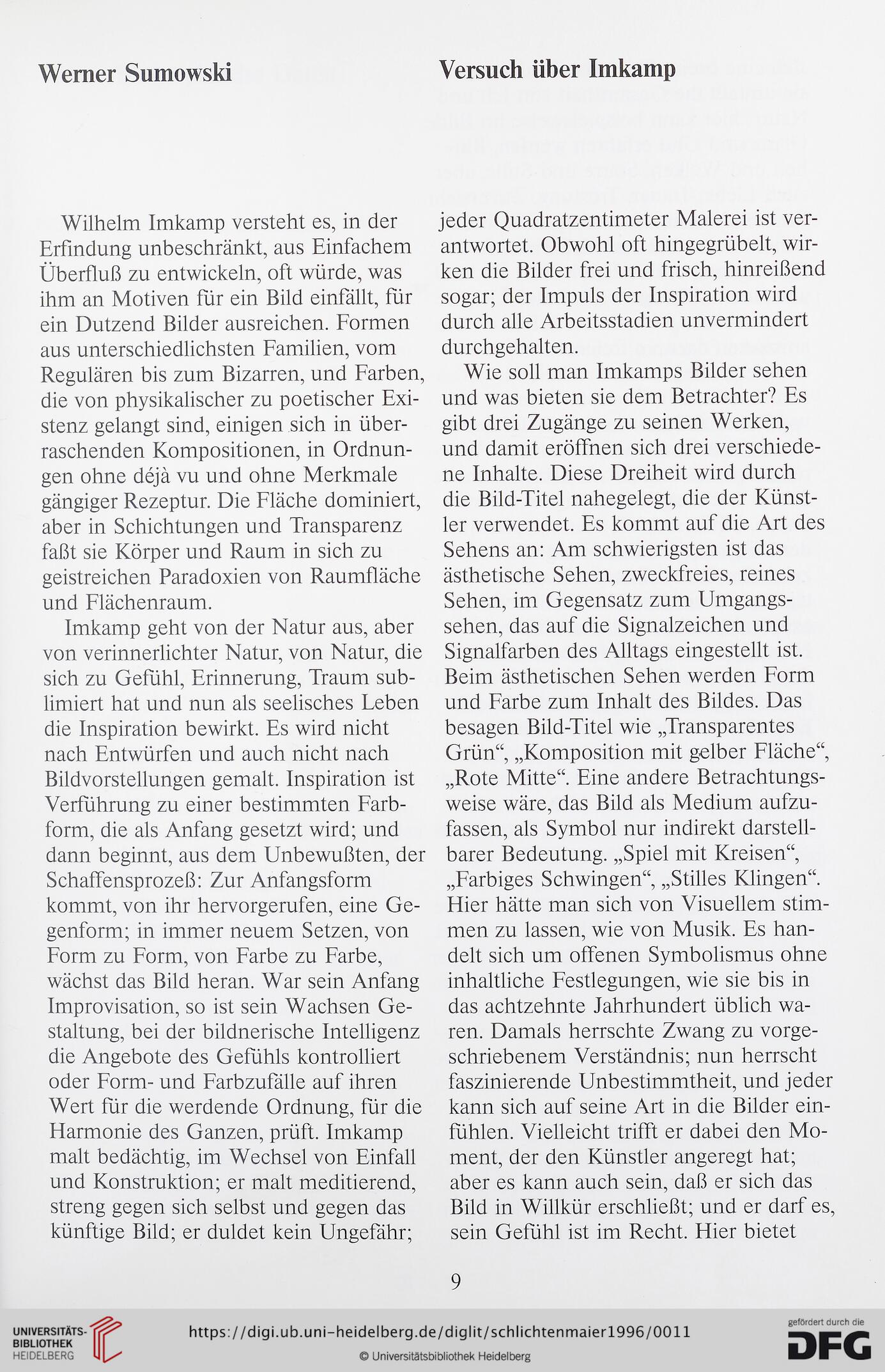Werner Sumowski
Versuch über Imkamp
Wilhelm Imkamp versteht es, in der
Erfindung unbeschränkt, aus Einfachem
Überfluß zu entwickeln, oft würde, was
ihm an Motiven für ein Bild einfällt, für
ein Dutzend Bilder ausreichen. Formen
aus unterschiedlichsten Familien, vom
Regulären bis zum Bizarren, und Farben,
die von physikalischer zu poetischer Exi-
stenz gelangt sind, einigen sich in über-
raschenden Kompositionen, in Ordnun-
gen ohne dejä vu und ohne Merkmale
gängiger Rezeptur. Die Fläche dominiert,
aber in Schichtungen und Transparenz
faßt sie Körper und Raum in sich zu
geistreichen Paradoxien von Raumfläche
und Flächenraum.
Imkamp geht von der Natur aus, aber
von verinnerlichter Natur, von Natur, die
sich zu Gefühl, Erinnerung, Traum sub-
limiert hat und nun als seelisches Leben
die Inspiration bewirkt. Es wird nicht
nach Entwürfen und auch nicht nach
Bildvorstellungen gemalt. Inspiration ist
Verführung zu einer bestimmten Farb-
form, die als Anfang gesetzt wird; und
dann beginnt, aus dem Unbewußten, der
Schaffensprozeß: Zur Anfangsform
kommt, von ihr hervorgerufen, eine Ge-
genform; in immer neuem Setzen, von
Form zu Form, von Farbe zu Farbe,
wächst das Bild heran. War sein Anfang
Improvisation, so ist sein Wachsen Ge-
staltung, bei der bildnerische Intelligenz
die Angebote des Gefühls kontrolliert
oder Form- und Farbzufälle auf ihren
Wert für die werdende Ordnung, für die
Harmonie des Ganzen, prüft. Imkamp
malt bedächtig, im Wechsel von Einfall
und Konstruktion; er malt meditierend,
streng gegen sich selbst und gegen das
künftige Bild; er duldet kein Ungefähr;
jeder Quadratzentimeter Malerei ist ver-
antwortet. Obwohl oft hingegrübelt, wir-
ken die Bilder frei und frisch, hinreißend
sogar; der Impuls der Inspiration wird
durch alle Arbeitsstadien unvermindert
durchgehalten.
Wie soll man Imkamps Bilder sehen
und was bieten sie dem Betrachter? Es
gibt drei Zugänge zu seinen Werken,
und damit eröffnen sich drei verschiede-
ne Inhalte. Diese Dreiheit wird durch
die Bild-Titel nahegelegt, die der Künst-
ler verwendet. Es kommt auf die Art des
Sehens an: Am schwierigsten ist das
ästhetische Sehen, zweckfreies, reines
Sehen, im Gegensatz zum Umgangs-
sehen, das auf die Signalzeichen und
Signalfarben des Alltags eingestellt ist.
Beim ästhetischen Sehen werden Form
und Farbe zum Inhalt des Bildes. Das
besagen Bild-Titel wie „Transparentes
Grün“, „Komposition mit gelber Fläche“,
„Rote Mitte“. Eine andere Betrachtungs-
weise wäre, das Bild als Medium aufzu-
fassen, als Symbol nur indirekt darstell-
barer Bedeutung. „Spiel mit Kreisen“,
„Farbiges Schwingen“, „Stilles Klingen“.
Hier hätte man sich von Visuellem stim-
men zu lassen, wie von Musik. Es han-
delt sich um offenen Symbolismus ohne
inhaltliche Festlegungen, wie sie bis in
das achtzehnte Jahrhundert üblich wa-
ren. Damals herrschte Zwang zu vorge-
schriebenem Verständnis; nun herrscht
faszinierende Unbestimmtheit, und jeder
kann sich auf seine Art in die Bilder ein-
fühlen. Vielleicht trifft er dabei den Mo-
ment, der den Künstler angeregt hat;
aber es kann auch sein, daß er sich das
Bild in Willkür erschließt; und er darf es,
sein Gefühl ist im Recht. Hier bietet
9
Versuch über Imkamp
Wilhelm Imkamp versteht es, in der
Erfindung unbeschränkt, aus Einfachem
Überfluß zu entwickeln, oft würde, was
ihm an Motiven für ein Bild einfällt, für
ein Dutzend Bilder ausreichen. Formen
aus unterschiedlichsten Familien, vom
Regulären bis zum Bizarren, und Farben,
die von physikalischer zu poetischer Exi-
stenz gelangt sind, einigen sich in über-
raschenden Kompositionen, in Ordnun-
gen ohne dejä vu und ohne Merkmale
gängiger Rezeptur. Die Fläche dominiert,
aber in Schichtungen und Transparenz
faßt sie Körper und Raum in sich zu
geistreichen Paradoxien von Raumfläche
und Flächenraum.
Imkamp geht von der Natur aus, aber
von verinnerlichter Natur, von Natur, die
sich zu Gefühl, Erinnerung, Traum sub-
limiert hat und nun als seelisches Leben
die Inspiration bewirkt. Es wird nicht
nach Entwürfen und auch nicht nach
Bildvorstellungen gemalt. Inspiration ist
Verführung zu einer bestimmten Farb-
form, die als Anfang gesetzt wird; und
dann beginnt, aus dem Unbewußten, der
Schaffensprozeß: Zur Anfangsform
kommt, von ihr hervorgerufen, eine Ge-
genform; in immer neuem Setzen, von
Form zu Form, von Farbe zu Farbe,
wächst das Bild heran. War sein Anfang
Improvisation, so ist sein Wachsen Ge-
staltung, bei der bildnerische Intelligenz
die Angebote des Gefühls kontrolliert
oder Form- und Farbzufälle auf ihren
Wert für die werdende Ordnung, für die
Harmonie des Ganzen, prüft. Imkamp
malt bedächtig, im Wechsel von Einfall
und Konstruktion; er malt meditierend,
streng gegen sich selbst und gegen das
künftige Bild; er duldet kein Ungefähr;
jeder Quadratzentimeter Malerei ist ver-
antwortet. Obwohl oft hingegrübelt, wir-
ken die Bilder frei und frisch, hinreißend
sogar; der Impuls der Inspiration wird
durch alle Arbeitsstadien unvermindert
durchgehalten.
Wie soll man Imkamps Bilder sehen
und was bieten sie dem Betrachter? Es
gibt drei Zugänge zu seinen Werken,
und damit eröffnen sich drei verschiede-
ne Inhalte. Diese Dreiheit wird durch
die Bild-Titel nahegelegt, die der Künst-
ler verwendet. Es kommt auf die Art des
Sehens an: Am schwierigsten ist das
ästhetische Sehen, zweckfreies, reines
Sehen, im Gegensatz zum Umgangs-
sehen, das auf die Signalzeichen und
Signalfarben des Alltags eingestellt ist.
Beim ästhetischen Sehen werden Form
und Farbe zum Inhalt des Bildes. Das
besagen Bild-Titel wie „Transparentes
Grün“, „Komposition mit gelber Fläche“,
„Rote Mitte“. Eine andere Betrachtungs-
weise wäre, das Bild als Medium aufzu-
fassen, als Symbol nur indirekt darstell-
barer Bedeutung. „Spiel mit Kreisen“,
„Farbiges Schwingen“, „Stilles Klingen“.
Hier hätte man sich von Visuellem stim-
men zu lassen, wie von Musik. Es han-
delt sich um offenen Symbolismus ohne
inhaltliche Festlegungen, wie sie bis in
das achtzehnte Jahrhundert üblich wa-
ren. Damals herrschte Zwang zu vorge-
schriebenem Verständnis; nun herrscht
faszinierende Unbestimmtheit, und jeder
kann sich auf seine Art in die Bilder ein-
fühlen. Vielleicht trifft er dabei den Mo-
ment, der den Künstler angeregt hat;
aber es kann auch sein, daß er sich das
Bild in Willkür erschließt; und er darf es,
sein Gefühl ist im Recht. Hier bietet
9