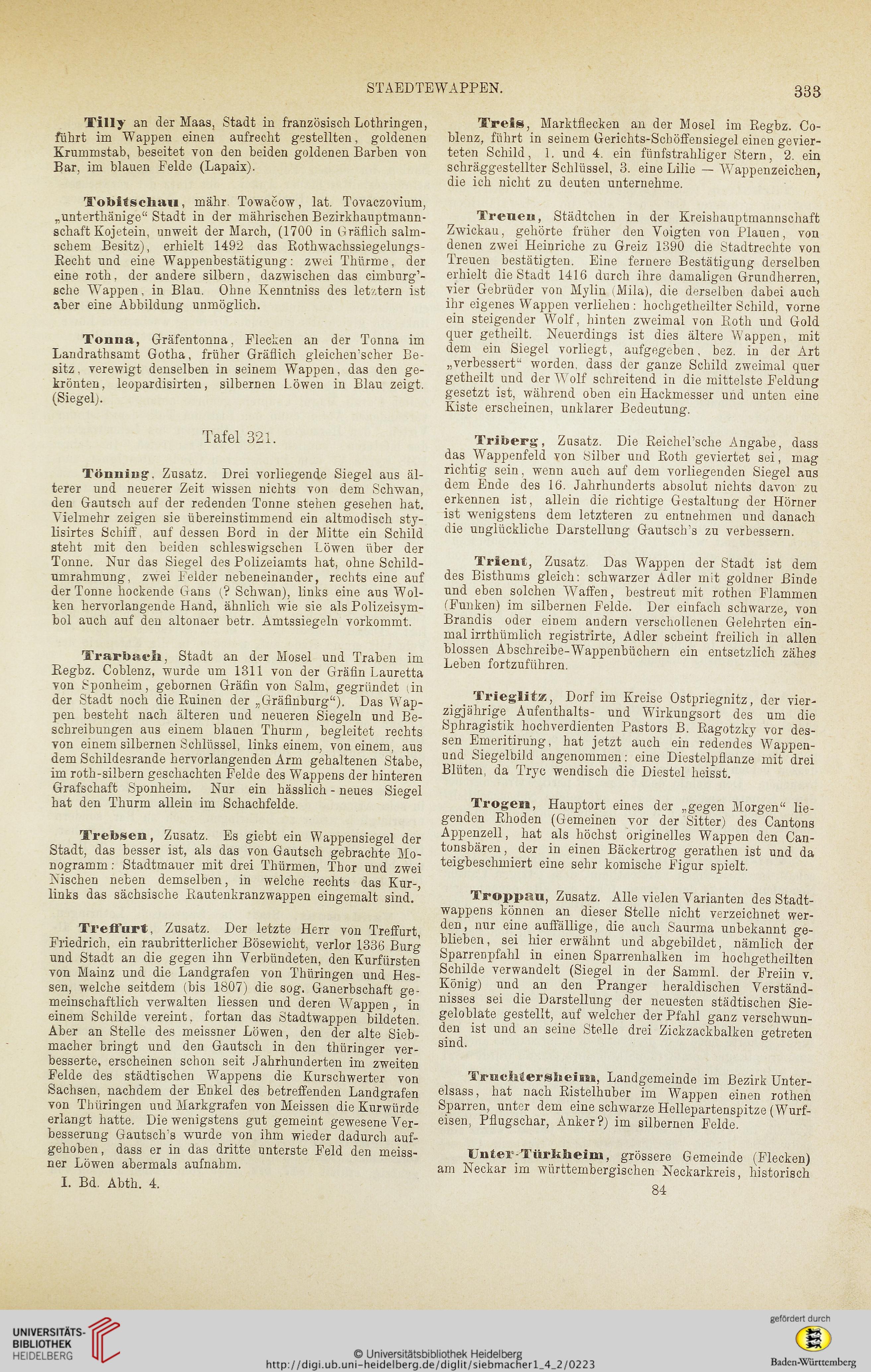STAEDTEWAPPEN.
333
Tilly an der Maas, Stadt in französisch Lothringen,
führt im Wappen einen aufrecht gestellten, goldenen
Krummstab, beseitet von den beiden goldenen Barben von
Bar, im blauen Felde (Lapaix).
Tobifschaii, mähr. Towacow, lat. Tovaezovium,
„unterthänige“ Stadt in der mährischen Bezirkhauptmann-
schaft Kojetein, unweit der March, (1700 in Gräflich salm-
schem Besitz), erhielt 1492 das Rothwachssiegelungs-
Eecht und eine Wappenbestätigung: zwei Thürme, der
eine roth, der andere silbern, dazwischen das cimburg’-
sche Wappen, in Blau. Ohne Kenntniss des letztern ist
aber eine Abbildung unmöglich.
Tonna, Gräfentonna, Flecken an der Tonna im
Lanurathsamt Gotha, f'rüher Gräflich gleichen'scher Be-
sitz. verewigt denselben in seinem Wappen, das den ge-
krönten, leopardisirten, silbernen Löwen in Blau zeigt.
(Siegel).
Tafel 321.
Tönning. Zusatz. Drei vorliegende Siegel aus äl-
terer und neuerer Zeit wissen nichts von dem Schwan,
den Gautsch auf der redenden Tonne stehen gesehen hat,
Vielmehr zeigen sie übereinstimmend ein altmodisch sty-
lisirtes Schiff, auf dessen Bord in der Mitte ein Schild
steht mit den beiden schleswigschen Löwen iiber der
Tonne. Nur das Siegel des Polizeiamts hat, ohne Schild-
umrahmung, zwei Felder nebeneinander, rechts eine auf
der Tonne hockende Gans (? Schwan), links eine aus Wol-
ken hervorlangenae Hand, ähnlich wie sie als Polizeisym-
bol auch auf den altonaer betr. Amtssiegeln vorkommt.
Trarbach, Stadt an der Mosel und Traben im
Eegbz. Coblenz, wurde um 1311 von der Gräfin Lauretta
von Sponheim, gebornen Gräfin von Salrn, gegriindet ün
der Stadt noch die Ruinen der „Gräfinburg“). Das Wap-
pen besteht nach älteren und neueren Siegeln und Be-
schreibungen aus einem blauen Thurm, begleitet rechts
von einem silbernen Schliissel, links einem, von einem, aus
dem Schildesrande hervorlangenden Arm gehaltenen Stabe,
im roth-silbern geschachten Felde des Wappens der hinteren
Grafschaft Sponheim. Nur ein hässlich - neues Siegel
hat den Thurm allein im Schachfelde.
Trebsen, Zusatz. Es giebt ein Wappensiegel der
Stadt, das besser ist, als das von Gautsch gebrachte Mo-
nogramm: Stadtmauer mit drei Thürmen, Thor und zwei
Nischen neben demselben, in welche rechts das Kur-,
links das sächsische Rautenkranzwappen eingemalt sind.
Trelfart, Zusatz. Der letzte Herr von Treffurt,
Friedrich, ein raubritterlicher Bösewicht, verlor 1336 Burg
und Stadt an die gegen ihn Yerbündeten, den Kurfiirsten
von Mainz und die Landgrafen von Thüringen und Hes-
sen, welche seitdem (bis 1807) die sog. Ganerbschaft ge-
meinschaftlich verwalten liessen und deren Wappen , in
einem Schilde vereint, fortan das Stadtwappen bildeten.
Aber an Stelle des meissner Löwen, den der alte Sieb-
macher bringt und den Gautsch in den thiiringer ver-
besserte, erscheinen schon seit Jahrhunderten im zweiten
Felde des städtischen Wappens die Kurschwerter von
Sachsen, nachdem der Enkel des betreffenden Landgrafen
von Tlniringen und Markgrafen von Meissen die Kurwürde
erlangt hatte. Die wenigstens gut gemeint geweseneYer-
besserung Gautschü wurde von ihm wieder dadurch auf-
gehoben, dass er in das dritte unterste Feld den meiss-
ner Löwen abermals aufnabm.
I. Bd. Abth. 4.
Treis, Marktflecken an der Mosel im Regbz. Co-
blenz, führt in seinem Gerichts-Seböffensiegel einen gevier-
teten Schild, 1. und 4. ein fünfstrahliger Stern, 2. ein
schräggestellter Schlüssel, 3. eine Liiie — 'Wappenzeichen,
die ich nicht zu deuten unternehme.
Treueu, Städtchen in der Kreishauptmannschaft
Zwickau, gehörte früher den Voigten von Plauen, von
denen zwei Heinriche zu Greiz 1390 die Stadtrechte von
Treuen bestätigten. Eine fernere Bestätigung derselben
erhielt die Stadt 1416 durch ihre damaligen Grundherren,
vier Gebrüder von Mylin (Mila), die derselben dabei auch
ihr eigenes Wappen verliehen : hochgetlieilter Schild, vorne
ein steigender Wolf, hinten zweimal von Roth und Gold
quer getheilt. Neuerdings ist dies ältere Wappen, mit
dem ein Siegel vorliegt, aufgegeben, bez. in der Art
„verbessert“ worden. aass der ganze Sckild zweimal quer
getheilt und der V Tolf sckreitend. in die mittelste Feldung
gesetzt ist, während oben eiu Hackmesser und unten eine
Kiste erscheinen, unklarer Bedeutung.
Triöerg, Zusatz. Die Reichel’sche Angabe, dass
das Wappenfeld von Silber und Roth geviertet sei, mag
richtig sein, wenn auch auf dem vorliegenden Siegel aus
dem Ende des 16. Jahrkunderts absolut nichts davon zu
erkennen ist, allein die richtige Gestaltung der Hörner
ist wenigstens dem letzteren zu entnehmen und danach
die unglücklicke Darstellung Gautsch’s zu verbessern.
Trient, Zusatz. Das Wappen der Stadt ist dem
des Bisthums gleich: sckwarzer Adler mit goldner Binde
und eben solchen W 7affen, bestreut mit rothen Flammen
(Funken) im silbernen Felde. Der einfach schwarze, von
Brandis oder einem andern verscholleneu Gelehrten ein-
mal irrthümlich registrirte, Adler scheint freilich in allen
blossen Abschreibe-Wappenbüchern ein entsetzlich zähes
Leben fortzufükren.
TrieglltK, Dorf im Kreise Ostpriegnitz, der vier-
zigjährige Aufentkalts- und Wirkungsort des um die
Sphragistik hochverdienten Pastors B. Ragotzky vor des-
sen Emeritirung, hat jetzt auch ein redendes Wappen-
und SiegelbiJd angenommen: eine Diestelpflanze mit drei
Blüten, da Tryc wendisch die Diestel heisst.
Trogeia, Hauptort eines der „gegen Morgen“ lie-
genden Rhoden (Gemeinen vor der Sitter) des Cantons
Appenzell, hat als höchst originelles Wappen den Can-
tonsbären, der in einen Bäckertrog gerathen ist und da
teigbeschmiert eine sehr komiscke Figur spielt.
Troppau, Zusatz. Alle vielen Varianten des Stadt-
wappens können an dieser Stelle nicht verzeichnet wer-
den, nur eine auffällige, die auck Saurma unbekannt ge-
blieben, sei hier erwähnt und abgebildet, nämlich der
Sparrenpfahl in einen Sparrenhalken im hochgetheilten
Schilde verwandelt (Siegel in der Samml. der Freiin v.
König) und an den Pranger heraldischen Verständ-
nisses sei die Darstellung der neuesten städtischen Sie-
geloblate gestellt, auf welcher der Pfahl ganz versckwun-
den ist und an seine Stelle drei Zickzackbalken getreten
sind.
TB-sicMersöeiiäB, Landgemeinde im Bezirk ünter-
elsass, hat nach Ristelhuber im Wappen einen rothen
Sparren, unter dem eine schwarze Hellepartenspitze (Wurf-
eisen, Pflugschar, Anker?) im silbernen Felde.
I nJei TiiiSiiH»ini, grössere Gemeinde (Flecken)
am Neckar im württemhergischen Neckarkreis, historisch
84
333
Tilly an der Maas, Stadt in französisch Lothringen,
führt im Wappen einen aufrecht gestellten, goldenen
Krummstab, beseitet von den beiden goldenen Barben von
Bar, im blauen Felde (Lapaix).
Tobifschaii, mähr. Towacow, lat. Tovaezovium,
„unterthänige“ Stadt in der mährischen Bezirkhauptmann-
schaft Kojetein, unweit der March, (1700 in Gräflich salm-
schem Besitz), erhielt 1492 das Rothwachssiegelungs-
Eecht und eine Wappenbestätigung: zwei Thürme, der
eine roth, der andere silbern, dazwischen das cimburg’-
sche Wappen, in Blau. Ohne Kenntniss des letztern ist
aber eine Abbildung unmöglich.
Tonna, Gräfentonna, Flecken an der Tonna im
Lanurathsamt Gotha, f'rüher Gräflich gleichen'scher Be-
sitz. verewigt denselben in seinem Wappen, das den ge-
krönten, leopardisirten, silbernen Löwen in Blau zeigt.
(Siegel).
Tafel 321.
Tönning. Zusatz. Drei vorliegende Siegel aus äl-
terer und neuerer Zeit wissen nichts von dem Schwan,
den Gautsch auf der redenden Tonne stehen gesehen hat,
Vielmehr zeigen sie übereinstimmend ein altmodisch sty-
lisirtes Schiff, auf dessen Bord in der Mitte ein Schild
steht mit den beiden schleswigschen Löwen iiber der
Tonne. Nur das Siegel des Polizeiamts hat, ohne Schild-
umrahmung, zwei Felder nebeneinander, rechts eine auf
der Tonne hockende Gans (? Schwan), links eine aus Wol-
ken hervorlangenae Hand, ähnlich wie sie als Polizeisym-
bol auch auf den altonaer betr. Amtssiegeln vorkommt.
Trarbach, Stadt an der Mosel und Traben im
Eegbz. Coblenz, wurde um 1311 von der Gräfin Lauretta
von Sponheim, gebornen Gräfin von Salrn, gegriindet ün
der Stadt noch die Ruinen der „Gräfinburg“). Das Wap-
pen besteht nach älteren und neueren Siegeln und Be-
schreibungen aus einem blauen Thurm, begleitet rechts
von einem silbernen Schliissel, links einem, von einem, aus
dem Schildesrande hervorlangenden Arm gehaltenen Stabe,
im roth-silbern geschachten Felde des Wappens der hinteren
Grafschaft Sponheim. Nur ein hässlich - neues Siegel
hat den Thurm allein im Schachfelde.
Trebsen, Zusatz. Es giebt ein Wappensiegel der
Stadt, das besser ist, als das von Gautsch gebrachte Mo-
nogramm: Stadtmauer mit drei Thürmen, Thor und zwei
Nischen neben demselben, in welche rechts das Kur-,
links das sächsische Rautenkranzwappen eingemalt sind.
Trelfart, Zusatz. Der letzte Herr von Treffurt,
Friedrich, ein raubritterlicher Bösewicht, verlor 1336 Burg
und Stadt an die gegen ihn Yerbündeten, den Kurfiirsten
von Mainz und die Landgrafen von Thüringen und Hes-
sen, welche seitdem (bis 1807) die sog. Ganerbschaft ge-
meinschaftlich verwalten liessen und deren Wappen , in
einem Schilde vereint, fortan das Stadtwappen bildeten.
Aber an Stelle des meissner Löwen, den der alte Sieb-
macher bringt und den Gautsch in den thiiringer ver-
besserte, erscheinen schon seit Jahrhunderten im zweiten
Felde des städtischen Wappens die Kurschwerter von
Sachsen, nachdem der Enkel des betreffenden Landgrafen
von Tlniringen und Markgrafen von Meissen die Kurwürde
erlangt hatte. Die wenigstens gut gemeint geweseneYer-
besserung Gautschü wurde von ihm wieder dadurch auf-
gehoben, dass er in das dritte unterste Feld den meiss-
ner Löwen abermals aufnabm.
I. Bd. Abth. 4.
Treis, Marktflecken an der Mosel im Regbz. Co-
blenz, führt in seinem Gerichts-Seböffensiegel einen gevier-
teten Schild, 1. und 4. ein fünfstrahliger Stern, 2. ein
schräggestellter Schlüssel, 3. eine Liiie — 'Wappenzeichen,
die ich nicht zu deuten unternehme.
Treueu, Städtchen in der Kreishauptmannschaft
Zwickau, gehörte früher den Voigten von Plauen, von
denen zwei Heinriche zu Greiz 1390 die Stadtrechte von
Treuen bestätigten. Eine fernere Bestätigung derselben
erhielt die Stadt 1416 durch ihre damaligen Grundherren,
vier Gebrüder von Mylin (Mila), die derselben dabei auch
ihr eigenes Wappen verliehen : hochgetlieilter Schild, vorne
ein steigender Wolf, hinten zweimal von Roth und Gold
quer getheilt. Neuerdings ist dies ältere Wappen, mit
dem ein Siegel vorliegt, aufgegeben, bez. in der Art
„verbessert“ worden. aass der ganze Sckild zweimal quer
getheilt und der V Tolf sckreitend. in die mittelste Feldung
gesetzt ist, während oben eiu Hackmesser und unten eine
Kiste erscheinen, unklarer Bedeutung.
Triöerg, Zusatz. Die Reichel’sche Angabe, dass
das Wappenfeld von Silber und Roth geviertet sei, mag
richtig sein, wenn auch auf dem vorliegenden Siegel aus
dem Ende des 16. Jahrkunderts absolut nichts davon zu
erkennen ist, allein die richtige Gestaltung der Hörner
ist wenigstens dem letzteren zu entnehmen und danach
die unglücklicke Darstellung Gautsch’s zu verbessern.
Trient, Zusatz. Das Wappen der Stadt ist dem
des Bisthums gleich: sckwarzer Adler mit goldner Binde
und eben solchen W 7affen, bestreut mit rothen Flammen
(Funken) im silbernen Felde. Der einfach schwarze, von
Brandis oder einem andern verscholleneu Gelehrten ein-
mal irrthümlich registrirte, Adler scheint freilich in allen
blossen Abschreibe-Wappenbüchern ein entsetzlich zähes
Leben fortzufükren.
TrieglltK, Dorf im Kreise Ostpriegnitz, der vier-
zigjährige Aufentkalts- und Wirkungsort des um die
Sphragistik hochverdienten Pastors B. Ragotzky vor des-
sen Emeritirung, hat jetzt auch ein redendes Wappen-
und SiegelbiJd angenommen: eine Diestelpflanze mit drei
Blüten, da Tryc wendisch die Diestel heisst.
Trogeia, Hauptort eines der „gegen Morgen“ lie-
genden Rhoden (Gemeinen vor der Sitter) des Cantons
Appenzell, hat als höchst originelles Wappen den Can-
tonsbären, der in einen Bäckertrog gerathen ist und da
teigbeschmiert eine sehr komiscke Figur spielt.
Troppau, Zusatz. Alle vielen Varianten des Stadt-
wappens können an dieser Stelle nicht verzeichnet wer-
den, nur eine auffällige, die auck Saurma unbekannt ge-
blieben, sei hier erwähnt und abgebildet, nämlich der
Sparrenpfahl in einen Sparrenhalken im hochgetheilten
Schilde verwandelt (Siegel in der Samml. der Freiin v.
König) und an den Pranger heraldischen Verständ-
nisses sei die Darstellung der neuesten städtischen Sie-
geloblate gestellt, auf welcher der Pfahl ganz versckwun-
den ist und an seine Stelle drei Zickzackbalken getreten
sind.
TB-sicMersöeiiäB, Landgemeinde im Bezirk ünter-
elsass, hat nach Ristelhuber im Wappen einen rothen
Sparren, unter dem eine schwarze Hellepartenspitze (Wurf-
eisen, Pflugschar, Anker?) im silbernen Felde.
I nJei TiiiSiiH»ini, grössere Gemeinde (Flecken)
am Neckar im württemhergischen Neckarkreis, historisch
84