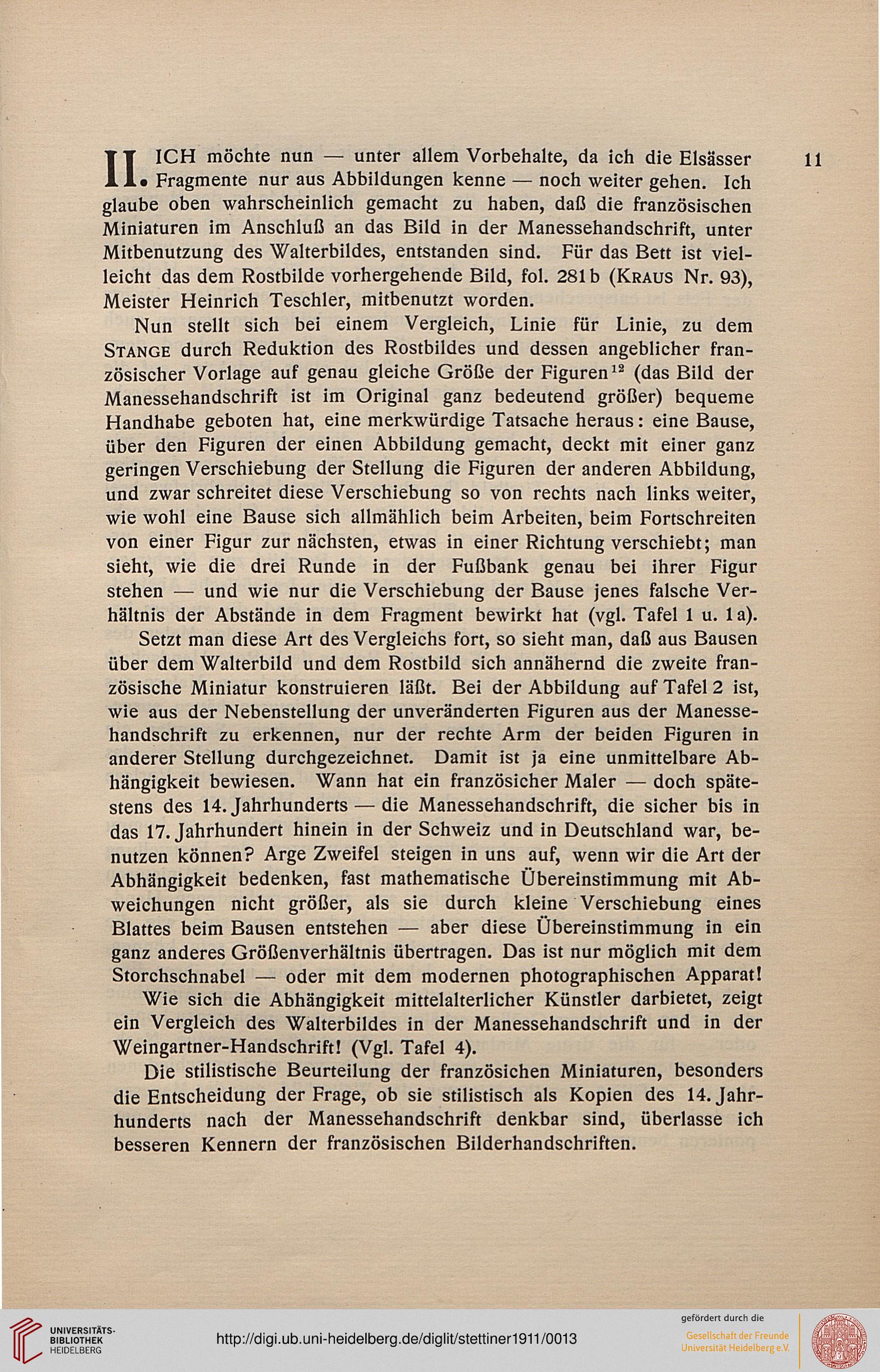nICH möchte nun — unter allem Vorbehalte, da ich die Elsässer 11
• Fragmente nur aus Abbildungen kenne — noch weiter gehen. Ich
glaube oben wahrscheinlich gemacht zu haben, daß die französischen
Miniaturen im Anschluß an das Bild in der Manessehandschrift, unter
Mitbenutzung des Walterbildes, entstanden sind. Für das Bett ist viel-
leicht das dem Rostbilde vorhergehende Bild, fol. 281b (Kraus Nr. 93),
Meister Heinrich Teschler, mitbenutzt worden.
Nun stellt sich bei einem Vergleich, Linie für Linie, zu dem
Stange durch Reduktion des Rostbildes und dessen angeblicher fran-
zösischer Vorlage auf genau gleiche Größe der Figuren12 (das Bild der
Manessehandschrift ist im Original ganz bedeutend größer) bequeme
Handhabe geboten hat, eine merkwürdige Tatsache heraus: eine Bause,
über den Figuren der einen Abbildung gemacht, deckt mit einer ganz
geringen Verschiebung der Stellung die Figuren der anderen Abbildung,
und zwar schreitet diese Verschiebung so von rechts nach links weiter,
wie wohl eine Bause sich allmählich beim Arbeiten, beim Fortschreiten
von einer Figur zur nächsten, etwas in einer Richtung verschiebt; man
sieht, wie die drei Runde in der Fußbank genau bei ihrer Figur
stehen — und wie nur die Verschiebung der Bause jenes falsche Ver-
hältnis der Abstände in dem Fragment bewirkt hat (vgl. Tafel 1 u. 1 a).
Setzt man diese Art des Vergleichs fort, so sieht man, daß aus Bausen
über dem Walterbild und dem Rostbild sich annähernd die zweite fran-
zösische Miniatur konstruieren läßt. Bei der Abbildung auf Tafel 2 ist,
wie aus der Nebenstellung der unveränderten Figuren aus der Manesse-
handschrift zu erkennen, nur der rechte Arm der beiden Figuren in
anderer Stellung durchgezeichnet. Damit ist ja eine unmittelbare Ab-
hängigkeit bewiesen. Wann hat ein französicher Maler — doch späte-
stens des 14. Jahrhunderts — die Manessehandschrift, die sicher bis in
das 17. Jahrhundert hinein in der Schweiz und in Deutschland war, be-
nutzen können? Arge Zweifel steigen in uns auf, wenn wir die Art der
Abhängigkeit bedenken, fast mathematische Übereinstimmung mit Ab-
weichungen nicht größer, als sie durch kleine Verschiebung eines
Blattes beim Bausen entstehen — aber diese Übereinstimmung in ein
ganz anderes Größenverhältnis übertragen. Das ist nur möglich mit dem
Storchschnabel — oder mit dem modernen photographischen Apparat!
Wie sich die Abhängigkeit mittelalterlicher Künstler darbietet, zeigt
ein Vergleich des Walterbildes in der Manessehandschrift und in der
Weingartner-Handschrift! (Vgl. Tafel 4).
Die stilistische Beurteilung der französichen Miniaturen, besonders
die Entscheidung der Frage, ob sie stilistisch als Kopien des 14. Jahr-
hunderts nach der Manessehandschrift denkbar sind, überlasse ich
besseren Kennern der französischen Bilderhandschriften.
• Fragmente nur aus Abbildungen kenne — noch weiter gehen. Ich
glaube oben wahrscheinlich gemacht zu haben, daß die französischen
Miniaturen im Anschluß an das Bild in der Manessehandschrift, unter
Mitbenutzung des Walterbildes, entstanden sind. Für das Bett ist viel-
leicht das dem Rostbilde vorhergehende Bild, fol. 281b (Kraus Nr. 93),
Meister Heinrich Teschler, mitbenutzt worden.
Nun stellt sich bei einem Vergleich, Linie für Linie, zu dem
Stange durch Reduktion des Rostbildes und dessen angeblicher fran-
zösischer Vorlage auf genau gleiche Größe der Figuren12 (das Bild der
Manessehandschrift ist im Original ganz bedeutend größer) bequeme
Handhabe geboten hat, eine merkwürdige Tatsache heraus: eine Bause,
über den Figuren der einen Abbildung gemacht, deckt mit einer ganz
geringen Verschiebung der Stellung die Figuren der anderen Abbildung,
und zwar schreitet diese Verschiebung so von rechts nach links weiter,
wie wohl eine Bause sich allmählich beim Arbeiten, beim Fortschreiten
von einer Figur zur nächsten, etwas in einer Richtung verschiebt; man
sieht, wie die drei Runde in der Fußbank genau bei ihrer Figur
stehen — und wie nur die Verschiebung der Bause jenes falsche Ver-
hältnis der Abstände in dem Fragment bewirkt hat (vgl. Tafel 1 u. 1 a).
Setzt man diese Art des Vergleichs fort, so sieht man, daß aus Bausen
über dem Walterbild und dem Rostbild sich annähernd die zweite fran-
zösische Miniatur konstruieren läßt. Bei der Abbildung auf Tafel 2 ist,
wie aus der Nebenstellung der unveränderten Figuren aus der Manesse-
handschrift zu erkennen, nur der rechte Arm der beiden Figuren in
anderer Stellung durchgezeichnet. Damit ist ja eine unmittelbare Ab-
hängigkeit bewiesen. Wann hat ein französicher Maler — doch späte-
stens des 14. Jahrhunderts — die Manessehandschrift, die sicher bis in
das 17. Jahrhundert hinein in der Schweiz und in Deutschland war, be-
nutzen können? Arge Zweifel steigen in uns auf, wenn wir die Art der
Abhängigkeit bedenken, fast mathematische Übereinstimmung mit Ab-
weichungen nicht größer, als sie durch kleine Verschiebung eines
Blattes beim Bausen entstehen — aber diese Übereinstimmung in ein
ganz anderes Größenverhältnis übertragen. Das ist nur möglich mit dem
Storchschnabel — oder mit dem modernen photographischen Apparat!
Wie sich die Abhängigkeit mittelalterlicher Künstler darbietet, zeigt
ein Vergleich des Walterbildes in der Manessehandschrift und in der
Weingartner-Handschrift! (Vgl. Tafel 4).
Die stilistische Beurteilung der französichen Miniaturen, besonders
die Entscheidung der Frage, ob sie stilistisch als Kopien des 14. Jahr-
hunderts nach der Manessehandschrift denkbar sind, überlasse ich
besseren Kennern der französischen Bilderhandschriften.