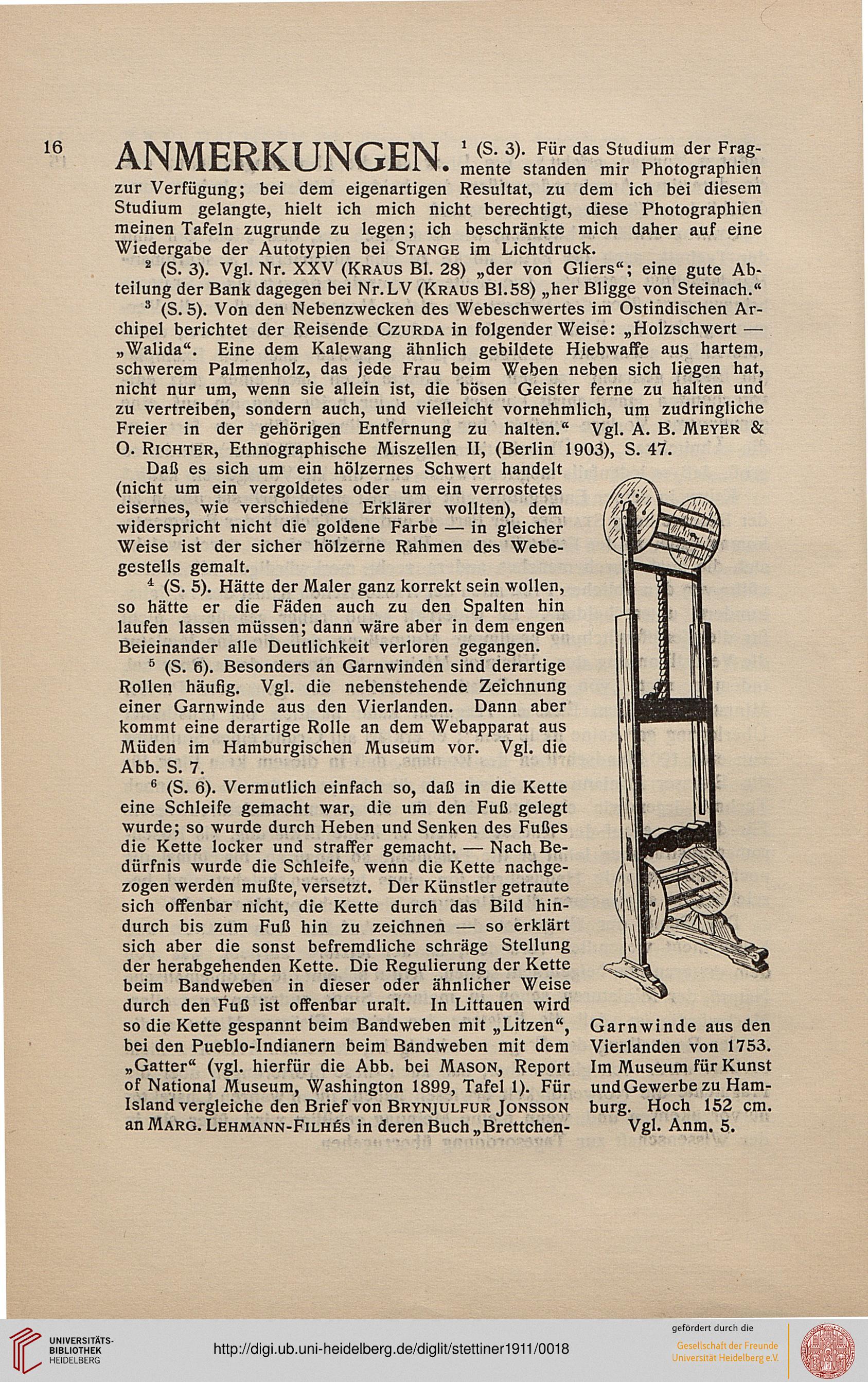16
ANMPRK'I TNf^FN *(S-3)- Für das studium der Fras-
r^.llivil_,iviv^jl^ VJJ-<1 l. mente standen mir Photographien
zur Verfügung; bei dem eigenartigen Resultat, zu dem ich bei diesem
Studium gelangte, hielt ich mich nicht berechtigt, diese Photographien
meinen Tafeln zugrunde zu legen; ich beschränkte mich daher auf eine
Wiedergabe der Autotypien bei Stange im Lichtdruck.
2 (S. 3). Vgl. Nr. XXV (Kraus Bl. 28) „der von Gliers"; eine gute Ab-
teilung der Bank dagegen bei Nr.LV (Kraus B1.58) „her Bligge von Steinach."
3 (S. 5). Von den Nebenzwecken des Webeschwertes im Ostindischen Ar-
chipel berichtet der Reisende Czurda in folgender Weise: „Holzschwert —
„Walida". Eine dem Kalewang ähnlich gebildete Hiebwaffe aus hartem,
schwerem Palmenholz, das jede Frau beim Weben neben sich liegen hat,
nicht nur um, wenn sie allein ist, die bösen Geister ferne zu halten und
zu vertreiben, sondern auch, und vielleicht vornehmlich, um zudringliche
Freier in der gehörigen Entfernung zu halten." Vgl. A. B. Meyer &
O. Richter, Ethnographische Miszellen II, (Berlin 1903), S. 47.
Daß es sich um ein hölzernes Schwert handelt
(nicht um ein vergoldetes oder um ein verrostetes
eisernes, wie verschiedene Erklärer wollten), dem
widerspricht nicht die goldene Farbe — in gleicher
Weise ist der sicher hölzerne Rahmen des Webe-
gestells gemalt.
4 (S. 5). Hätte der Maler ganz korrekt sein wollen,
so hätte er die Fäden auch zu den Spalten hin
laufen lassen müssen; dann wäre aber in dem engen
Beieinander alle Deutlichkeit verloren gegangen.
5 (S. 6). Besonders an Garnwinden sind derartige
Rollen häufig. Vgl. die nebenstehende Zeichnung
einer Garnwinde aus den Vierlanden. Dann aber
kommt eine derartige Rolle an dem Webapparat aus
Müden im Hamburgischen Museum vor. Vgl. die
Abb. S. 7.
6 (S. 6). Vermutlich einfach so, daß in die Kette
eine Schleife gemacht war, die um den Fuß gelegt
wurde; so wurde durch Heben und Senken des Fußes
die Kette locker und straffer gemacht. — Nach Be-
dürfnis wurde die Schleife, wenn die Kette nachge-
zogen werden mußte, versetzt. Der Künstler getraute
sich offenbar nicht, die Kette durch das Bild hin-
durch bis zum Fuß hin zu zeichnen — so erklärt
sich aber die sonst befremdliche schräge Stellung
der herabgehenden Kette. Die Regulierung der Kette
beim Bandweben in dieser oder ähnlicher Weise
durch den Fuß ist offenbar uralt. In Littauen wird
so die Kette gespannt beim Bandweben mit „Litzen", Garnwinde aus den
bei den Pueblo-Indianern beim Bandweben mit dem Vierlanden von 1753.
„Gatter" (vgl. hierfür die Abb. bei Mason, Report Im Museum für Kunst
of National Museum, Washington 1899, Tafel 1). Für und Gewerbe zu Ham-
Island vergleiche den Brief von Brynjulfur Jonsson bürg. Hoch 152 cm.
an Marc Lehmann-Filhes in deren Buch „Brettchen- Vgl. Anm. 5.
ANMPRK'I TNf^FN *(S-3)- Für das studium der Fras-
r^.llivil_,iviv^jl^ VJJ-<1 l. mente standen mir Photographien
zur Verfügung; bei dem eigenartigen Resultat, zu dem ich bei diesem
Studium gelangte, hielt ich mich nicht berechtigt, diese Photographien
meinen Tafeln zugrunde zu legen; ich beschränkte mich daher auf eine
Wiedergabe der Autotypien bei Stange im Lichtdruck.
2 (S. 3). Vgl. Nr. XXV (Kraus Bl. 28) „der von Gliers"; eine gute Ab-
teilung der Bank dagegen bei Nr.LV (Kraus B1.58) „her Bligge von Steinach."
3 (S. 5). Von den Nebenzwecken des Webeschwertes im Ostindischen Ar-
chipel berichtet der Reisende Czurda in folgender Weise: „Holzschwert —
„Walida". Eine dem Kalewang ähnlich gebildete Hiebwaffe aus hartem,
schwerem Palmenholz, das jede Frau beim Weben neben sich liegen hat,
nicht nur um, wenn sie allein ist, die bösen Geister ferne zu halten und
zu vertreiben, sondern auch, und vielleicht vornehmlich, um zudringliche
Freier in der gehörigen Entfernung zu halten." Vgl. A. B. Meyer &
O. Richter, Ethnographische Miszellen II, (Berlin 1903), S. 47.
Daß es sich um ein hölzernes Schwert handelt
(nicht um ein vergoldetes oder um ein verrostetes
eisernes, wie verschiedene Erklärer wollten), dem
widerspricht nicht die goldene Farbe — in gleicher
Weise ist der sicher hölzerne Rahmen des Webe-
gestells gemalt.
4 (S. 5). Hätte der Maler ganz korrekt sein wollen,
so hätte er die Fäden auch zu den Spalten hin
laufen lassen müssen; dann wäre aber in dem engen
Beieinander alle Deutlichkeit verloren gegangen.
5 (S. 6). Besonders an Garnwinden sind derartige
Rollen häufig. Vgl. die nebenstehende Zeichnung
einer Garnwinde aus den Vierlanden. Dann aber
kommt eine derartige Rolle an dem Webapparat aus
Müden im Hamburgischen Museum vor. Vgl. die
Abb. S. 7.
6 (S. 6). Vermutlich einfach so, daß in die Kette
eine Schleife gemacht war, die um den Fuß gelegt
wurde; so wurde durch Heben und Senken des Fußes
die Kette locker und straffer gemacht. — Nach Be-
dürfnis wurde die Schleife, wenn die Kette nachge-
zogen werden mußte, versetzt. Der Künstler getraute
sich offenbar nicht, die Kette durch das Bild hin-
durch bis zum Fuß hin zu zeichnen — so erklärt
sich aber die sonst befremdliche schräge Stellung
der herabgehenden Kette. Die Regulierung der Kette
beim Bandweben in dieser oder ähnlicher Weise
durch den Fuß ist offenbar uralt. In Littauen wird
so die Kette gespannt beim Bandweben mit „Litzen", Garnwinde aus den
bei den Pueblo-Indianern beim Bandweben mit dem Vierlanden von 1753.
„Gatter" (vgl. hierfür die Abb. bei Mason, Report Im Museum für Kunst
of National Museum, Washington 1899, Tafel 1). Für und Gewerbe zu Ham-
Island vergleiche den Brief von Brynjulfur Jonsson bürg. Hoch 152 cm.
an Marc Lehmann-Filhes in deren Buch „Brettchen- Vgl. Anm. 5.