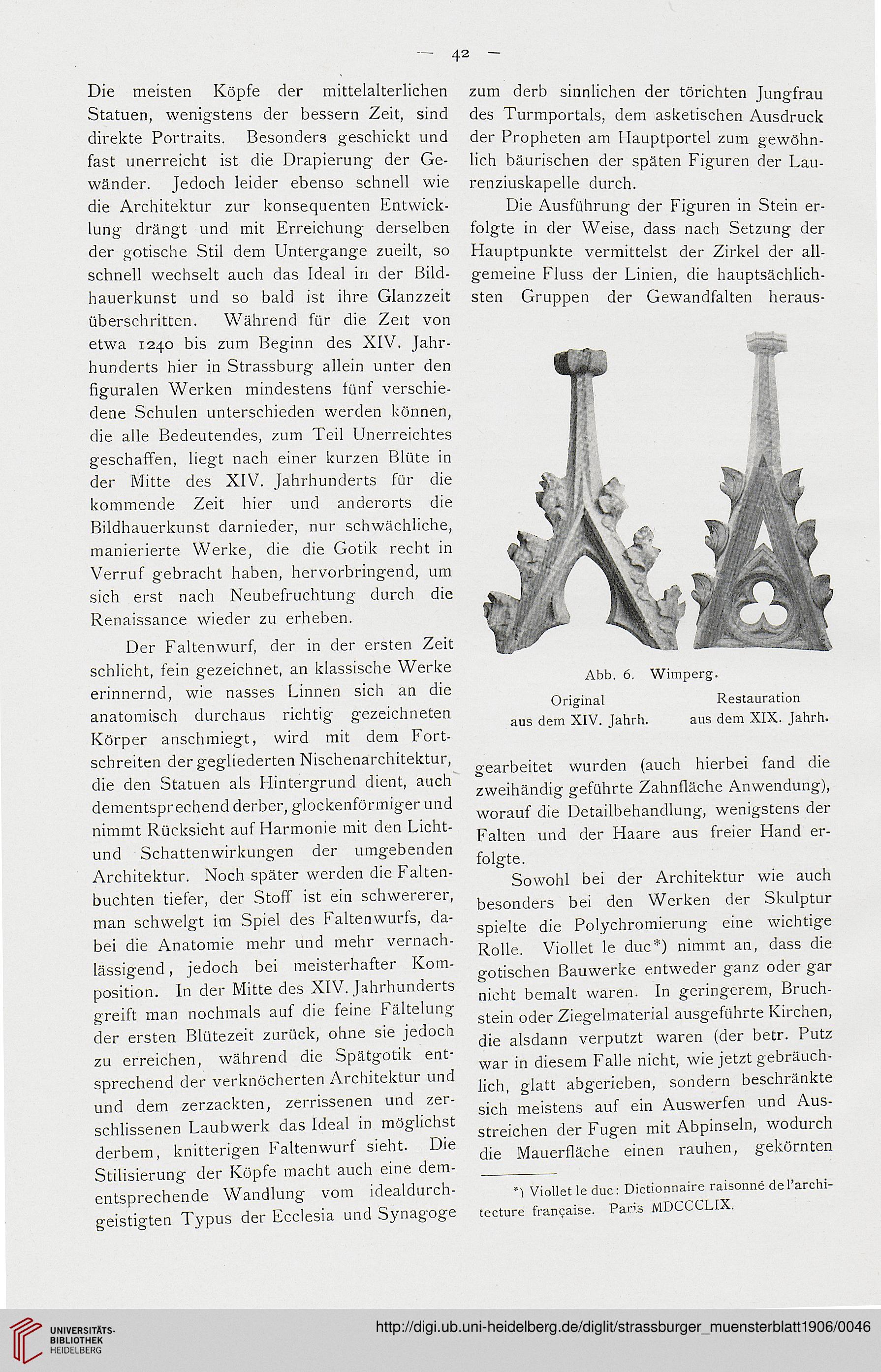42
Die meisten Köpfe der mittelalterlichen
Statuen, wenigstens der bessern Zeit, sind
direkte Portraits. Besonders geschickt und
fast unerreicht ist die Drapierung der Ge-
wänder. Jedoch leider ebenso schnell wie
die Architektur zur konsequenten Entwick-
lung drängt und mit Erreichung derselben
der gotische Stil dem Untergange zueilt, so
schnell wechselt auch das Ideal in der Bild-
hauerkunst und so bald ist ihre Glanzzeit
überschritten. Während für die Zeit von
etwa 1240 bis zum Beginn des XIV. Jahr-
hunderts hier in Strassburg allein unter den
figuralen Werken mindestens fünf verschie-
dene Schulen unterschieden werden können,
die alle Bedeutendes, zum Teil Unerreichtes
geschaffen, liegt nach einer kurzen Blüte in
der Mitte des XIV. Jahrhunderts für die
kommende Zeit hier und anderorts die
Bildhauerkunst darnieder, nur schwächliche,
manierierte Werke, die die Gotik recht in
Verruf gebracht haben, hervorbringend, um
sich erst nach Neubefruchtung durch die
Renaissance wieder zu erheben.
Der Faltenwurf, der in der ersten Zeit
schlicht, fein gezeichnet, an klassische Werke
erinnernd, wie nasses Linnen sich an die
anatomisch durchaus richtig gezeichneten
Körper anschmiegt, wird mit dem Fort-
schreiten der gegliederten Nischenarchitektur,
die den Statuen als Hintergrund dient, auch
dementsprechend derber, glockenförmiger und
nimmt Rücksicht auf Harmonie mit den Licht-
und Schattenwirkungen der umgebenden
Architektur. Noch später werden die Falten-
buchten tiefer, der Stoff ist ein schwererer,
man schwelgt im Spiel des Faltenwurfs, da-
bei die Anatomie mehr und mehr vernach-
lässigend , jedoch bei meisterhafter Kom-
position. In der Mitte des XIV. Jahrhunderts
greift man nochmals auf die feine Fältelung
der ersten Blütezeit zurück, ohne sie jedoch
zu erreichen, während die Spätgotik ent-
sprechend der verknöcherten Architektur und
und dem zerzackten, zerrissenen und zer-
schlissenen Laubwerk das Ideal in möglichst
derbem, knitterigen Faltenwurf sieht. Die
Stilisierung der Köpfe macht auch eine dem-
entsprechende Wandlung vom idealdurch-
geistigten Typus der Ecclesia und Synagoge
zum derb sinnlichen der törichten Jungfrau
des Turmportals, dem asketischen Ausdruck
der Propheten am Hauptportei zum gewöhn-
lich bäurischen der späten Figuren der Lau-
renziuskapelle durch.
Die Ausführung der Figuren in Stein er-
folgte in der Weise, dass nach Setzung der
Hauptpunkte vermittelst der Zirkel der all-
gemeine F luss der Linien, die hauptsächlich-
sten Gruppen der Gewandfalten heraus-
Abb. 6. Wimperg.
Original Restauration
aus dem XIV. Jahrh. aus dem XIX. Jahrh.
gearbeitet wurden (auch hierbei fand die
zweihändig geführte Zahnfläche Anwendung),
worauf die Detailbehandlung, wenigstens der
Falten und der Haare aus freier Hand er-
folgte.
Sowohl bei der Architektur wie auch
besonders bei den Werken der Skulptur
spielte die Polychromierung eine wichtige
Rolle. Viollet le duc*) nimmt an, dass die
gotischen Bauwerke entweder ganz oder gar
nicht bemalt waren. In geringerem, Bruch-
stein oder Ziegelmaterial ausgeführte Kirchen,
die alsdann verputzt waren (der betr. Putz
war in diesem Falle nicht, wie jetzt gebräuch-
lich, glatt abgerieben, sondern beschränkte
sich meistens auf ein Auswerfen und Aus-
streichen der Fugen mit Abpinseln, wodurch
die Mauerfläche einen rauhen, gekörnten
*) Viollet le duc: Dictionnaire raisonne del’archi-
tecture frangaise. Paris MDCCCLIX.
Die meisten Köpfe der mittelalterlichen
Statuen, wenigstens der bessern Zeit, sind
direkte Portraits. Besonders geschickt und
fast unerreicht ist die Drapierung der Ge-
wänder. Jedoch leider ebenso schnell wie
die Architektur zur konsequenten Entwick-
lung drängt und mit Erreichung derselben
der gotische Stil dem Untergange zueilt, so
schnell wechselt auch das Ideal in der Bild-
hauerkunst und so bald ist ihre Glanzzeit
überschritten. Während für die Zeit von
etwa 1240 bis zum Beginn des XIV. Jahr-
hunderts hier in Strassburg allein unter den
figuralen Werken mindestens fünf verschie-
dene Schulen unterschieden werden können,
die alle Bedeutendes, zum Teil Unerreichtes
geschaffen, liegt nach einer kurzen Blüte in
der Mitte des XIV. Jahrhunderts für die
kommende Zeit hier und anderorts die
Bildhauerkunst darnieder, nur schwächliche,
manierierte Werke, die die Gotik recht in
Verruf gebracht haben, hervorbringend, um
sich erst nach Neubefruchtung durch die
Renaissance wieder zu erheben.
Der Faltenwurf, der in der ersten Zeit
schlicht, fein gezeichnet, an klassische Werke
erinnernd, wie nasses Linnen sich an die
anatomisch durchaus richtig gezeichneten
Körper anschmiegt, wird mit dem Fort-
schreiten der gegliederten Nischenarchitektur,
die den Statuen als Hintergrund dient, auch
dementsprechend derber, glockenförmiger und
nimmt Rücksicht auf Harmonie mit den Licht-
und Schattenwirkungen der umgebenden
Architektur. Noch später werden die Falten-
buchten tiefer, der Stoff ist ein schwererer,
man schwelgt im Spiel des Faltenwurfs, da-
bei die Anatomie mehr und mehr vernach-
lässigend , jedoch bei meisterhafter Kom-
position. In der Mitte des XIV. Jahrhunderts
greift man nochmals auf die feine Fältelung
der ersten Blütezeit zurück, ohne sie jedoch
zu erreichen, während die Spätgotik ent-
sprechend der verknöcherten Architektur und
und dem zerzackten, zerrissenen und zer-
schlissenen Laubwerk das Ideal in möglichst
derbem, knitterigen Faltenwurf sieht. Die
Stilisierung der Köpfe macht auch eine dem-
entsprechende Wandlung vom idealdurch-
geistigten Typus der Ecclesia und Synagoge
zum derb sinnlichen der törichten Jungfrau
des Turmportals, dem asketischen Ausdruck
der Propheten am Hauptportei zum gewöhn-
lich bäurischen der späten Figuren der Lau-
renziuskapelle durch.
Die Ausführung der Figuren in Stein er-
folgte in der Weise, dass nach Setzung der
Hauptpunkte vermittelst der Zirkel der all-
gemeine F luss der Linien, die hauptsächlich-
sten Gruppen der Gewandfalten heraus-
Abb. 6. Wimperg.
Original Restauration
aus dem XIV. Jahrh. aus dem XIX. Jahrh.
gearbeitet wurden (auch hierbei fand die
zweihändig geführte Zahnfläche Anwendung),
worauf die Detailbehandlung, wenigstens der
Falten und der Haare aus freier Hand er-
folgte.
Sowohl bei der Architektur wie auch
besonders bei den Werken der Skulptur
spielte die Polychromierung eine wichtige
Rolle. Viollet le duc*) nimmt an, dass die
gotischen Bauwerke entweder ganz oder gar
nicht bemalt waren. In geringerem, Bruch-
stein oder Ziegelmaterial ausgeführte Kirchen,
die alsdann verputzt waren (der betr. Putz
war in diesem Falle nicht, wie jetzt gebräuch-
lich, glatt abgerieben, sondern beschränkte
sich meistens auf ein Auswerfen und Aus-
streichen der Fugen mit Abpinseln, wodurch
die Mauerfläche einen rauhen, gekörnten
*) Viollet le duc: Dictionnaire raisonne del’archi-
tecture frangaise. Paris MDCCCLIX.