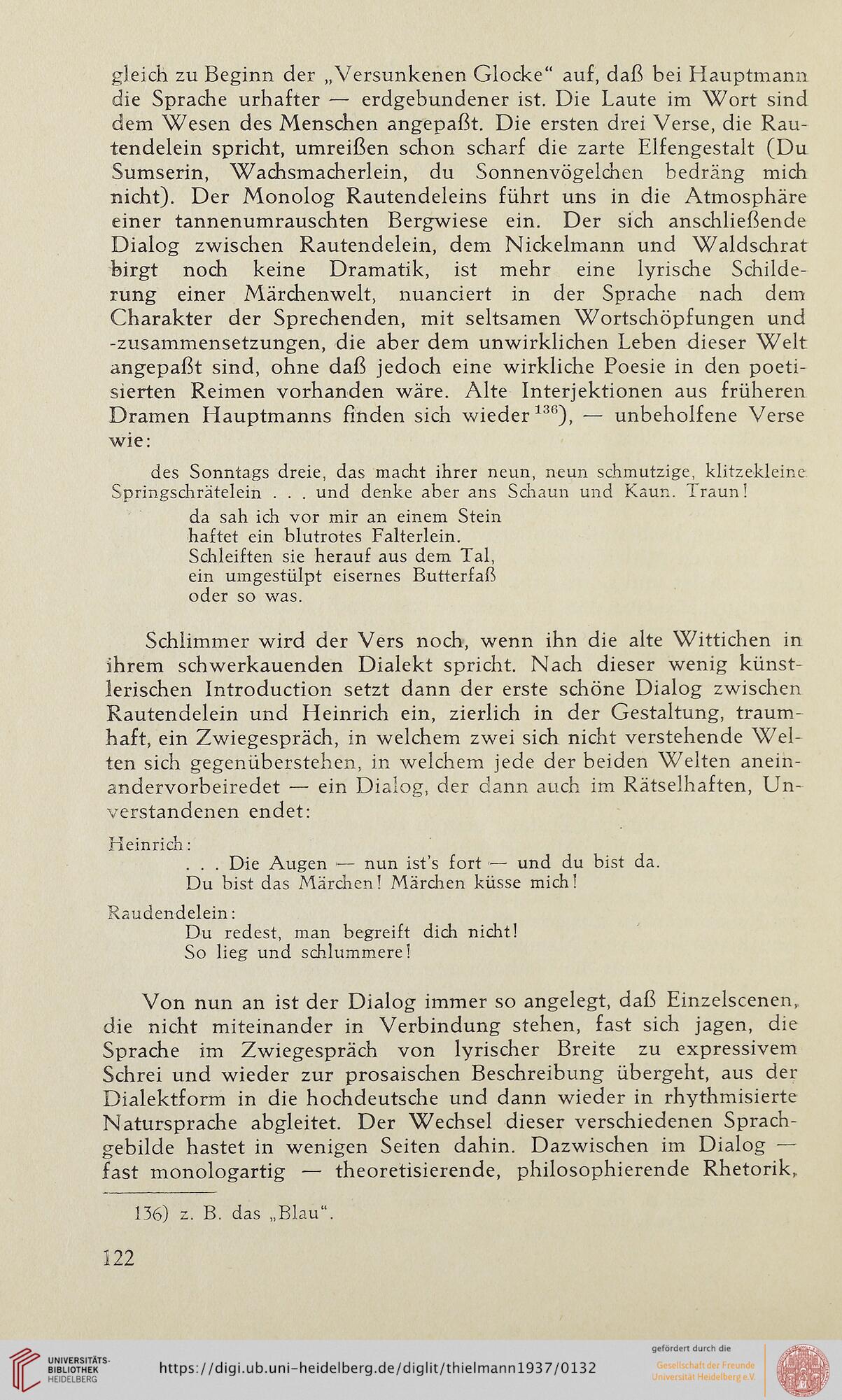gleich zu Beginn der „Versunkenen Glocke“ auf, daß bei Hauptmann
die Sprache urhafter — erdgebundener ist. Die Laute im Wort sind
dem Wesen des Menschen angepaßt. Die ersten drei Verse, die Rau-
tendelein spricht, umreißen schon scharf die zarte Elfengestalt (Du
Sumserin, Wachsmacherlein, du Sonnenvögelchen bedräng mich
nicht). Der Monolog Rautendeleins führt uns in die Atmosphäre
einer tannenumrauschten Bergwiese ein. Der sich anschließende
Dialog zwischen Rautendelein, dem Nickelmann und Waldschrat
birgt noch keine Dramatik, ist mehr eine lyrische Schilde-
rung einer Märchenwelt, nuanciert in der Sprache nach dem
Charakter der Sprechenden, mit seltsamen Wortschöpfungen und
-Zusammensetzungen, die aber dem unwirklichen Leben dieser Welt
angepaßt sind, ohne daß jedoch eine wirkliche Poesie in den poeti-
sierten Reimen vorhanden wäre. Alte Interjektionen aus früheren
Dramen Hauptmanns finden sich wieder136), — unbeholfene Verse
wie:
des Sonntags dreie, das macht ihrer neun, neun schmutzige, klitzekleine
Springschrätelein . . . und denke aber ans Schaun und Kaum Traun!
da sah ich vor mir an einem Stein
haftet ein blutrotes Falterlein.
Schleiften sie herauf aus dem Tal,
ein umgestülpt eisernes Butterfaß
oder so was.
Schlimmer wird der Vers noch, wenn ihn die alte Wittichen in
ihrem schwerkauenden Dialekt spricht. Nach dieser wenig künst-
lerischen Introduction setzt dann der erste schöne Dialog zwischen
Rautendelein und Heinrich ein, zierlich in der Gestaltung, traum-
haft, ein Zwiegespräch, in welchem zwei sich nicht verstehende Wel-
ten sich gegenüberstehen, in welchem jede der beiden Welten anein-
andervorbeiredet — ein Dialog, der dann auch im Rätselhaften, Un-
verstandenen endet:
Heinrich:
. . . Die Augen >— nun ist’s fort ■— und du bist da.
Du bist das Märchen! Märchen küsse mich'
Raudendelein:
Du redest, man begreift dich nicht!
So lieg und schlummere!
Von nun an ist der Dialog immer so angelegt, daß Einzelscenen,
die nicht miteinander in Verbindung stehen, fast sich jagen, die
Sprache im Zwiegespräch von lyrischer Breite zu expressivem
Schrei und wieder zur prosaischen Beschreibung übergeht, aus der
Dialektform in die hochdeutsche und dann wieder in rhythmisierte
Natursprache abgleitet. Der Wechsel dieser verschiedenen Sprach-
gebilde hastet in wenigen Seiten dahin. Dazwischen im Dialog —
fast monologartig — theoretisierende, philosophierende Rhetorik,
136) z. B. das „Blau“.
122
die Sprache urhafter — erdgebundener ist. Die Laute im Wort sind
dem Wesen des Menschen angepaßt. Die ersten drei Verse, die Rau-
tendelein spricht, umreißen schon scharf die zarte Elfengestalt (Du
Sumserin, Wachsmacherlein, du Sonnenvögelchen bedräng mich
nicht). Der Monolog Rautendeleins führt uns in die Atmosphäre
einer tannenumrauschten Bergwiese ein. Der sich anschließende
Dialog zwischen Rautendelein, dem Nickelmann und Waldschrat
birgt noch keine Dramatik, ist mehr eine lyrische Schilde-
rung einer Märchenwelt, nuanciert in der Sprache nach dem
Charakter der Sprechenden, mit seltsamen Wortschöpfungen und
-Zusammensetzungen, die aber dem unwirklichen Leben dieser Welt
angepaßt sind, ohne daß jedoch eine wirkliche Poesie in den poeti-
sierten Reimen vorhanden wäre. Alte Interjektionen aus früheren
Dramen Hauptmanns finden sich wieder136), — unbeholfene Verse
wie:
des Sonntags dreie, das macht ihrer neun, neun schmutzige, klitzekleine
Springschrätelein . . . und denke aber ans Schaun und Kaum Traun!
da sah ich vor mir an einem Stein
haftet ein blutrotes Falterlein.
Schleiften sie herauf aus dem Tal,
ein umgestülpt eisernes Butterfaß
oder so was.
Schlimmer wird der Vers noch, wenn ihn die alte Wittichen in
ihrem schwerkauenden Dialekt spricht. Nach dieser wenig künst-
lerischen Introduction setzt dann der erste schöne Dialog zwischen
Rautendelein und Heinrich ein, zierlich in der Gestaltung, traum-
haft, ein Zwiegespräch, in welchem zwei sich nicht verstehende Wel-
ten sich gegenüberstehen, in welchem jede der beiden Welten anein-
andervorbeiredet — ein Dialog, der dann auch im Rätselhaften, Un-
verstandenen endet:
Heinrich:
. . . Die Augen >— nun ist’s fort ■— und du bist da.
Du bist das Märchen! Märchen küsse mich'
Raudendelein:
Du redest, man begreift dich nicht!
So lieg und schlummere!
Von nun an ist der Dialog immer so angelegt, daß Einzelscenen,
die nicht miteinander in Verbindung stehen, fast sich jagen, die
Sprache im Zwiegespräch von lyrischer Breite zu expressivem
Schrei und wieder zur prosaischen Beschreibung übergeht, aus der
Dialektform in die hochdeutsche und dann wieder in rhythmisierte
Natursprache abgleitet. Der Wechsel dieser verschiedenen Sprach-
gebilde hastet in wenigen Seiten dahin. Dazwischen im Dialog —
fast monologartig — theoretisierende, philosophierende Rhetorik,
136) z. B. das „Blau“.
122