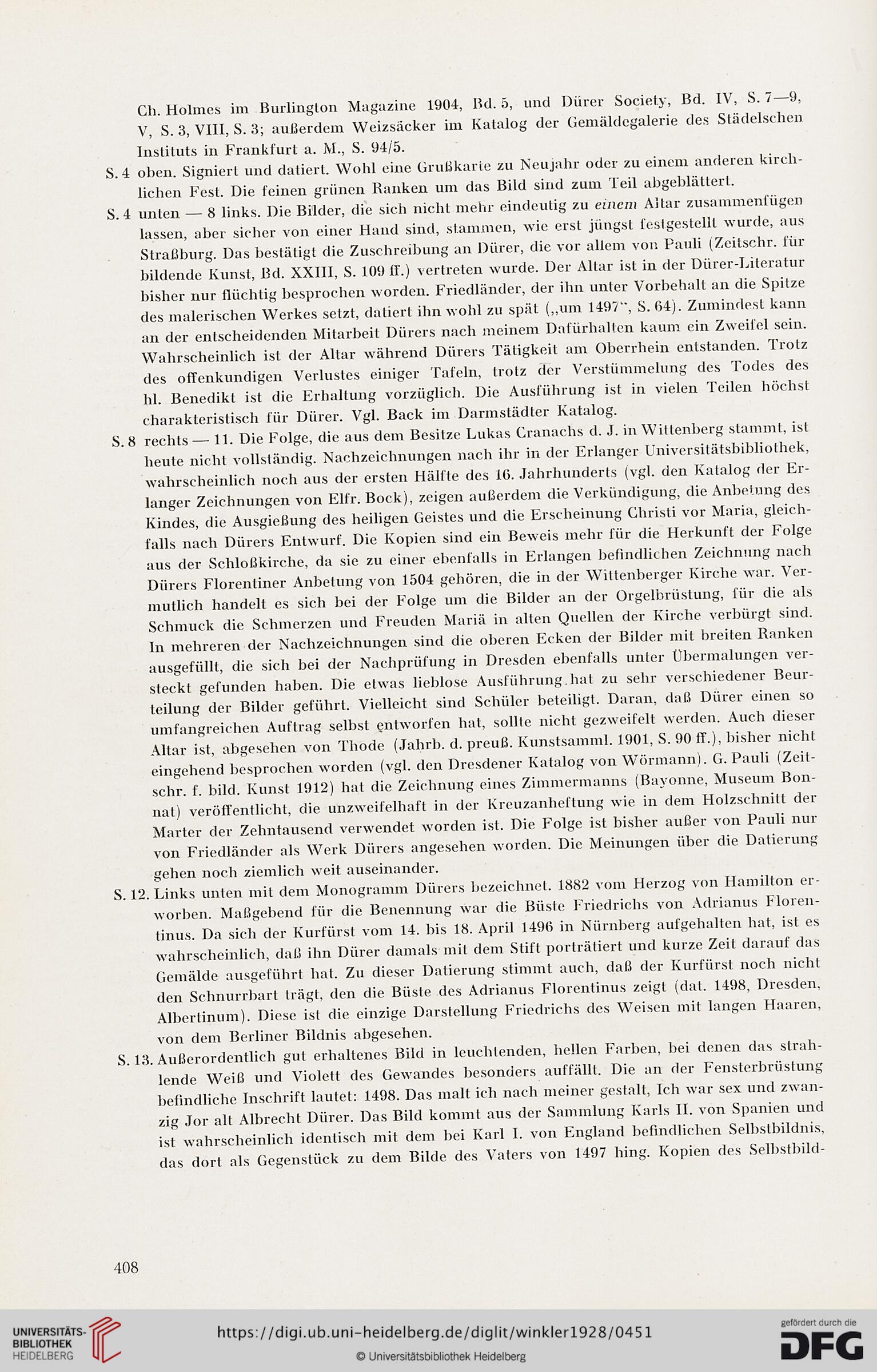Ch. Holmes im Burlington Magazine 1904, Bd. 5, und Dürer Society, Bd. IV, S. 7—9,
V, S. 3, VIII, S. 3; außerdem Weizsäcker im Katalog der Gemäldegalerie des Städelschen
Instituts in Frankfurt a. M., S. 94/5.
S. 4 oben. Signiert und datiert. Wohl eine Grußkarte zu Neujahr oder zu einem anderen kirch-
lichen Fest. Die feinen grünen Ranken um das Bild sind zum Teil abgeblättert.
S. 4 unten — 8 links. Die Bilder, die sich nicht mehr eindeutig zu einem Altar zusammenfügen
lassen, aber sicher von einer Hand sind, stammen, wie erst jüngst festgestellt wurde, aus
Straßburg. Das bestätigt die Zuschreibung an Dürer, die vor allem von Pauli (Zeitschr. für
bildende Kunst, Bd. XXIII, S. 109 ff.) vertreten wurde. Der Altar ist in der Dürer-Literatur
bisher nur flüchtig besprochen worden. Friedländer, der ihn unter Vorbehalt an die Spitze
des malerischen Werkes setzt, datiert ihn wohl zu spät („um 1497", S. 64). Zumindest kann
an der entscheidenden Mitarbeit Dürers nach meinem Dafürhalten kaum ein Zweifel sein.
Wahrscheinlich ist der Altar während Dürers Tätigkeit am Oberrhein entstanden. Trotz
des offenkundigen Verlustes einiger Tafeln, trotz der Verstümmelung des Todes des
hl. Benedikt ist die Erhaltung vorzüglich. Die Ausführung ist in vielen Teilen höchst
charakteristisch für Dürer. Vgl. Back im Darmstädter Katalog.
S. 8 rechts — 11. Die Folge, die aus dem Besitze Lukas Cranachs d. J. in Wittenberg stammt, ist
heute nicht vollständig. Nachzeichnungen nach ihr in der Erlanger Universitätsbibliothek,
wahrscheinlich noch aus der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts (vgl. den Katalog der Er-
langer Zeichnungen von Elfr. Bock), zeigen außerdem die Verkündigung, die Anbetung des
Kindes, die Ausgießung des heiligen Geistes und die Erscheinung Christi vor Maria, gleich-
falls nach Dürers Entwurf. Die Kopien sind ein Beweis mehr für die Herkunft der Folge
aus der Schloßkirche, da sie zu einer ebenfalls in Erlangen befindlichen Zeichnung nach
Dürers Florentiner Anbetung von 1504 gehören, die in der Wittenberger Kirche war. Ver-
mutlich handelt es sich bei der Folge um die Bilder an der Orgelbrüstung, für die als
Schmuck die Schmerzen und Freuden Mariä in allen Quellen der Kirche verbürgt sind.
In mehreren der Nachzeichnungen sind die oberen Ecken der Bilder mit breiten Ranken
ausgefüllt, die sich bei der Nachprüfung in Dresden ebenfalls unter Übermalungen ver-
steckt gefunden haben. Die etwas lieblose Ausführung, hat zu sehr verschiedener Beur-
teilung der Bilder geführt. Vielleicht sind Schüler beteiligt. Daran, daß Dürer einen so
umfangreichen Auftrag selbst entworfen hat, sollte nicht gezweifelt werden. Auch dieser
Altar ist, abgesehen von Thode (Jahrb. d. preuß. Kunstsamml. 1901, S. 90 ff.), bisher nicht
eingehend besprochen worden (vgl. den Dresdener Katalog von Wörmann). G. Pauli (Zeit-
schr. f. bild. Kunst 1912) hat die Zeichnung eines Zimmermanns (Bayonne, Museum Bon-
nat) veröffentlicht, die unzweifelhaft in der Kreuzanheftung wie in dem Holzschnitt der
Marter der Zehntausend verwendet worden ist. Die Folge ist bisher außer von Pauli nur
von Friedländer als Werk Dürers angesehen worden. Die Meinungen über die Datierung
gehen noch ziemlich weit auseinander.
S. 12. Links unten mit dem Monogramm Dürers bezeichnet. 1882 vom Herzog von Hamilton er-
worben. Maßgebend für die Benennung war die Büste Friedrichs von Adrianus Floren-
tinus. Da sich der Kurfürst vom 14. bis 18. April 1496 in Nürnberg aufgehalten hat, ist es
wahrscheinlich, daß ihn Dürer damals mit dem Stift porträtiert und kurze Zeit darauf das
Gemälde ausgeführt hat. Zu dieser Datierung stimmt auch, daß der Kurfürst noch nicht
den Schnurrbart trägt, den die Büste des Adrianus Florentinus zeigt (dal. 1498, Dresden,
Albertinum). Diese ist die einzige Darstellung Friedrichs des Weisen mit langen Haaren,
von dem Berliner Bildnis abgesehen.
S. 13. Außerordentlich gut erhaltenes Bild in leuchtenden, hellen Farben, bei denen das strah-
lende Weiß und Violett des Gewandes besonders auffällt. Die an der Fensterbrüstung
befindliche Inschrift lautet: 1498. Das malt ich nach meiner gestalt, Ich war sex und zwan-
zig Jor alt Albrecht Dürer. Das Bild kommt aus der Sammlung Karls II. von Spanien und
ist wahrscheinlich identisch mit dem bei Karl I. von England befindlichen Selbstbildnis,
das dort als Gegenstück zu dem Bilde des Vaters von 1497 hing. Kopien des Selbstbild-
408
V, S. 3, VIII, S. 3; außerdem Weizsäcker im Katalog der Gemäldegalerie des Städelschen
Instituts in Frankfurt a. M., S. 94/5.
S. 4 oben. Signiert und datiert. Wohl eine Grußkarte zu Neujahr oder zu einem anderen kirch-
lichen Fest. Die feinen grünen Ranken um das Bild sind zum Teil abgeblättert.
S. 4 unten — 8 links. Die Bilder, die sich nicht mehr eindeutig zu einem Altar zusammenfügen
lassen, aber sicher von einer Hand sind, stammen, wie erst jüngst festgestellt wurde, aus
Straßburg. Das bestätigt die Zuschreibung an Dürer, die vor allem von Pauli (Zeitschr. für
bildende Kunst, Bd. XXIII, S. 109 ff.) vertreten wurde. Der Altar ist in der Dürer-Literatur
bisher nur flüchtig besprochen worden. Friedländer, der ihn unter Vorbehalt an die Spitze
des malerischen Werkes setzt, datiert ihn wohl zu spät („um 1497", S. 64). Zumindest kann
an der entscheidenden Mitarbeit Dürers nach meinem Dafürhalten kaum ein Zweifel sein.
Wahrscheinlich ist der Altar während Dürers Tätigkeit am Oberrhein entstanden. Trotz
des offenkundigen Verlustes einiger Tafeln, trotz der Verstümmelung des Todes des
hl. Benedikt ist die Erhaltung vorzüglich. Die Ausführung ist in vielen Teilen höchst
charakteristisch für Dürer. Vgl. Back im Darmstädter Katalog.
S. 8 rechts — 11. Die Folge, die aus dem Besitze Lukas Cranachs d. J. in Wittenberg stammt, ist
heute nicht vollständig. Nachzeichnungen nach ihr in der Erlanger Universitätsbibliothek,
wahrscheinlich noch aus der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts (vgl. den Katalog der Er-
langer Zeichnungen von Elfr. Bock), zeigen außerdem die Verkündigung, die Anbetung des
Kindes, die Ausgießung des heiligen Geistes und die Erscheinung Christi vor Maria, gleich-
falls nach Dürers Entwurf. Die Kopien sind ein Beweis mehr für die Herkunft der Folge
aus der Schloßkirche, da sie zu einer ebenfalls in Erlangen befindlichen Zeichnung nach
Dürers Florentiner Anbetung von 1504 gehören, die in der Wittenberger Kirche war. Ver-
mutlich handelt es sich bei der Folge um die Bilder an der Orgelbrüstung, für die als
Schmuck die Schmerzen und Freuden Mariä in allen Quellen der Kirche verbürgt sind.
In mehreren der Nachzeichnungen sind die oberen Ecken der Bilder mit breiten Ranken
ausgefüllt, die sich bei der Nachprüfung in Dresden ebenfalls unter Übermalungen ver-
steckt gefunden haben. Die etwas lieblose Ausführung, hat zu sehr verschiedener Beur-
teilung der Bilder geführt. Vielleicht sind Schüler beteiligt. Daran, daß Dürer einen so
umfangreichen Auftrag selbst entworfen hat, sollte nicht gezweifelt werden. Auch dieser
Altar ist, abgesehen von Thode (Jahrb. d. preuß. Kunstsamml. 1901, S. 90 ff.), bisher nicht
eingehend besprochen worden (vgl. den Dresdener Katalog von Wörmann). G. Pauli (Zeit-
schr. f. bild. Kunst 1912) hat die Zeichnung eines Zimmermanns (Bayonne, Museum Bon-
nat) veröffentlicht, die unzweifelhaft in der Kreuzanheftung wie in dem Holzschnitt der
Marter der Zehntausend verwendet worden ist. Die Folge ist bisher außer von Pauli nur
von Friedländer als Werk Dürers angesehen worden. Die Meinungen über die Datierung
gehen noch ziemlich weit auseinander.
S. 12. Links unten mit dem Monogramm Dürers bezeichnet. 1882 vom Herzog von Hamilton er-
worben. Maßgebend für die Benennung war die Büste Friedrichs von Adrianus Floren-
tinus. Da sich der Kurfürst vom 14. bis 18. April 1496 in Nürnberg aufgehalten hat, ist es
wahrscheinlich, daß ihn Dürer damals mit dem Stift porträtiert und kurze Zeit darauf das
Gemälde ausgeführt hat. Zu dieser Datierung stimmt auch, daß der Kurfürst noch nicht
den Schnurrbart trägt, den die Büste des Adrianus Florentinus zeigt (dal. 1498, Dresden,
Albertinum). Diese ist die einzige Darstellung Friedrichs des Weisen mit langen Haaren,
von dem Berliner Bildnis abgesehen.
S. 13. Außerordentlich gut erhaltenes Bild in leuchtenden, hellen Farben, bei denen das strah-
lende Weiß und Violett des Gewandes besonders auffällt. Die an der Fensterbrüstung
befindliche Inschrift lautet: 1498. Das malt ich nach meiner gestalt, Ich war sex und zwan-
zig Jor alt Albrecht Dürer. Das Bild kommt aus der Sammlung Karls II. von Spanien und
ist wahrscheinlich identisch mit dem bei Karl I. von England befindlichen Selbstbildnis,
das dort als Gegenstück zu dem Bilde des Vaters von 1497 hing. Kopien des Selbstbild-
408