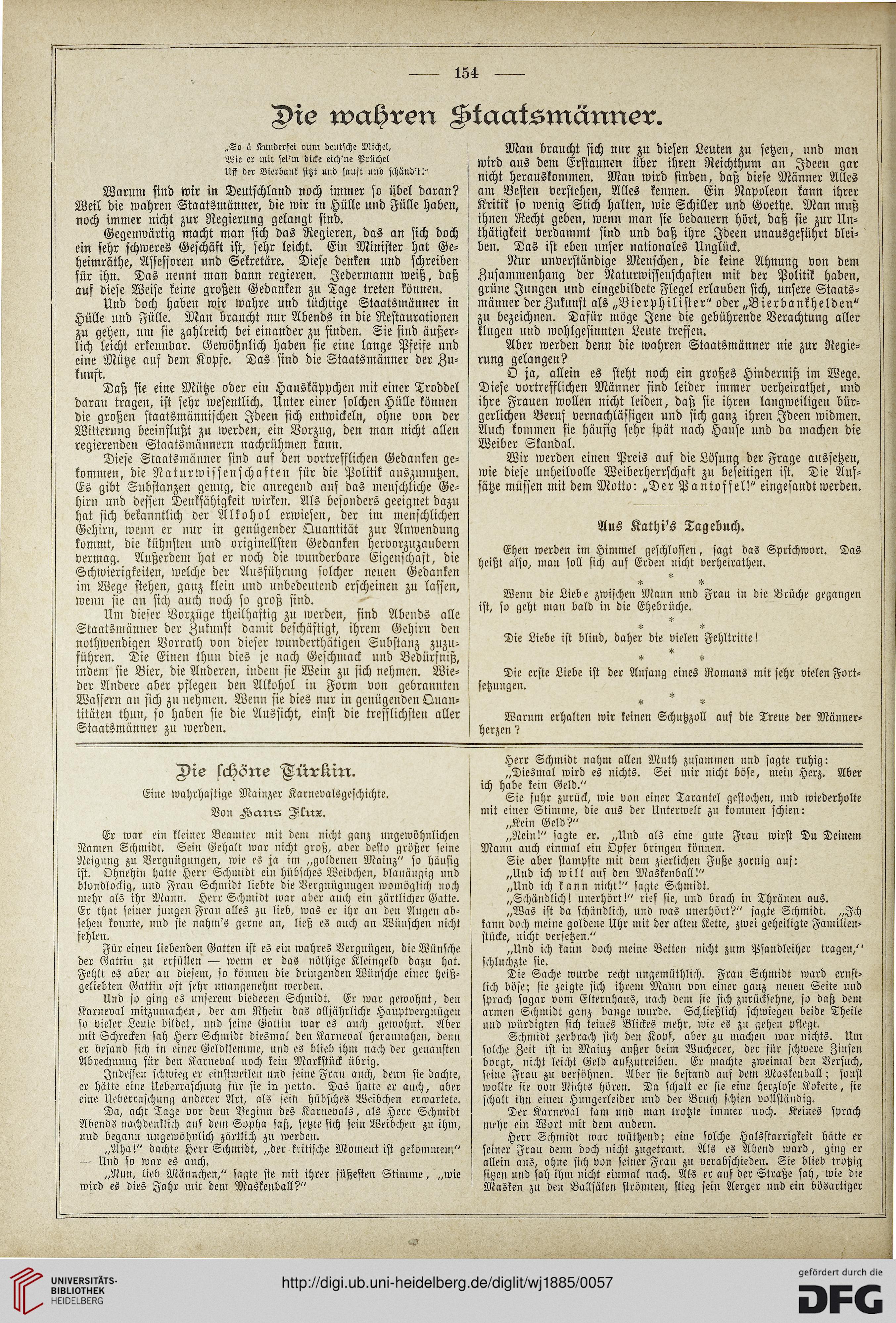154
Die wahren
„So ä Kuuderfei Sunt deutsche Michel,
Wie er mit sei'm dicke eich'ne Prüchcl
Uff der Bierbaut sitzt und saust und schäud'tt"
Warum sind wir in Deutschland noch immer so übel daran?
Weil die wahren Staatsmänner, die wir in Hülle und Fülle haben,
noch immer nicht zur Regierung gelangt sind.
Gegenwärtig macht man sich das Regieren, das an sich doch
ein sehr schweres Geschäft ist, sehr leicht. Ein Minister hat Ge-
heimräthe, Assessoren und Sekretäre. Diese denken und schreiben
für ihn. Das nennt man dann regieren. Jedermann weiß, daß
auf diese Weise keine großen Gedanken zu Tage treten können.
Und doch haben wir wahre und tüchtige Staatsmänner in
Hülle und Fülle. Man braucht nur Abends in die Restaurationen
zu gehen, um sie zahlreich bei einander zu finden. Sie sind äußer-
lich leicht erkennbar. Gewöhnlich haben sie eine lange Pfeife und
eine Mütze auf dem Kopfe. Das sind die Staatsmänner der Zu-
kunft.
Daß sie eine Mütze oder ein Hauskäppchen mit einer Troddel
daran tragen, ist sehr wesentlich. Unter einer solchen Hülle können
die großen staatsmännischen Ideen sich entwickeln, ohne von der
Witterung beeinflußt zu werden, ein Vorzug, den man nicht allen
regierenden Staatsmännern nachrühmen kann.
Diese Staatsmänner sind auf den vortrefflichen Gedanken ge-
kommen, die Naturwissenschaften für die Politik auszunutzen.
Es gibt Substanzen genug, die anregend auf das menschliche Ge-
hirn und dessen Denkfähigkeit wirken. Als besonders geeignet dazu
hat sich bekanntlich der Alkohol erwiesen, der im menschlichen
Gehirn, wenn er nur in genügender Quantität zur Anwendung
kommt, die kühnsten und originellsten Gedanken hervorzuzaubern
vermag. Außerdem hat er noch die wunderbare Eigenschaft, die
Schwierigkeiten, welche der Ausführung solcher neuen Gedanken
im Wege stehen, ganz klein und unbedeutend erscheinen zu lassen,
wenn sie an sich auch noch so groß sind.
Um dieser Vorzüge theilhaftig zu werden, sind Abends alle
Staatsmänner der Zukunft damit beschäftigt, ihrem Gehirn den
nothwendigen Vorrath von dieser wunderthätigen Substanz zuzu-
führen. Die Einen thun dies je nach Geschmack und Bedürfniß,
indem sie Bier, die Anderen, indem sie Wein zu sich nehmen. Wie-
der Andere aber pflegen den Alkohol in Form von gebrannten
Wassern an sich zu nehmen. Wenn sie dies nur in genügenden Quan-
titäten thun, so haben sie die Aussicht, einst die trefflichsten aller
Staatsmänner zu werden.
Staatsmänner.
Man braucht sich nur zu diesen Leuten zu setzen, und man
wird aus dem Erstaunen über ihren Reichthum an Ideen gar
nicht herauskommen. Man wird finden, daß diese Männer Alles
am Besten verstehen, Alles kennen. Ein Napoleon kann ihrer
Kritik so wenig Stich halten, wie Schiller und Goethe. Man muß
ihnen Recht geben, wenn man sie bedauern hört, daß sie zur Un-
thätigkeit verdammt sind und daß ihre Ideen unausgeführt blei-
ben. Das ist eben unser nationales Unglück.
Nur unverständige Menschen, die keine Ahnung von dem
Zusammenhang der Naturwissenschaften mit der Politik haben,
grüne Jungen und eingebildete Flegel erlauben sich, unsere Staats-
männer der Zukunft als „Bierphilister" oder „Bierbankhelden"
zu bezeichnen. Dafür möge Jene die gebührende Verachtung aller
klugen und wohlgesinnten Leute treffen.
Aber werden denn die wahren Staatsmänner nie zur Regie-
rung gelangen?
O ja, allein es steht noch ein großes Hinderniß im Wege.
Diese vortrefflichen Männer sind leider immer verheirathet, und
ihre Frauen wollen nicht leiden, daß sie ihren langweiligen bür-
gerlichen Beruf vernachlässigen und sich ganz ihren Ideen widmen.
Auch kommen sie häufig sehr spät nach Hause und da machen die
Weiber Skandal.
Wir werden einen Preis auf die Lösung der Frage aussetzen,
wie diese unheilvolle Weiberherrschaft zu beseitigen ist. Die Auf-
sätze müssen mit dem Motto: „Der Pantoffel!" eingesandtwerden.
Aus Kathi's Tagebuch.
Ehen werden im Himmel geschlossen, sagt das Sprichwort. Das
heißt also, man soll sich auf Erden nicht verheirathen.
*
* *
Wenn die Liebe zwischen Mann und Frau in die Brüche gegangen
ist, so geht man bald in die Ehebrüche.
*
rjr *
Die Liebe ist blind, daher die vielen Fehltritte!
*
* *
Die erste Liebe ist der Anfang eines Romans mit sehr vielen Fort-
setzungen.
*
* *
Warum erhalten wir keinen Schutzzoll auf die Treue der Männer-
herzen ?
Are schöne Türkin.
Eine wahrhaftige Mainzer Karnevalsgeschichte.
Von Kans Ilux.
Er war ein kleiner Beamter mit dem nicht ganz ungewöhnlichen
Namen Schmidt. Sein Gehalt war nicht groß, aber desto größer seine
Neigung zu Vergnügungen, wie es ja im „goldenen Mainz" so häufig
ist. Ohnehin hatte Herr Schmidt ein hübsches Weibchen, blauäugig und
blondlockig, und Frau Schmidt liebte die Vergnügungen womöglich noch
mehr als ihr Mann. Herr Schmidt war aber auch ein zärtlicher Gatte.
Er that seiner jungen Frau alles zu lieb, was er ihr an den Augen ab-
sehen konnte, und sie nahin's gerne an, ließ es auch an Wünschen nicht
fehlen.
Für einen liebenden Gatten ist es ein wahres Vergnügen, die Wünsche
der Gattin zu erfüllen — wenn er das nöthige Kleingeld dazu hat.
Fehlt es aber an diesem, so können die dringenden Wunsche einer heiß-
geliebten Gattin oft sehr unangenehm werden.
Und so ging es unserem biederen Schmidt. Ec war gewohnt, den
Karneval mitzumachen, der am Rhein das alljährliche Hauptvergnügen
so vieler Leute bildet, und seine Gattin war es auch gewohnt. Aber
mit Schrecken sah Herr Schmidt diesmal den Karneval herannahen, denn
er befand sich in einer Geldklemme, und es blieb ihm nach der genausten
Abrechnung für den Karneval noch kein Markstück übrig.
Indessen schwieg er einstweilen und seine Frau auch, denn sie dachte,
er hätte eine Ueberraschung für sie in petto. Das hatte er auch, aber
eine Ueberraschung anderer Art, als sein hübsches Weibchen erwartete.
Da, acht Tage vor dem Beginn des Karnevals, als Herr Schmidt
Abends nachdenklich ans dem Sopha saß, setzte sich sein Weibchen zu ihm,
und begann ungewöhnlich zärtlich zu werden.
„Aha!" dachte Herr Schmidt, „der kritische Moment ist gekonimem"
— Und so war es auch.
„Nun, lieb Männchen," sagte sie mit ihrer süßesten Stimme, „wie
wird es dies Jahr mit dem Maskenball?"
Herr Schmidt nahm allen Muth zusammen und sagte ruhig:
„Diesmal wird es nichts. Sei mir nicht böse, mein Herz. Aber
ich habe kein Geld."
Sie fuhr zurück, wie von einer Tarantel gestochen, und wiederholte
mit einer Stimme, die aus der Unterwelt zu kommen schien:
„Kein Geld?"
„Nein!" sagte er. „Und als eine gute Frau wirst Du Deinem
Mann auch einmal ein Opfer bringen können.
Sie aber stampfte mit dem zierlichen Fuße zornig auf:
„Und ich will auf den Maskenball!"
„Und ich kann nicht!" sagte Schmidt.
„Schändlich! unerhört!" rief sie, und brach in Thränen aus.
„Was ist da schändlich, und was unerhört?" sagte Schmidt. „Ich
kann doch meine goldene Uhr mit der alten Kette, zwei geheiligte Familien-
stücke, nicht versetzen."
„Und ich kann doch meine Betten nicht zum Pfandleiher tragen,"
schluchzte sie.
Die Sache wurde recht ungemüthlich. Frau Schmidt ward ernst-
lich böse; sie zeigte sich ihrem Mann von einer ganz neuen Seite und
sprach sogar vom Elternhaus, nach dem sie sich zurücksehne, so daß dem
armen Schmidt ganz bange wurde. Schließlich schwiegen beide Theile
und würdigten sich keines Blickes mehr, wie es zu gehen pflegt.
Schmidt zerbrach sich den Kopf, aber zu machen war nichts. Um
solche Zeit ist in Mainz außer beim Wucherer, der für schwere Zinsen
borgt, nicht leicht Geld aufzutreiben. Er machte zweinial den Versuch,
seine Frau zu versöhnen. Aber sie bestand auf dem Maskenball; sonst
wollte sie von Nichts hören. Da schalt er sie eine herzlose Kokette, sie
schalt ihn einen Hungerleider und der Bruch schien vollständig.
Der Karneval kam und man trotzte immer noch. Keines sprach
mehr ein Wort mit dem andern.
Herr Schmidt war wüthend; eine solche Halsstarrigkeit hätte er
seiner Frau denn doch nicht zugetraut. Als es Abend ward, ging er
allein aus, ohne sich von seiner Frau zu verabschieden. Sie blieb trotzig
sitzen und sah ihm nicht einmal nach. Als er ans der Straße sah, wie die
Masken zu den Ballsälen strömten, stieg sein Aerger und ein bösartiger
Die wahren
„So ä Kuuderfei Sunt deutsche Michel,
Wie er mit sei'm dicke eich'ne Prüchcl
Uff der Bierbaut sitzt und saust und schäud'tt"
Warum sind wir in Deutschland noch immer so übel daran?
Weil die wahren Staatsmänner, die wir in Hülle und Fülle haben,
noch immer nicht zur Regierung gelangt sind.
Gegenwärtig macht man sich das Regieren, das an sich doch
ein sehr schweres Geschäft ist, sehr leicht. Ein Minister hat Ge-
heimräthe, Assessoren und Sekretäre. Diese denken und schreiben
für ihn. Das nennt man dann regieren. Jedermann weiß, daß
auf diese Weise keine großen Gedanken zu Tage treten können.
Und doch haben wir wahre und tüchtige Staatsmänner in
Hülle und Fülle. Man braucht nur Abends in die Restaurationen
zu gehen, um sie zahlreich bei einander zu finden. Sie sind äußer-
lich leicht erkennbar. Gewöhnlich haben sie eine lange Pfeife und
eine Mütze auf dem Kopfe. Das sind die Staatsmänner der Zu-
kunft.
Daß sie eine Mütze oder ein Hauskäppchen mit einer Troddel
daran tragen, ist sehr wesentlich. Unter einer solchen Hülle können
die großen staatsmännischen Ideen sich entwickeln, ohne von der
Witterung beeinflußt zu werden, ein Vorzug, den man nicht allen
regierenden Staatsmännern nachrühmen kann.
Diese Staatsmänner sind auf den vortrefflichen Gedanken ge-
kommen, die Naturwissenschaften für die Politik auszunutzen.
Es gibt Substanzen genug, die anregend auf das menschliche Ge-
hirn und dessen Denkfähigkeit wirken. Als besonders geeignet dazu
hat sich bekanntlich der Alkohol erwiesen, der im menschlichen
Gehirn, wenn er nur in genügender Quantität zur Anwendung
kommt, die kühnsten und originellsten Gedanken hervorzuzaubern
vermag. Außerdem hat er noch die wunderbare Eigenschaft, die
Schwierigkeiten, welche der Ausführung solcher neuen Gedanken
im Wege stehen, ganz klein und unbedeutend erscheinen zu lassen,
wenn sie an sich auch noch so groß sind.
Um dieser Vorzüge theilhaftig zu werden, sind Abends alle
Staatsmänner der Zukunft damit beschäftigt, ihrem Gehirn den
nothwendigen Vorrath von dieser wunderthätigen Substanz zuzu-
führen. Die Einen thun dies je nach Geschmack und Bedürfniß,
indem sie Bier, die Anderen, indem sie Wein zu sich nehmen. Wie-
der Andere aber pflegen den Alkohol in Form von gebrannten
Wassern an sich zu nehmen. Wenn sie dies nur in genügenden Quan-
titäten thun, so haben sie die Aussicht, einst die trefflichsten aller
Staatsmänner zu werden.
Staatsmänner.
Man braucht sich nur zu diesen Leuten zu setzen, und man
wird aus dem Erstaunen über ihren Reichthum an Ideen gar
nicht herauskommen. Man wird finden, daß diese Männer Alles
am Besten verstehen, Alles kennen. Ein Napoleon kann ihrer
Kritik so wenig Stich halten, wie Schiller und Goethe. Man muß
ihnen Recht geben, wenn man sie bedauern hört, daß sie zur Un-
thätigkeit verdammt sind und daß ihre Ideen unausgeführt blei-
ben. Das ist eben unser nationales Unglück.
Nur unverständige Menschen, die keine Ahnung von dem
Zusammenhang der Naturwissenschaften mit der Politik haben,
grüne Jungen und eingebildete Flegel erlauben sich, unsere Staats-
männer der Zukunft als „Bierphilister" oder „Bierbankhelden"
zu bezeichnen. Dafür möge Jene die gebührende Verachtung aller
klugen und wohlgesinnten Leute treffen.
Aber werden denn die wahren Staatsmänner nie zur Regie-
rung gelangen?
O ja, allein es steht noch ein großes Hinderniß im Wege.
Diese vortrefflichen Männer sind leider immer verheirathet, und
ihre Frauen wollen nicht leiden, daß sie ihren langweiligen bür-
gerlichen Beruf vernachlässigen und sich ganz ihren Ideen widmen.
Auch kommen sie häufig sehr spät nach Hause und da machen die
Weiber Skandal.
Wir werden einen Preis auf die Lösung der Frage aussetzen,
wie diese unheilvolle Weiberherrschaft zu beseitigen ist. Die Auf-
sätze müssen mit dem Motto: „Der Pantoffel!" eingesandtwerden.
Aus Kathi's Tagebuch.
Ehen werden im Himmel geschlossen, sagt das Sprichwort. Das
heißt also, man soll sich auf Erden nicht verheirathen.
*
* *
Wenn die Liebe zwischen Mann und Frau in die Brüche gegangen
ist, so geht man bald in die Ehebrüche.
*
rjr *
Die Liebe ist blind, daher die vielen Fehltritte!
*
* *
Die erste Liebe ist der Anfang eines Romans mit sehr vielen Fort-
setzungen.
*
* *
Warum erhalten wir keinen Schutzzoll auf die Treue der Männer-
herzen ?
Are schöne Türkin.
Eine wahrhaftige Mainzer Karnevalsgeschichte.
Von Kans Ilux.
Er war ein kleiner Beamter mit dem nicht ganz ungewöhnlichen
Namen Schmidt. Sein Gehalt war nicht groß, aber desto größer seine
Neigung zu Vergnügungen, wie es ja im „goldenen Mainz" so häufig
ist. Ohnehin hatte Herr Schmidt ein hübsches Weibchen, blauäugig und
blondlockig, und Frau Schmidt liebte die Vergnügungen womöglich noch
mehr als ihr Mann. Herr Schmidt war aber auch ein zärtlicher Gatte.
Er that seiner jungen Frau alles zu lieb, was er ihr an den Augen ab-
sehen konnte, und sie nahin's gerne an, ließ es auch an Wünschen nicht
fehlen.
Für einen liebenden Gatten ist es ein wahres Vergnügen, die Wünsche
der Gattin zu erfüllen — wenn er das nöthige Kleingeld dazu hat.
Fehlt es aber an diesem, so können die dringenden Wunsche einer heiß-
geliebten Gattin oft sehr unangenehm werden.
Und so ging es unserem biederen Schmidt. Ec war gewohnt, den
Karneval mitzumachen, der am Rhein das alljährliche Hauptvergnügen
so vieler Leute bildet, und seine Gattin war es auch gewohnt. Aber
mit Schrecken sah Herr Schmidt diesmal den Karneval herannahen, denn
er befand sich in einer Geldklemme, und es blieb ihm nach der genausten
Abrechnung für den Karneval noch kein Markstück übrig.
Indessen schwieg er einstweilen und seine Frau auch, denn sie dachte,
er hätte eine Ueberraschung für sie in petto. Das hatte er auch, aber
eine Ueberraschung anderer Art, als sein hübsches Weibchen erwartete.
Da, acht Tage vor dem Beginn des Karnevals, als Herr Schmidt
Abends nachdenklich ans dem Sopha saß, setzte sich sein Weibchen zu ihm,
und begann ungewöhnlich zärtlich zu werden.
„Aha!" dachte Herr Schmidt, „der kritische Moment ist gekonimem"
— Und so war es auch.
„Nun, lieb Männchen," sagte sie mit ihrer süßesten Stimme, „wie
wird es dies Jahr mit dem Maskenball?"
Herr Schmidt nahm allen Muth zusammen und sagte ruhig:
„Diesmal wird es nichts. Sei mir nicht böse, mein Herz. Aber
ich habe kein Geld."
Sie fuhr zurück, wie von einer Tarantel gestochen, und wiederholte
mit einer Stimme, die aus der Unterwelt zu kommen schien:
„Kein Geld?"
„Nein!" sagte er. „Und als eine gute Frau wirst Du Deinem
Mann auch einmal ein Opfer bringen können.
Sie aber stampfte mit dem zierlichen Fuße zornig auf:
„Und ich will auf den Maskenball!"
„Und ich kann nicht!" sagte Schmidt.
„Schändlich! unerhört!" rief sie, und brach in Thränen aus.
„Was ist da schändlich, und was unerhört?" sagte Schmidt. „Ich
kann doch meine goldene Uhr mit der alten Kette, zwei geheiligte Familien-
stücke, nicht versetzen."
„Und ich kann doch meine Betten nicht zum Pfandleiher tragen,"
schluchzte sie.
Die Sache wurde recht ungemüthlich. Frau Schmidt ward ernst-
lich böse; sie zeigte sich ihrem Mann von einer ganz neuen Seite und
sprach sogar vom Elternhaus, nach dem sie sich zurücksehne, so daß dem
armen Schmidt ganz bange wurde. Schließlich schwiegen beide Theile
und würdigten sich keines Blickes mehr, wie es zu gehen pflegt.
Schmidt zerbrach sich den Kopf, aber zu machen war nichts. Um
solche Zeit ist in Mainz außer beim Wucherer, der für schwere Zinsen
borgt, nicht leicht Geld aufzutreiben. Er machte zweinial den Versuch,
seine Frau zu versöhnen. Aber sie bestand auf dem Maskenball; sonst
wollte sie von Nichts hören. Da schalt er sie eine herzlose Kokette, sie
schalt ihn einen Hungerleider und der Bruch schien vollständig.
Der Karneval kam und man trotzte immer noch. Keines sprach
mehr ein Wort mit dem andern.
Herr Schmidt war wüthend; eine solche Halsstarrigkeit hätte er
seiner Frau denn doch nicht zugetraut. Als es Abend ward, ging er
allein aus, ohne sich von seiner Frau zu verabschieden. Sie blieb trotzig
sitzen und sah ihm nicht einmal nach. Als er ans der Straße sah, wie die
Masken zu den Ballsälen strömten, stieg sein Aerger und ein bösartiger