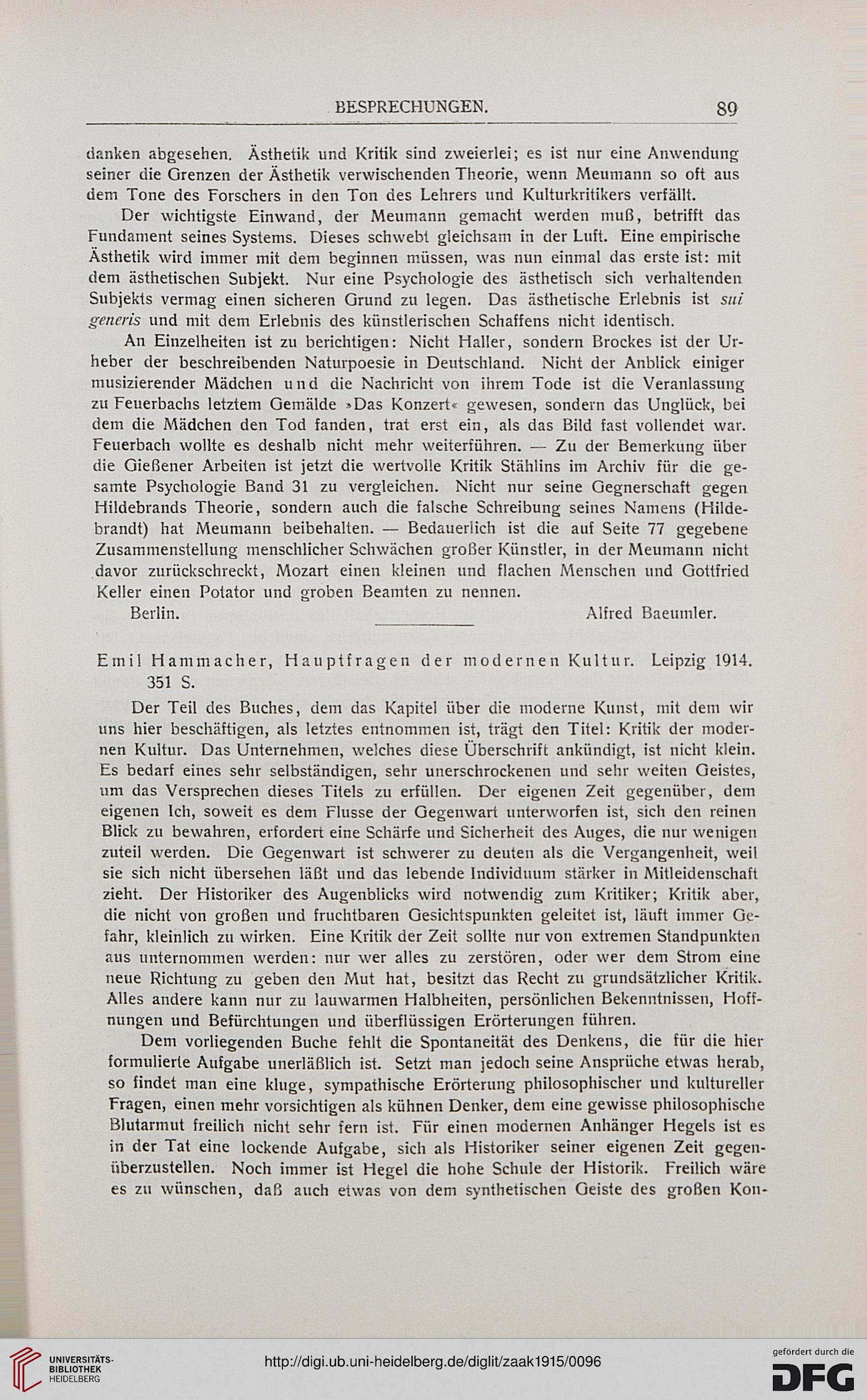BESPRECHUNGEN. 89
danken abgesehen. Ästhetik und Kritik sind zweierlei; es ist nur eine Anwendung
seiner die Grenzen der Ästhetik verwischenden Theorie, wenn Meumann so oft aus
dem Tone des Forschers in den Ton des Lehrers und Kulturkritikers verfällt.
Der wichtigste Einwand, der Meumann gemacht werden muß, betrifft das
Fundament seines Systems. Dieses schwebt gleichsam in der Luft. Eine empirische
Ästhetik wird immer mit dem beginnen müssen, was nun einmal das erste ist: mit
dem ästhetischen Subjekt. Nur eine Psychologie des ästhetisch sich verhaltenden
Subjekts vermag einen sicheren Grund zu legen. Das ästhetische Erlebnis ist sni
generis und mit dem Erlebnis des künstlerischen Schaffens nicht identisch.
An Einzelheiten ist zu berichtigen: Nicht Haller, sondern Brockes ist der Ur-
heber der beschreibenden Naturpoesie in Deutschland. Nicht der Anblick einiger
musizierender Mädchen und die Nachricht von ihrem Tode ist die Veranlassung
zu Feuerbachs letztem Gemälde »Das Konzert* gewesen, sondern das Unglück, bei
dem die Mädchen den Tod fanden, trat erst ein, als das Bild fast vollendet war.
Feuerbach wollte es deshalb nicht mehr weiterführen. — Zu der Bemerkung über
die Gießener Arbeiten ist jetzt die wertvolle Kritik Stählins im Archiv für die ge-
samte Psychologie Band 31 zu vergleichen. Nicht nur seine Gegnerschaft gegen
Hildebrands Theorie, sondern auch die falsche Schreibung seines Namens (Hilde-
brandt) hat Meumann beibehalten. — Bedauerlich ist die auf Seite 77 gegebene
Zusammenstellung menschlicher Schwächen großer Künstler, in der Meumann nicht
davor zurückschreckt, Mozart einen kleinen und flachen Menschen und Gottfried
Keller einen Potator und groben Beamten zu nennen.
Berlin. Alfred Baeumler.
Emil Hammacher, Hauptfragen der modernen Kultur. Leipzig 1914.
351 S.
Der Teil des Buches, dem das Kapitel über die moderne Kunst, mit dem wir
uns hier beschäftigen, als letztes entnommen ist, trägt den Titel: Kritik der moder-
nen Kultur. Das Unternehmen, welches diese Überschrift ankündigt, ist nicht klein.
Es bedarf eines sehr selbständigen, sehr unerschrockenen und sehr weiten Geistes,
um das Versprechen dieses Titels zu erfüllen. Der eigenen Zeit gegenüber, dem
eigenen Ich, soweit es dem Flusse der Gegenwart unterworfen ist, sich den reinen
Blick zu bewahren, erfordert eine Schärfe und Sicherheit des Auges, die nur wenigen
zuteil werden. Die Gegenwart ist schwerer zu deuten als die Vergangenheit, weil
sie sich nicht übersehen läßt und das lebende Individuum stärker in Mitleidenschaft
zieht. Der Historiker des Augenblicks wird notwendig zum Kritiker; Kritik aber,
die nicht von großen und fruchtbaren Gesichtspunkten geleitet ist, läuft immer Ge-
fahr, kleinlich zu wirken. Eine Kritik der Zeit sollte nur von extremen Standpunkten
aus unternommen werden: nur wer alles zu zerstören, oder wer dem Strom eine
neue Richtung zu geben den Mut hat, besitzt das Recht zu grundsätzlicher Kritik.
Alles andere kann nur zu lauwarmen Halbheiten, persönlichen Bekenntnissen, Hoff-
nungen und Befürchtungen und überflüssigen Erörterungen führen.
Dem vorliegenden Buche fehlt die Spontaneität des Denkens, die für die hier
formulierte Aufgabe unerläßlich ist. Setzt man jedoch seine Ansprüche etwas herab,
so findet man eine kluge, sympathische Erörterung philosophischer und kultureller
Fragen, einen mehr vorsichtigen als kühnen Denker, dem eine gewisse philosophische
Blutarmut freilich nicht sehr fern ist. Für einen modernen Anhänger Hegels ist es
in der Tat eine lockende Aufgabe, sich als Historiker seiner eigenen Zeit gegen-
überzustellen. Noch immer ist Hegel die hohe Schule der Historik. Freilich wäre
es zu wünschen, daß auch etwas von dem synthetischen Geiste des großen Kon-
danken abgesehen. Ästhetik und Kritik sind zweierlei; es ist nur eine Anwendung
seiner die Grenzen der Ästhetik verwischenden Theorie, wenn Meumann so oft aus
dem Tone des Forschers in den Ton des Lehrers und Kulturkritikers verfällt.
Der wichtigste Einwand, der Meumann gemacht werden muß, betrifft das
Fundament seines Systems. Dieses schwebt gleichsam in der Luft. Eine empirische
Ästhetik wird immer mit dem beginnen müssen, was nun einmal das erste ist: mit
dem ästhetischen Subjekt. Nur eine Psychologie des ästhetisch sich verhaltenden
Subjekts vermag einen sicheren Grund zu legen. Das ästhetische Erlebnis ist sni
generis und mit dem Erlebnis des künstlerischen Schaffens nicht identisch.
An Einzelheiten ist zu berichtigen: Nicht Haller, sondern Brockes ist der Ur-
heber der beschreibenden Naturpoesie in Deutschland. Nicht der Anblick einiger
musizierender Mädchen und die Nachricht von ihrem Tode ist die Veranlassung
zu Feuerbachs letztem Gemälde »Das Konzert* gewesen, sondern das Unglück, bei
dem die Mädchen den Tod fanden, trat erst ein, als das Bild fast vollendet war.
Feuerbach wollte es deshalb nicht mehr weiterführen. — Zu der Bemerkung über
die Gießener Arbeiten ist jetzt die wertvolle Kritik Stählins im Archiv für die ge-
samte Psychologie Band 31 zu vergleichen. Nicht nur seine Gegnerschaft gegen
Hildebrands Theorie, sondern auch die falsche Schreibung seines Namens (Hilde-
brandt) hat Meumann beibehalten. — Bedauerlich ist die auf Seite 77 gegebene
Zusammenstellung menschlicher Schwächen großer Künstler, in der Meumann nicht
davor zurückschreckt, Mozart einen kleinen und flachen Menschen und Gottfried
Keller einen Potator und groben Beamten zu nennen.
Berlin. Alfred Baeumler.
Emil Hammacher, Hauptfragen der modernen Kultur. Leipzig 1914.
351 S.
Der Teil des Buches, dem das Kapitel über die moderne Kunst, mit dem wir
uns hier beschäftigen, als letztes entnommen ist, trägt den Titel: Kritik der moder-
nen Kultur. Das Unternehmen, welches diese Überschrift ankündigt, ist nicht klein.
Es bedarf eines sehr selbständigen, sehr unerschrockenen und sehr weiten Geistes,
um das Versprechen dieses Titels zu erfüllen. Der eigenen Zeit gegenüber, dem
eigenen Ich, soweit es dem Flusse der Gegenwart unterworfen ist, sich den reinen
Blick zu bewahren, erfordert eine Schärfe und Sicherheit des Auges, die nur wenigen
zuteil werden. Die Gegenwart ist schwerer zu deuten als die Vergangenheit, weil
sie sich nicht übersehen läßt und das lebende Individuum stärker in Mitleidenschaft
zieht. Der Historiker des Augenblicks wird notwendig zum Kritiker; Kritik aber,
die nicht von großen und fruchtbaren Gesichtspunkten geleitet ist, läuft immer Ge-
fahr, kleinlich zu wirken. Eine Kritik der Zeit sollte nur von extremen Standpunkten
aus unternommen werden: nur wer alles zu zerstören, oder wer dem Strom eine
neue Richtung zu geben den Mut hat, besitzt das Recht zu grundsätzlicher Kritik.
Alles andere kann nur zu lauwarmen Halbheiten, persönlichen Bekenntnissen, Hoff-
nungen und Befürchtungen und überflüssigen Erörterungen führen.
Dem vorliegenden Buche fehlt die Spontaneität des Denkens, die für die hier
formulierte Aufgabe unerläßlich ist. Setzt man jedoch seine Ansprüche etwas herab,
so findet man eine kluge, sympathische Erörterung philosophischer und kultureller
Fragen, einen mehr vorsichtigen als kühnen Denker, dem eine gewisse philosophische
Blutarmut freilich nicht sehr fern ist. Für einen modernen Anhänger Hegels ist es
in der Tat eine lockende Aufgabe, sich als Historiker seiner eigenen Zeit gegen-
überzustellen. Noch immer ist Hegel die hohe Schule der Historik. Freilich wäre
es zu wünschen, daß auch etwas von dem synthetischen Geiste des großen Kon-