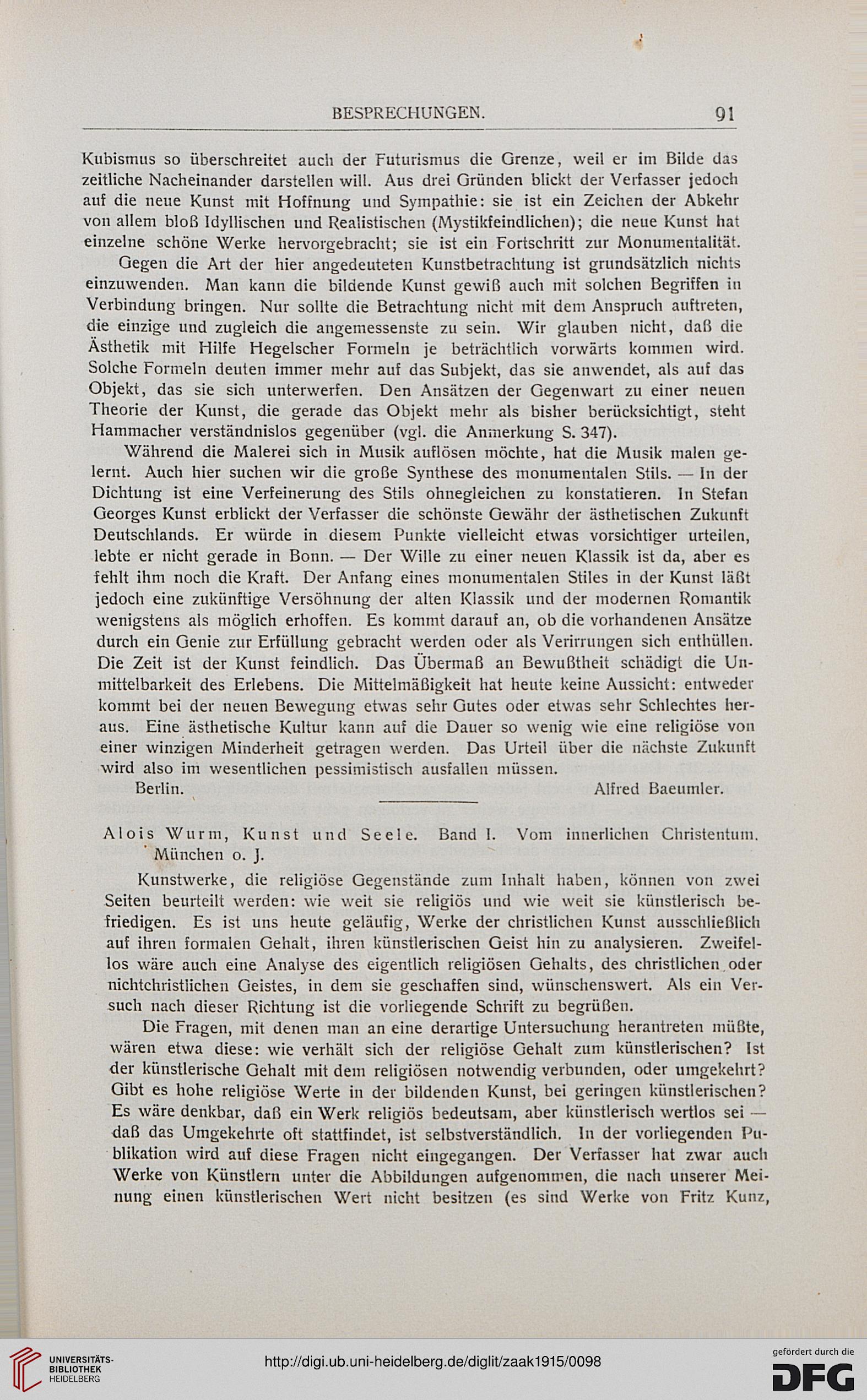BESPRECHUNGEN. 91
Kubismus so überschreitet auch der Futurismus die Grenze, weil er im Bilde das
zeitliche Nacheinander darstellen will. Aus drei Gründen blickt der Verfasser jedoch
auf die neue Kunst mit Hoffnung und Sympathie: sie ist ein Zeichen der Abkehr
von allem bloß Idyllischen und Realistischen (Mystikfeindlichen); die neue Kunst hat
einzelne schöne Werke hervorgebracht; sie ist ein Fortschritt zur Monumentalität.
Gegen die Art der hier angedeuteten Kunstbetrachtung ist grundsätzlich nichts
einzuwenden. Man kann die bildende Kunst gewiß auch mit solchen Begriffen in
Verbindung bringen. Nur sollte die Betrachtung nicht mit dem Anspruch auftreten,
die einzige und zugleich die angemessenste zu sein. Wir glauben nicht, daß die
Ästhetik mit Hilfe Hegelscher Formeln je beträchtlich vorwärts kommen wird.
Solche Formeln deuten immer mehr auf das Subjekt, das sie anwendet, als auf das
Objekt, das sie sich unterwerfen. Den Ansätzen der Gegenwart zu einer neuen
Theorie der Kunst, die gerade das Objekt mehr als bisher berücksichtigt, steht
Hammacher verständnislos gegenüber (vgl. die Anmerkung S. 347).
Während die Malerei sich in Musik auflösen möchte, hat die Musik malen ge-
lernt. Auch hier suchen wir die große Synthese des monumentalen Stils. — In der
Dichtung ist eine Verfeinerung des Stils ohnegleichen zu konstatieren. In Stefan
Georges Kunst erblickt der Verfasser die schönste Gewähr der ästhetischen Zukunft
Deutschlands. Er würde in diesem Punkte vielleicht etwas vorsichtiger urteilen,
lebte er nicht gerade in Bonn. — Der Wille zu einer neuen Klassik ist da, aber es
fehlt ihm noch die Kraft. Der Anfang eines monumentalen Stiles in der Kunst läßt
jedoch eine zukünftige Versöhnung der alten Klassik und der modernen Romantik
wenigstens als möglich erhoffen. Es kommt darauf an, ob die vorhandenen Ansätze
durch ein Genie zur Erfüllung gebracht werden oder als Verirrungen sich enthüllen.
Die Zeit ist der Kunst feindlich. Das Übermaß an Bewußtheit schädigt die Un-
mittelbarkeit des Erlebens. Die Mittelmäßigkeit hat heute keine Aussicht: entweder
kommt bei der neuen Bewegung etwas sehr Gutes oder etwas sehr Schlechtes her-
aus. Eine ästhetische Kultur kann auf die Dauer so wenig wie eine religiöse von
einer winzigen Minderheit getragen werden. Das Urteil über die nächste Zukunft
wird also im wesentlichen pessimistisch ausfallen müssen.
Berlin. Alfred Baeumler.
Alois Wurm, Kunst und Seele. Band 1. Vom innerlichen Christentum.
' München o. J.
Kunstwerke, die religiöse Gegenstände zum Inhalt haben, können von zwei
Seiten beurteilt v/erden: wie weit sie religiös und wie weit sie künstlerisch be-
friedigen. Es ist uns heute geläufig, Werke der christlichen Kunst ausschließlich
auf ihren formalen Gehalt, ihren künstlerischen Geist hin zu analysieren. Zweifel-
los wäre auch eine Analyse des eigentlich religiösen Gehalts, des christlichen oder
nichtchristiichen Geistes, in dem sie geschaffen sind, wünschenswert. Als ein Ver-
such nach dieser Richtung ist die vorliegende Schrift zu begrüßen.
Die Fragen, mit denen man an eine derartige Untersuchung herantreten müßte,
wären etwa diese: wie verhält sich der religiöse Gehalt zum künstlerischen? Ist
der künstlerische Gehalt mit dem religiösen notwendig verbunden, oder umgekehrt?
Gibt es hohe religiöse Werte in der bildenden Kunst, bei geringen künstlerischen?
Es wäre denkbar, daß ein Werk religiös bedeutsam, aber künstlerisch wertlos sei —
daß das Umgekehrte oft stattfindet, ist selbstverständlich. In der vorliegenden Pu-
blikation wird auf diese Fragen nicht eingegangen. Der Verfasser hat zwar auch
Werke von Künstlern unter die Abbildungen aufgenommen, die nach unserer Mei-
nung einen künstlerischen Wert nicht besitzen (es sind Werke von Fritz Kunz,
Kubismus so überschreitet auch der Futurismus die Grenze, weil er im Bilde das
zeitliche Nacheinander darstellen will. Aus drei Gründen blickt der Verfasser jedoch
auf die neue Kunst mit Hoffnung und Sympathie: sie ist ein Zeichen der Abkehr
von allem bloß Idyllischen und Realistischen (Mystikfeindlichen); die neue Kunst hat
einzelne schöne Werke hervorgebracht; sie ist ein Fortschritt zur Monumentalität.
Gegen die Art der hier angedeuteten Kunstbetrachtung ist grundsätzlich nichts
einzuwenden. Man kann die bildende Kunst gewiß auch mit solchen Begriffen in
Verbindung bringen. Nur sollte die Betrachtung nicht mit dem Anspruch auftreten,
die einzige und zugleich die angemessenste zu sein. Wir glauben nicht, daß die
Ästhetik mit Hilfe Hegelscher Formeln je beträchtlich vorwärts kommen wird.
Solche Formeln deuten immer mehr auf das Subjekt, das sie anwendet, als auf das
Objekt, das sie sich unterwerfen. Den Ansätzen der Gegenwart zu einer neuen
Theorie der Kunst, die gerade das Objekt mehr als bisher berücksichtigt, steht
Hammacher verständnislos gegenüber (vgl. die Anmerkung S. 347).
Während die Malerei sich in Musik auflösen möchte, hat die Musik malen ge-
lernt. Auch hier suchen wir die große Synthese des monumentalen Stils. — In der
Dichtung ist eine Verfeinerung des Stils ohnegleichen zu konstatieren. In Stefan
Georges Kunst erblickt der Verfasser die schönste Gewähr der ästhetischen Zukunft
Deutschlands. Er würde in diesem Punkte vielleicht etwas vorsichtiger urteilen,
lebte er nicht gerade in Bonn. — Der Wille zu einer neuen Klassik ist da, aber es
fehlt ihm noch die Kraft. Der Anfang eines monumentalen Stiles in der Kunst läßt
jedoch eine zukünftige Versöhnung der alten Klassik und der modernen Romantik
wenigstens als möglich erhoffen. Es kommt darauf an, ob die vorhandenen Ansätze
durch ein Genie zur Erfüllung gebracht werden oder als Verirrungen sich enthüllen.
Die Zeit ist der Kunst feindlich. Das Übermaß an Bewußtheit schädigt die Un-
mittelbarkeit des Erlebens. Die Mittelmäßigkeit hat heute keine Aussicht: entweder
kommt bei der neuen Bewegung etwas sehr Gutes oder etwas sehr Schlechtes her-
aus. Eine ästhetische Kultur kann auf die Dauer so wenig wie eine religiöse von
einer winzigen Minderheit getragen werden. Das Urteil über die nächste Zukunft
wird also im wesentlichen pessimistisch ausfallen müssen.
Berlin. Alfred Baeumler.
Alois Wurm, Kunst und Seele. Band 1. Vom innerlichen Christentum.
' München o. J.
Kunstwerke, die religiöse Gegenstände zum Inhalt haben, können von zwei
Seiten beurteilt v/erden: wie weit sie religiös und wie weit sie künstlerisch be-
friedigen. Es ist uns heute geläufig, Werke der christlichen Kunst ausschließlich
auf ihren formalen Gehalt, ihren künstlerischen Geist hin zu analysieren. Zweifel-
los wäre auch eine Analyse des eigentlich religiösen Gehalts, des christlichen oder
nichtchristiichen Geistes, in dem sie geschaffen sind, wünschenswert. Als ein Ver-
such nach dieser Richtung ist die vorliegende Schrift zu begrüßen.
Die Fragen, mit denen man an eine derartige Untersuchung herantreten müßte,
wären etwa diese: wie verhält sich der religiöse Gehalt zum künstlerischen? Ist
der künstlerische Gehalt mit dem religiösen notwendig verbunden, oder umgekehrt?
Gibt es hohe religiöse Werte in der bildenden Kunst, bei geringen künstlerischen?
Es wäre denkbar, daß ein Werk religiös bedeutsam, aber künstlerisch wertlos sei —
daß das Umgekehrte oft stattfindet, ist selbstverständlich. In der vorliegenden Pu-
blikation wird auf diese Fragen nicht eingegangen. Der Verfasser hat zwar auch
Werke von Künstlern unter die Abbildungen aufgenommen, die nach unserer Mei-
nung einen künstlerischen Wert nicht besitzen (es sind Werke von Fritz Kunz,